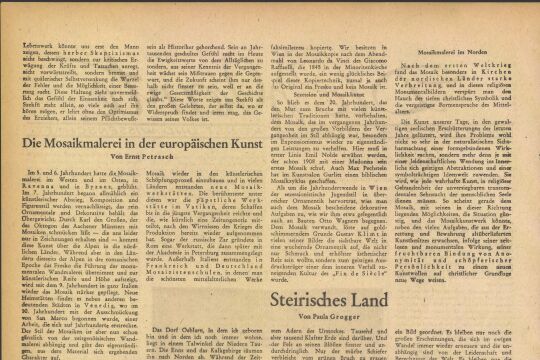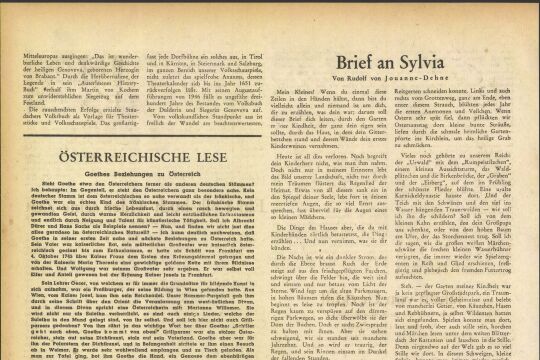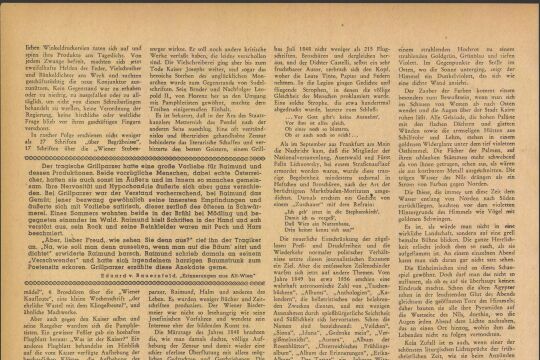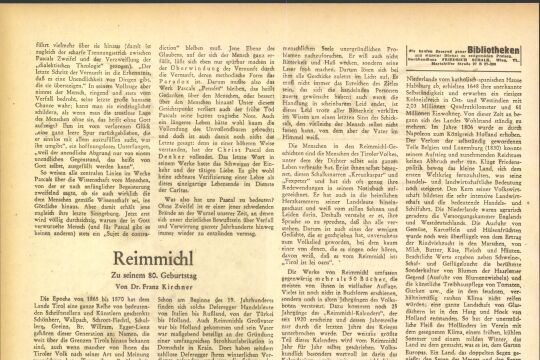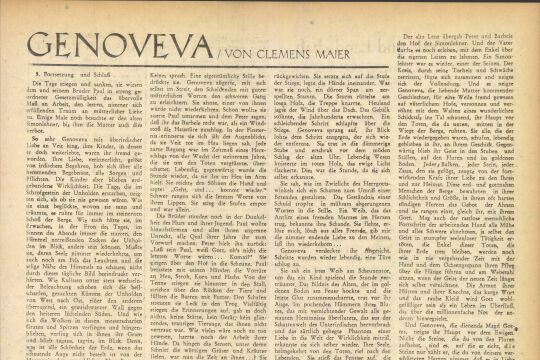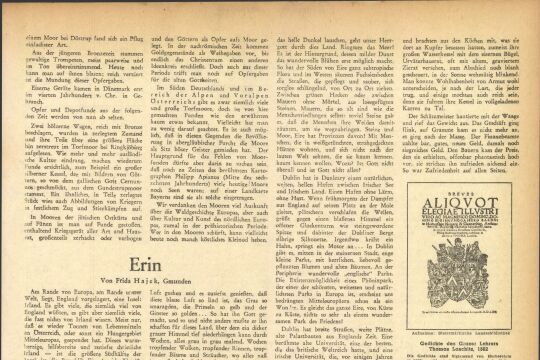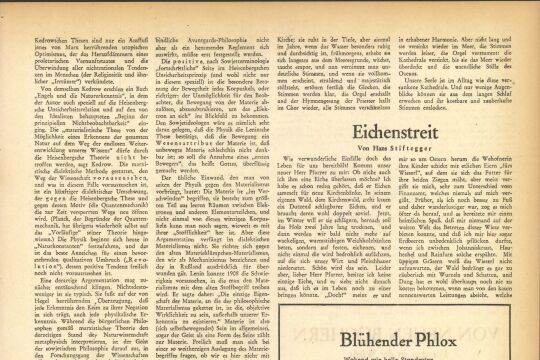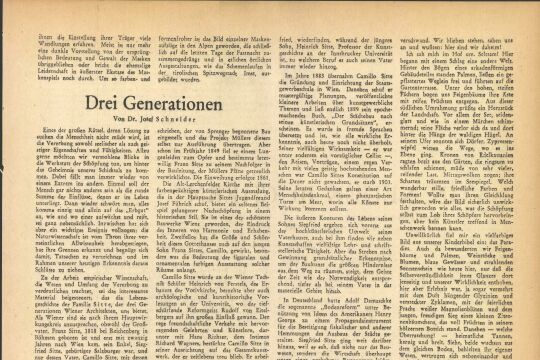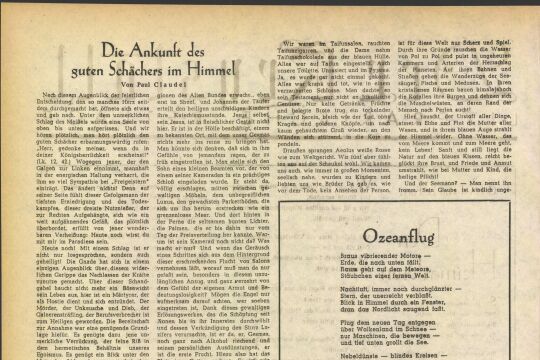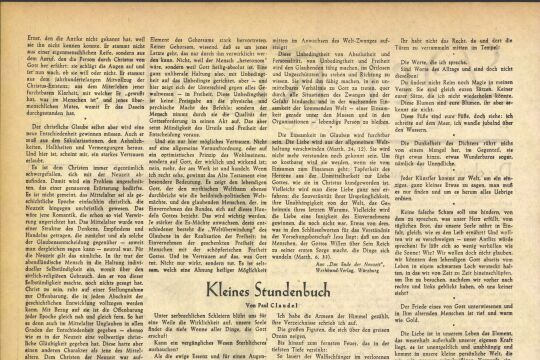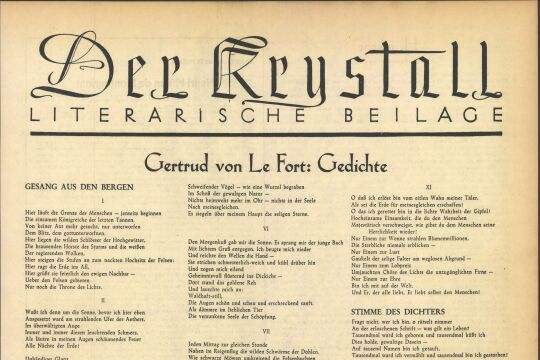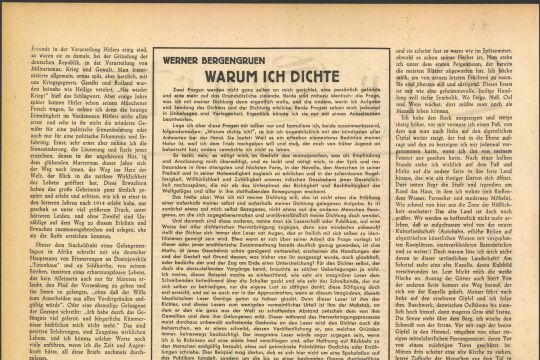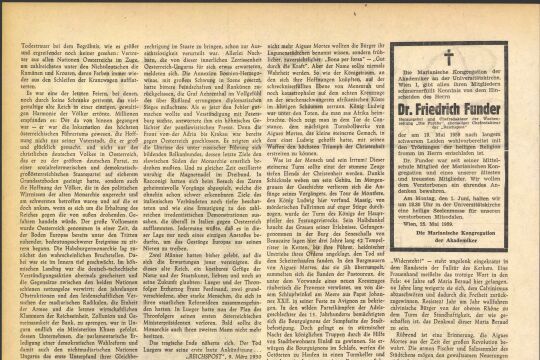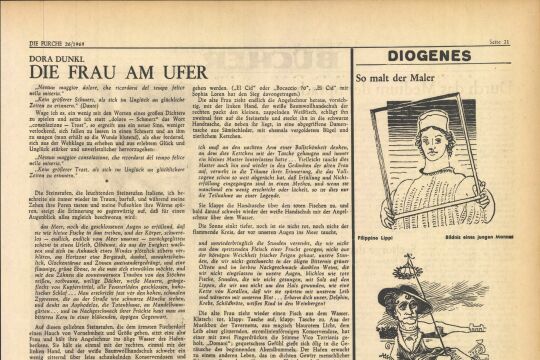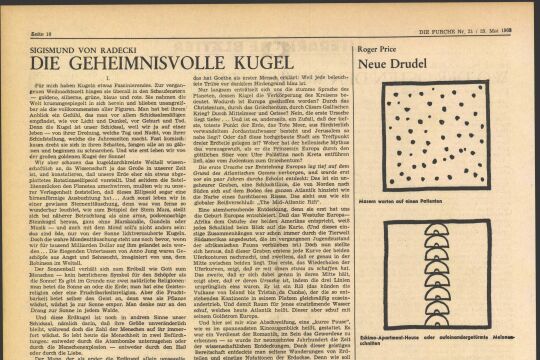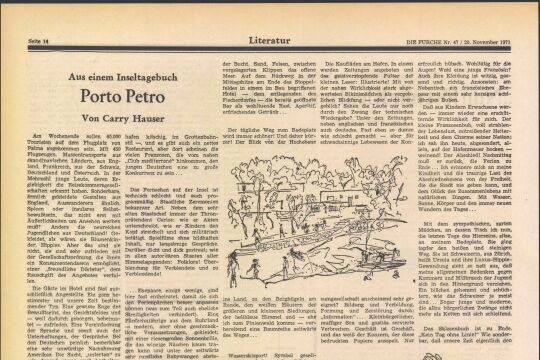Küstenrauschen
FOKUS
Die Küste: Ort des unerreichbar Nahen
Wenn man am Ufer steht und auf den Horizont hinausblickt, kann es geschehen, dass man dort, an der Linie, wo die sanfte Krümmung des Meeres den Himmel berührt, vom Garten Eden träumt. Über die Küste als Sehnsuchtsort einer entrückten, inneren Reise.
Wenn man am Ufer steht und auf den Horizont hinausblickt, kann es geschehen, dass man dort, an der Linie, wo die sanfte Krümmung des Meeres den Himmel berührt, vom Garten Eden träumt. Über die Küste als Sehnsuchtsort einer entrückten, inneren Reise.
Wenn ich, düster gestimmt, an Küsten denke, dann kommen mir zuallererst albtraumhafte Bilder von ertrunkenen Menschen, die übers Meer flüchten wollten, in den Sinn, oder von gestrandeten Walen, die nicht mehr ins Meer zurückfanden und im Sand verendeten. Die Welt ist schrecklich, ein Ort des Todes, der leergefischten Meere, abgestorbenen Korallenriffe, der ölverklumpten Strände, auf denen einst wunderbare Tiere, welche den Himmel erfreuten, dahinkriechen.
Aber hinter dem Schrecken tauchen andere Küstenbilder auf, Sehnsuchtsbilder, in meinem bildungsbeflissenen, aber wenig weltläufigen Fall: Tauris, die antike Insellandschaft im Sch warzen Meer, und Caorle, der Ferienort an der Oberen Adria in Italien. Küsten sind, wie Meere, Himmel und Horizonte, zugleich Realitäten und Symbole. Und ich möchte nicht entscheiden, was essenzieller ist, was tiefer reicht in der Anstrengung des Menschen, sich in der Welt zu beheimaten.
Küsten verweisen seit jeher auf einen Seelenhorizont aus der Tiefe der mythischen Zeit, über die wir keine Macht mehr haben. „Und an dem Ufer steh ich lange Tage, / das Land der Griechen mit der Seele suchend.“ So heißt es in Goethes Iphigenie auf Tauris. Iphigenie, als Priesterin in der Fremde, der Göttin Diana dankbar zu Diensten, lässt ihren Blick in die Ferne schweifen: „Und gegen meine Seufzer bringt die Welle / nur dumpfe Töne brausend mir herüber.“
Was sie, Iphigenie, am Ufer stehend und über das dumpf-brausende Meer hinausblickend, sucht, ist ein Griechenland, das einst ihre Wirklichkeit war; zugleich geht daraus eine Erinnerung hervor, die Iphigenies Seele eingeschmiegt ist. Dazwischen liegt der Bruch, der Riss, die Vereinsamung als Folge des Weggebracht-worden-Seins aus dem Unmittelbaren: des Vaters Hallen; der Sonne, die morgens den Himmel aufschloss; den sanften Banden der Mitgeborenen – sie alle sind zu Inbildern geworden: Bildern, in denen das Reale zugleich das unerreichbar Nahe wird, wesenhaft, zeitlos.
Sirenenhaft funkelnd
Küsten als geografische Orte umschließen Meere und Seen, sie werden, zu Häfen umgestaltet, Ausgangspunkt von Expeditionen, Landeroberungen, Kreuzfahrten. Sie sind der Tummelplatz von Sonnenhungrigen und Badelustigen. Wäre da nicht mehr, es wäre genug, um Erdwissenschaftler, Historiker, Touristiker zu beschäftigen. Doch die Küsten waren stets auch mythologische Orte, vorgelagert den Tiefen des Meeres, worin nicht nur tausenderlei Getier und Pflanzliches in großen Weiten gedeiht und woraus, „aus dem Schlamm der Urzeit“, schließlich die Lebewesen kriechen, welche das Land erobern werden. Im Meer tummelte sich allerlei Sagenhaftes, auch Gott Poseidon durchfurchte mit seinem Dreizack die Fluten, und er war nicht das einzige der Wasserwundergeschöpfe, halb Mensch, halb Fisch oder Schlange.
Und ist nicht unser Leben ein Gestrandetsein? Das ist die Frage vieler Religionen. Am Anfang muss es eine Katastrophe gegeben haben, die uns hierher brachte, ins biblische Tal der Tränen. Das ist die Sichtweise der Schöpfung, die den Sündenfall kennt: den Abfall der Engel, den Abfall Adams und Evas – und die Verbannung aus dem Paradies. Die archaische Sicht der Horizonte, die hinter den Meeren zu liegen scheinen, ist nicht ohne jene Furcht, die noch das vorkopernikanische Mittelalter heimsucht: Stürzt der Mensch hinter dem Horizont, dort, wo alle Wasser enden und kreisen, in eine Tiefe, ewigem Tod entgegen?
Aber es gibt hellere Visionen, es gibt den Horizont als Sehnsuchtsort. Man will weg von hier, von all den Bedrängnissen des Lebens, die uns über die Küsten hinaus auf das manchmal sirenenhaft funkelnde, manchmal dunkeltosende Meer führen; hinaus, um das Gelobte Land zu finden, wo Milch und Honig fließen, oder Atlantis, wo sich die Schätze aus Gold und Elfenbein türmen. Das Land, welches aus unserer Seele aufsteigt, muss hinter dem Horizont liegen, dort, wo unsere Reisen niemals enden. Deshalb stimmen uns die Küsten nicht nur abenteuerlich – es geht ins grenzenlos Weite! –, sondern auch traurig: Der letzte Hafen wird immer erst der vorletzte sein, noch immer wird hinter allen glücklich erreichten „Destinationen“ das Unerreichte locken.
Wenn man am Ufer steht und auf den Horizont hinausblickt, kann es geschehen, dass man dort, an der Linie, wo die sanfte Krümmung des Meeres den Himmel berührt, vom Garten Eden träumt: Man wird zur Ruhe gekommen, Zeit und Glück werden eins geworden sein. Man kann nicht sagen, wie die Reise, weg von der Küste, weg vom Gewicht der Welt, vonstatten ging: in einem Boot, im Flug? In den Träumen reist man jenseits der Schwerkraft. Boote gleiten als Schatten, und Flügel sind bloß eine Ahnung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!