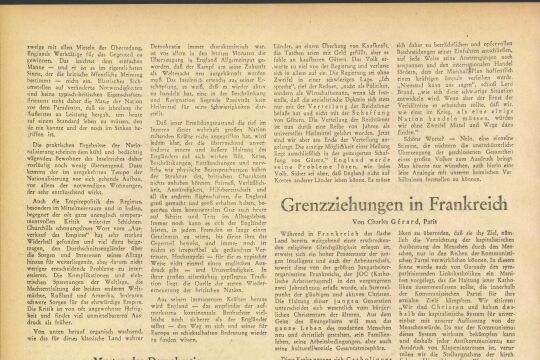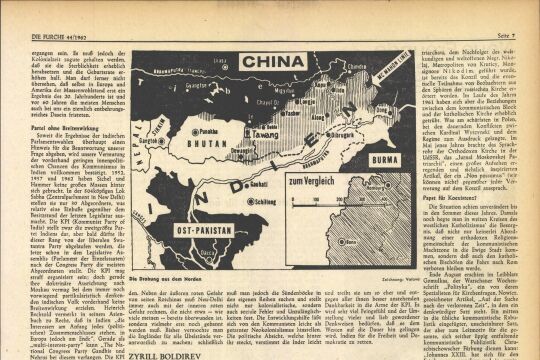9/11: Die globale Rückkehr der Religion
9/11 markiert den Anfang der religionspolitischen Gegenwart. Der bereits auf dem II. Vatikanum vollzogene Perspektivenwechsel der katholischen Kirche hilft in diesen Herausforderungen.
9/11 markiert den Anfang der religionspolitischen Gegenwart. Der bereits auf dem II. Vatikanum vollzogene Perspektivenwechsel der katholischen Kirche hilft in diesen Herausforderungen.
Der Tag markierte den Anfang unserer religionspolitischen Gegenwart. Schlagartig kehrte am 11. September 2001 ein Phänomen in die Weltpolitik zurück, das spätestens mit dem Sieg des Westens 1989 mehr oder weniger verschwunden zu sein schien: Religion als dramatischer politischer Faktor. Was zumindest in Europa als Konsequenz von dessen religionspolitischem Urtrauma, dem Dreißigjährigen Krieg, nach und nach zurückgedrängt, "zivilisiert“ und "neutralisiert“ worden war, bombte sich auf die (welt)politische Bühne zurück.
Vieles wurde plötzlich klar. Für religiöse Menschen sicherlich am provozierendsten: Auch Religion ist nicht frei von den Versuchungen des Bösen, ja sie ist bisweilen gar "die letzte Zuflucht menschlicher Grausamkeit“ (Alfred N. Whitehead). Denn das Heilige der realen Religion(en) und das universal Gute sind nicht notwendig identisch und die Unbedingtheit, zu der Religionen tendieren, kann auch die des Bösen sein.
Immer deutlicher wurde auch, dass es vor allem die kulturellen Liberalismen der westlichen Moderne sind, die den gewaltsamen religiösen Protest provozieren. Die Attentäter von 9/11 radikalisierten sich erst während ihrer Aufenthalte in westlichen Ländern. Ihre Radikalisierung war Ergebnis einer individuellen Identitätssuche und damit ein typisch westliches Phänomen. Als Kehrseite der Säkularisierung entstehen offenbar kulturell desintegrierte religiöse Vergesellschaftungsformen. Gerade Säkularisierung und Globalisierung führen Religionen dazu, "sich von der Kultur abzulösen, sich als autonom zu begreifen und sich in einem Raum neu zu konstituieren, der nicht mehr territorial und damit nicht mehr der Politik unterworfen ist.“(Olivier Roy)
Anders Breivik und die Attentäter von 9/11 kämpften letztlich gegen den gleichen Gegner: die moderne westliche Gesellschaft mit ihrem religiösen, kulturellen, ästhetischen und sexuellen Liberalismus. Gerade auch der Kampf gegen die Selbstbestimmungsrechte von Frauen scheint eine wichtige Rolle zu spielen. Die Islamisten von 9/11 zielten auf die architektonischen Machtsymbole des Westens, Breivik auf die nachwachsende multi-kulturelle politische Elite seines Landes.
Dass im Kapitalismus "alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige ... entweiht“ wird, das wussten schon das Kommunistische Manifest und auch - mit anderen Worten und Zielen - die katholische Kirche des 19. Jahrhunderts. Sie positionierten beide anti-liberale Utopien: die klassenlose Gesellschaft oder, harm- und folgenloser, die nach ewigen Prinzipien ständisch-harmonisch geordnete Gesellschaft unter kirchlichem Patronat. Chancenlos gegen die liberale Moderne waren schließlich beide.
Abschied von den anti-liberalen Utopien
Auf dem II. Vatikanum hat sich die katholische Kirche schließlich von ihrer anti-liberalen Utopie verabschiedet und einen neuen, einen Menschenrechtsstandpunkt eingenommen. Das war ein epochaler Standortwechsel. Dieser Wechsel war nicht selbstverständlich und von den Piusbrüdern etwa wird er bis heute nicht mitvollzogen. Die Menschenrechte sind für die Kirche ja tatsächlich eine prekäre Größe, sie hat sie schließlich lange bekämpft. Im Konzil stellt die Kirche klar: Sie will und muss sich an ihnen messen lassen.
Das Konzil hat diesen Perspektivenwechsel auch politisch ausbuchstabiert. Das geschieht in einigen Abschnitten der Pastoralkonstitution Gaudium et spes (77-90) und ist doppelt bemerkenswert: Klassisch sind Krieg und Frieden keine Themen der Pastoral, sondern der katholischen Soziallehre; und da war die Kirche der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts strikt anti-kommunistisch, deutlich demokratie-kritisch und vertrat recht eindeutig die Lehre vom gerechten Krieg. Alle drei Positionen kommen in Resten auch in Gaudium et spes noch vor, aber sie bestimmen nicht dessen Grundperspektive.
Denn das Konzil definiert die Kirche nicht mehr als unbeteiligten Spieler außerhalb der Konflikte, sondern als einen dem Frieden, der Gerechtigkeit und den Menschenrechten verpflichteten Mitspieler in der internationalen Gemeinschaft. Basis der politischen Option der Kirche ist ihre Solidaritätspflicht mit den Leidenden.
Ohne eine Logik der gerechten Kriegsgründe grundsätzlich auszuschließen, entwickelt das Konzil zuallererst eine Logik der unbedingten Kriegsvermeidung. Und es nennt Ungerechtigkeit und wirtschaftliche Ungleichheit als zentrale Kriegsursachen. Das Recht auf ein menschenwürdiges Leben wird zum Kriterium für friedensbringende Gerechtigkeit. Solidarität mit den Menschen, die Hilfe brauchen, ein Menschenrechtsstandpunkt in der Beurteilung des Krieges und die Hoffnung auf globale soziale Gerechtigkeit auf der Basis internationaler Organisationen und Abkommen: Das sind zentrale Neuansätze des Konzils.
Diese Lehre des II. Vatikanums ist - neben der Erklärung zur Religionsfreiheit Nostra aetate - eine wirkliche Basis der Auseinandersetzung mit der religionspolitischen Lage heute. Denn sie liefert ein Kriterium, mit ihr umzugehen. So wie sie die Unterstützung von Solidarno´s´c in Polen ermöglichte, ohne einfach als Parteigänger des Westens zu gelten, das interreligiöse Friedensgebet von Assisi, ohne alle Religionen für gleich zu erklären, und den päpstlichen Widerstand gegen den Irakkrieg, ohne in den Verdacht zu geraten, mit Saddam Hussein zu sympathisieren. Die katholische Kirche kann schon stolz sein auf die Friedensautorität der nachkonziliaren Päpste in den religionspolitischen Konflikten der Gegenwart. Ohne die Anerkennung der Religionsfreiheit als Menschenrecht aller wäre sie nicht denkbar gewesen.
Kirche - Kämpferin für die Menschenrechte
Die katholische Kirche kann zu Recht verweisen auf ihre Autorität als Kämpferin für die Menschenrechte, als Schützerin des Lebensrechts aller - unabhängig von ihrem gesellschaftlichen, ökonomischen und religiösen Status. Und die katholische Kirche hat im II. Vatikanum ihre eigene Gewaltgeschichte konzeptionell hinter sich gelassen: So kann sie dem reaktualisierten Gewaltpotenzial anderer Religionen und der Gefahr eines Wiederausbruchs ihres eigenen Gewaltpotenzials entgegentreten.
Das alles freilich unter einer Voraussetzung: Die Optionen für Menschenrechte, Solidarität mit den Leidenden und kollektiv garantierte Gerechtigkeit müssen auch wirklich vertreten werden: in den religionspolitischen Konflikten und auch in der Auseinandersetzung mit den eigenen westlichen Gesellschaften. Denn diese Optionen sind politische Wege der Nachfolge Jesu und für Christen eine wirkliche religiöse Pflicht.
Der Autor ist katholischer Pastoraltheologe an der Universität Graz.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!