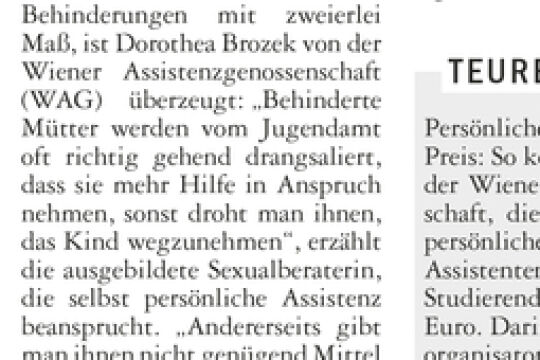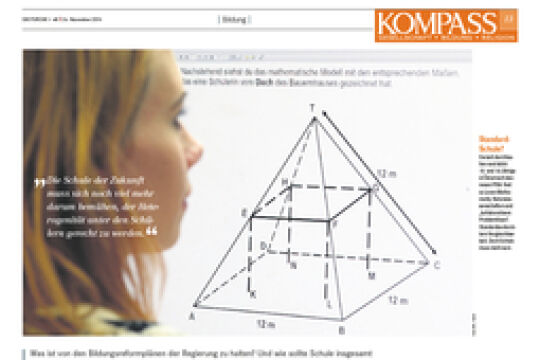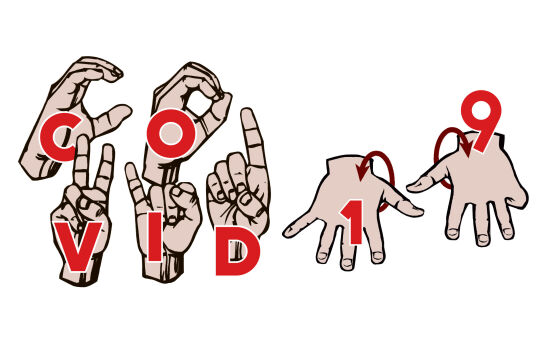"50 Euro pro Monat? Dafür bin ich zu tough"
Für viele Menschen mit Behinderungen kommt nach der Sonderschule die Werkstätte. Muss das so sein? Zwei Betroffene kommen zu Wort.
Für viele Menschen mit Behinderungen kommt nach der Sonderschule die Werkstätte. Muss das so sein? Zwei Betroffene kommen zu Wort.
Rock around the clock": Sein Klingelton könnte als Motto über dem umtriebigen Leben des Ossi Föllerer stehen. Als einer der wichtigsten Selbstvertreter sitzt er in vielen politischen Gremien auf Landes- wie Bundesebene und setzt sich für Menschen mit Lernschwierigkeiten ein: Föllerer ist Obmann von "Vienna People First", Stellvertreter in der Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung und Mitglied in der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR). Daneben ist der alleinerziehende Vater zweier Söhne leidenschaftlicher Judo- und Dartprofi. Ein kommunikativer und flexibler Mensch, der schon in frühester Jugend eine wahre Odyssee durchlaufen hat: Zuerst bei Mama, dann bei Oma, dann im Heim - und jede Übersiedlung verbunden mit einer neuen Schule; genauer einer Sonderschule. "Die Oma hat gemeint, ich gehöre dort hin, weil ich nicht Salz sage sondern Soiz", erzählt Föllerer an seinem Arbeitsplatz im Selbstvertretungszentrum für Lernschwierigkeiten im neunten Wiener Bezirk.
Heute kann er darüber lachen, auch wenn diese Entscheidung sein Leben wesentlich beeinflusst hat. "Schaut's euch die Deppaten an!", hätten die Hauptschüler von weitem gerufen. Dass Sonderschulen zu Diskriminierung führen, liegt für ihn auf der Hand - weshalb er für schulische Durchmischung plädiert. "Jeder hat unterschiedliche Stärken. Durch gegenseitiges Unterstützen lernen alle", sagt Föllerer. Geht es nach ihm, dann gibt es noch viel zu viele Sonderschulen: "Die gehören alle abgeschafft."
Von Schonraum zu Schonraum
Wie sich der Besuch einer Sonder-oder Regelschule auf die Lebensgeschichte auswirkt, hat Tobias Buchner im Rahmen seiner Forschungstätigkeit am Institut für Bildungswissenschaften der Universität Wien untersucht. Für die Studie "Quali-TYDES" wurden in Österreich, Irland, Spanien und Tschechien über 100 Erwachsene mit intellektueller, körperlicher oder visueller Beeinträchtigung befragt. Auch wenn erst wenige von ihnen integrative Schulen durchlaufen haben, zeigen sich klare Tendenzen, so Buchner: "Die Sonderschule ist ein vermeintlicher Schonraum, in dem Therapeutisches überbetont wird", erklärt er. Viele Kinder hätten in der Sonderschule ein negatives Selbstbild verinnerlicht. "Ihnen wird vermittelt, dass sie am Arbeitsmarkt keine Chance haben." Auch würden in Regelschulen häufiger Jobcoaches beraten, während man in Sonderschulen oft den Weg direkt in Tagesstätten für Menschen mit Behinderung vorgeschlagen.
Für diese Einrichtungen gibt es in Österreich vielfältige Bezeichnungen: Was in Niederösterreich "Tagesstätte" oder in Oberösterreich "Fähigkeitsorientierte Aktivität" heißt, nennt sich in Wien "Beschäftigungstherapie" und in Salzburg "Arbeitstraining" oder "Tageszentrum". Knapp 24.000 Personen sind derzeit österreichweit in diesen Einrichtungen beschäftigt; knapp 1400 arbeiten in "integrativen Betrieben" - also Einrichtungen für Menschen, die wegen Art und Schwere ihrer Behinderung noch nicht oder nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, bei denen aber eine "wirtschaftlich verwertbare Mindestleistungefähigkeit vorliegt", wie es offiziell heißt. Wieviele Menschen mit Beeinträchtigungen auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, dazu liegen keine Daten vor.
Ossi Föllerer ist bewusst, wie wichtig Information zu möglichen Chancen am Arbeitsmarkt für Schulabgänger ist. Sein eigener Wunsch, Zuckerbäcker zu lernen, wurde von der Mutter vereitelt; er sollte Automechaniker werden. Unglücklich mit dieser Wahl, unterschlug er beim Heimgehen vom Einkaufen Geld, um aus der Werkstatt geworfen zu werden. Eine Dummheit mit Folgen: Föllerer musste ins Heim nach Eggenburg. Es folgten Stationen als Hilfspfleger, als Straßenkehrer und später als Unterstandsloser. In ein Obdachlosenheim wollte er dennoch nicht -es hätte ihn zu sehr an seine eigene Kindheit im Heim erinnert. Föllerer wollte Selbstbestimmung. Keine völlige eigenständige, aber zumindest eine erfüllende Beschäftigung fand er schließlich nach zahlreichen Hilfsarbeiterjobs bei "Jugend am Werk", einer gemeinnützigen Organisation, die Menschen mit Behinderung Berufsausbildung und betreutes Wohnen ermöglicht. "Dort in der Künstlerwerkstatt habe ich mich frei entfalten können", erzählt Föllerer. "Ich konnte malen, Theater spielen und Stücke schreiben."
Dass sich Sonderschulabgänger schwer tun, am regulären Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden, ist für Buchner auch Folge der institutionellen Verzahnung von Sonderschulen und Werkstätten. "Vom Lehrer gut gemeint empfohlen, lassen sich beeinträchtigte Jugendliche oft zu einer Beschäftigungstherapie überreden, weil sie sich nichts zutrauen. Das reduziert ihre arbeitsbiographischen Möglichkeiten dramatisch", erklärt er. Eine Befragung im Rahmen des FWF-Projektes "Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in Österreich" untermauert das: Überproportional viele Sonderschulabgänger steigen direkt in Werkstätten ein. Wie schon in der Sonderschule, so leben viele beeinträchtigte Menschen auch hier in einer Art Parallelwelt.
Einer, der das so erlebt hat, ist Andreas Paukner. Häufig laute die Formel "Okay, der war in einer Sonderschule, den geben wir in eine Beschäftigungstherapie", berichtet er. "Man hat keine Wahlfreiheit, weder in der Schule noch danach." Im Volksschulalter kam Paukner in das Wiener "Institut Keil", wo man zerebral bewegungsgestörte Kinder therapeutisch und pädagogisch fördert und Eltern sowie Fachkräfte berät. "Ich wollte nach Hauptschullehrplan unterrichtet werden, weil ich später arbeiten wollte", erinnert sich der heutige Mittdreißiger, der in einem elektrischen Rollstuhl sitzt. "Das wurde mir nicht zugetraut." Mit dem Allgemeinen Sonderschulabschluss und einer Ausbildung für Büroarbeit am Polytechnikum begann Paukner selbst am "Institut Keil" als Bürogehilfe zu arbeiten.
Selbstbestimmung statt Gnade
Heute engagiert er sich auch in Forschungsprojekten zu Integration und Inklusion - aktuell entwickelt er ein Zentrum für Empowermentberatung an der Sigmund-Freud-Universität mit, um mehr Jobs am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Sein Ziel: "Viele Menschen wie mich für etwa 20 Stunden unter der Geringfügigkeitsgrenze zu beschäftigen". Arbeiten sei schließlich wichtig für Selbstbewusstsein, Eigenständigkeit und Würde. "Stell dir mal vor, du musst jeden Tag in eine Beschäftigungstherapie - Ölkreiden einsortieren." Paukner sträubte sich dagegen: "Ich arbeite nicht für 50 Euro im Monat. Dazu bin ich zu tough und weiß zu viel." Behinderte Menschen sollten keine auf Gnade und Beihilfen angewiesenen Bittsteller sein - ausgeschlossen von selbstbestimmtem Leben und Arbeitsmarkt, dafür eingeschlossen in Behindertenheimen und Beschäftigungstherapie.
Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt ihm Recht. Der Arbeitsmarkt selbst entwickelt sich jedoch gegenteilig: Zuletzt ist etwa die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen dramatisch gestiegen (s. Kasten). Das Resümée von Behindertenanwalt Erwin Buchinger ist folglich vernichtend: Österreichs Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit Behinderungen habe "glatt versagt". Ein weiter Weg also noch bis zur Vision der Inklusion.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!