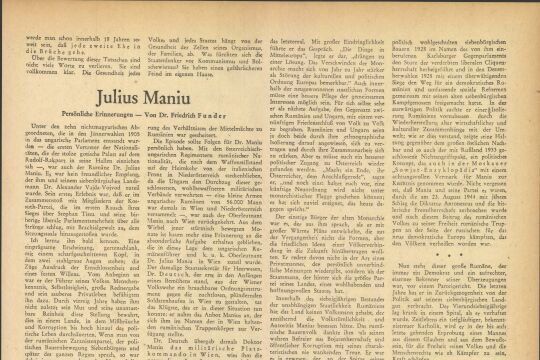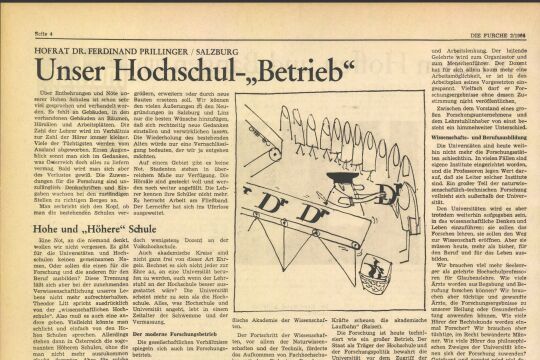Unter diesem Motto wurde die teilweise vertrackte Situation an den Universitäten diskutiert. Dabei zeigte sich: Einige der Professoren würden es heute den Jungen gleichtun - und ihr Heil in der Privatwirtschaft suchen.
In einem Nebensatz nur erwähnte der Moderator Heinrich Schmidinger zu Beginn der Podiumsdiskussion, dass jemand vom Publikum in seinen Unterlagen das Thema "Die gefesselte Phantasie" durchgestrichen und "Die entfesselte Phantasie" hingeschrieben hatte. Ein scheinbar kleiner Unterschied, aber er hätte die Diskussion wohl in eine andere - nämlich eine weniger problem- und mehr lösungsorientierte - Richtung gelenkt. So beklagten die Anwesenden am Podium und im Publikum einmal mehr die Missstände an Österreichs Universitäten.
Vielleicht wäre Schmidingers Darlegung der Begriffsgeschichte der Phantasie durch den geänderten Titel auch anders ausgefallen: Der Mittelalter-Philosoph Wilhelm Ockham, den er an den Anfang des neuen kreativen Menschen stellte ("Begriffe entstehen aus der Fictio"), war bekanntlich so phantasiereich, dass ihm die Universität Oxford den Magistertitel verwehrte. Nikolaus von Kues musste seine These von der Schöpfungskraft des Menschen vorsichtig formulieren (wie Schmidinger richtig anmerkte); die Idee vom Menschen als anderen Gott wäre im damaligen geistigen Umfeld wohl als Häresie gebrandmarkt worden. Dem geistreichen David Hume ("ohne Imagination gibt es keine Erkenntnis") blieb Zeit seines Lebens ein Lehrstuhl verwehrt - zu unangepasst war sein Denken. Und Friedrich Nietzsche schließlich betrieb seine schriftstellerische Freigeisterei die meiste Zeit außerhalb der Universität.
Von Systemzwängen …
Vielleicht ist bis heute das Denken an den Hochschulen offener gegenüber Andersdenkenden geworden, die Diskutierenden jedenfalls entdeckten neue Zwänge vor allem in den derzeitigen Restrukturierungsmaßnahmen. Rüdiger Görner (Universität London) etwa kritisierte das Überhandnehmen von diversen Evaluierungs- und Rankingverfahren, die zu einer kurzsichtigen Planungskultur führen. Als positiv wertete er hingegen die Möglichkeit, dass englische Hochschulen sich ihre Studierenden selbst aussuchen können. Die ebenfalls am Podium sitzende Hannelore Weck-Hannemann (Universität Innsbruck) regte an, dass auch in Österreich über einen Auswahlprozess zumindest auf der Master-oder PhD-Stufe ernsthaft nachgedacht werden muss. Ein Professor aus dem Publikum meinte darauf, dass die österreichische Idee des freien Hochschulzugangs schlichtweg "dumm" ist, da für eine Matura sehr unterschiedliche Standards angelegt werden. Als problematisch bezeichnete er die Fokussierung auf Schwerpunktforschung, da besonders innovative Ideen oft von den Rändern her kommen und sich nicht aus dem Mainstream entwickeln. Zudem würden zur Berechnung der ECTS-Punkte nicht überall die gleichen quantitativen Maßstäbe angelegt, wodurch Lehrveranstaltungen zwischen den Universitäten gerade nicht vergleichbar würden. Eine anderer Kritiker fügte dem hinzu, dass es überhaupt falsch sei, die ECTS-Punkte nach den aufgewandten Arbeitsstunden zu vergeben. Stattdessen müssten Lernziele formuliert werden - wie dies etwa bei den international anerkannten Sprachdiplomen üblich sei.
Ob der vielen kritischen Wortmeldungen sah sich der am Podium sitzende Johannes Buchmann (TU Darmstadt) herausgefordert, den globalisierten Ausbildungen doch etwas Positives abzugewinnen: Zumindest habe in seinem Fach, der Informatik, der Bachelor dazu geführt, dass der Austausch mit US-Studenten einfacher geworden sei. Auf die Mobilität der österreichischen Studierenden angesprochen, erklärte Weck-Hannemann: "Die Risikobereitschaft der Jungen ist leider gering."
Neben den Fesseln des Systems verwies Egon Marth (Medizinische Universität Graz) auch auf jene Fesseln, die die Gesellschaft der Wissenschaft anlegt. Als Beispiel nannte der Virologe die aktuelle Debatte um die Chimärenforschung in England, die er mit der nicht umstrittenen Produktion von monoklonalen Antikörpern verglich (Anmerkung: Bei beiden Methoden werden zwar tierische und menschliche Zellen fusioniert, bei der Anti-Körperproduktion werden aber keine embryonalen Zellen verwendet - und das macht sehr wohl einen Unterschied).
… und Geldnöten
Dann ließ Marth mit dem Bekenntnis aufhorchen: "Ich würde heute in die Industrie gehen. Man verdient gut, es gibt keine Bürokratie und man kann genauso spannende Forschung betreiben und an Konferenzen teilnehmen." Er bedauerte die spärlichen Entfaltungsmöglichkeiten an den Universitäten und kritisierte, dass es unmöglich sei, als Jungakademiker beim Wissenschaftsfond mit einem Antrag Erfolg zu haben. Ein Professor für Maschinenbau stimmte in sein Lamento ein: "Bei uns gibt es kaum Geld für Postdocs und Assistenten müssen oft mit einer 25 Stunden Bezahlung auskommen. So wandern viele in die Privatwirtschaft ab." Görner schätze die Situation an englischen Unis nicht besser ein: Kaum Postdoc-Stellen und überhaupt keine Assistenten-Stellen. Ein Chemie-Professor aus dem Publikum meinte, dass die Situation in den USA zum Teil noch schlimmer ist: Er kenne US-Professoren, die unter schlaflosen Nächten leiden, weil sie nicht wissen, ob sie nächsten Monat noch die Miete fürs Labor bezahlen können.
Am Ende der Diskussion meldete sich ein Vizedekan: Er habe an rund sechzig Berufungsverfahren teilgenommen. Den Kandidaten seien nicht die Ausstattung oder die verfügbaren Mittel das Wichtigste gewesen, sondern stets - die Unkündbarkeit der Stelle.
Fraglich, ob allein ein fixer Posten die Phantasie beflügelt. Aber ohne irgendwelche monetäre Sicherheiten werden die phantastischsten Köpfe in Zukunft der Universität wohl zunehmend fern bleiben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!