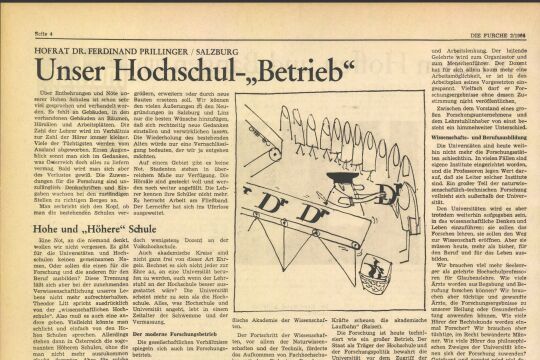In der Debatte um Eliteunis werden gerne Feind-und Vorbilder zitiert. Die bekanntesten Elitesysteme im Überblick: USA, Großbritannien und Frankreich.
An der Spitze ist nicht genug Platz für alle. Das gilt auch für die Wissenschaft. Der Gedanke, die Crème de la Crème abzuschöpfen und in eigenen Instituten zu fördern, ist nicht neu und wird in manchen Ländern schon seit Jahrzehnten, ja sogar Jahrhunderten praktiziert.
Inspiration für die in Österreich geplante University of Excellence seien unter anderem "die us-amerikanischen Forschungsuniversitäten mit ihren PhDProgrammen", heißt es in der Machbarkeitsstudie des Wissenschaftszentrums Wiens. Michael Stampfer, vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (wwtf) und Co-Autor dieser Studie betont jedoch, dass Modelle eins zu eins nicht übertragbar seien.
Das für die deutschsprachigen Länder typische System verhindert durch staatliche Regulierung und Finanzierung, dass Universitäten weit nach vorne preschen oder das Niveau nicht halten.
Anders in den usa: die ohne Zweifel bekanntesten so genannten "Leuchttürme" der Wissenschaft, wie zum Beispiel Harvard und Yale, sind privat geführte und finanzierte Institutionen. Ein Blick auf diese renommierten us-amerikanischen Eliteuniversitäten zeigt, dass diese über ein beträchtliches Eigenvermögen verfügen, dem so genannten "Endowment". Zu ihrem Vermögen sind die us-amerikanischen Universitäten unter anderem durch die von Gemeinden oder Bundesstaaten zur Verfügung gestellten Grundflächen oder durch große Schenkungen gelangt. Außerdem hat sich eine in Europa unbekannte Spenderkultur entwickelt, die auch durch die hohen Erbschaftssteuern zu erklären ist, denen man sich durch Stiftungen entziehen kann. Stampfer spricht von einem Matthäus-Effekt: "Wer hat, dem wird gegeben. Diese Unis haben Geld, holen sich damit die besten Professoren, die gute Forschung betreiben. Sie bekommen einen guten Ruf, es wird für die reiche Oberschicht schick, ihre Kinder dort studieren zu lassen, es entsteht noch mehr Vermögen." Manche Universitäten haben auch mit ihrem Finanz-Manager einen goldenen Griff getan: So hat sich zum Beispiel das Vermögen der Harvard University unter Jack R. Meyer in den vergangenen 15 Jahren von fünf auf 23 Milliarden Dollar erhöht. Einen Vorsprung der us-amerikanischen Universitäten gegenüber dem hiesigen Hochschulsystem sieht Stampfer außerdem darin, dass diese von einem hauptberuflichen Präsidenten und nicht im Nebenberuf von einem Universitätsprofessor geleitet werden. Oft wird allerdings die Spanne der Ungleichverteilung zwischen den Universitäten vergessen: Man sehe, so Stampfer, wegen der Erdkrümmung oft nur die wenigen Stars unter den Wissenschaftern, die im Geld schwimmen, nicht aber die mittellose Mehrheit.
Ebenso elitär wie die privat Universitäten in den usa, wenn auch weniger oft in der Bildungsdebatte hierzulande als Vorbild bemüht, sind die Privatschulen Großbritanniens sowie die französischen Grandes Écoles. In Großbritannien stellen nicht die bekannten Universitäten Oxford und Cambridge, sondern eine Reihe renommierter Privatschulen das entscheidende Nadelöhr auf dem Weg nach oben dar.Ungefähr fünf Prozent der britischen Schüler besuchen eine dieser Public Schools, zu denen unter anderem Eton zählt. Die Schulkosten sind enorm und belaufen sich umgerechnet auf über 13.000 Euro jährlich.
Ein gänzlich anderes Elitebildungssystem hat sich in Frankreich seit Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt. Die elitären Bildungseinrichtungen sind hier vorwiegend staatlich. Neben den öffentlichen Universitäten, die bis auf einige wenige Ausnahmen frei von Zugangsbeschränkungen sind, stellen die Grandes Écoles mit ihren äußerst restriktiven Ausleseverfahren die Schmiede für die zukünftigen Entscheidungsträger dar. Die wichtigsten unter ihnen sind die ena (École Normale d'Administration), aus der die meisten Spitzenfunktionäre der französischen Verwaltung hervorgehen, die auf Ingenieurswissenschaften ausgerichtete École Polytechnique und die wirtschaftswissenschaftliche hec (Haute École de Commerce). Zumeist werden vor der entscheidenden Aufnahmeprüfung zweijährige Vorbereitungsklassen besucht. Die Auswahl durch Prüfungen entspricht dem Prinzip der "méritocratie", einem egalitären System, in dem nur die individuelle Leistung ausschlaggebend ist, das sich jedoch angesichts der sozialen Abstammung der Studenten als Illusion entpuppt (siehe Interview). Die ungeheure Bildungsexpansion, die Ende der 60er Jahre eingesetzt hat - die Zahl der Studenten hat sich seither verdoppelt - trifft beinahe ausschließlich Universitäten. Von den rund 2,3 Millionen Studierenden besuchen nur 72.000 eine Grande École oder eine Vorbereitungsklasse.
Der Hintergedanke dieses Systems ist es, bereits während des Studiums eine Netzwerkbildung zwischen den zukünftigen Entscheidungsträgern zu fördern. Eliten bleiben eben gerne unter sich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!