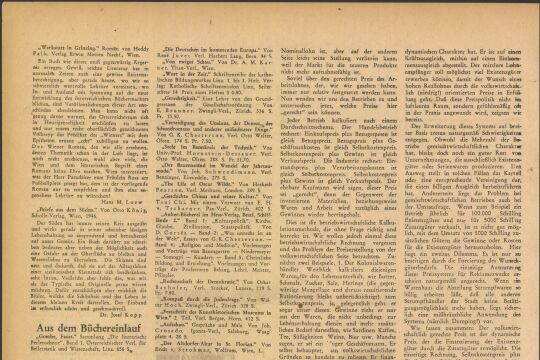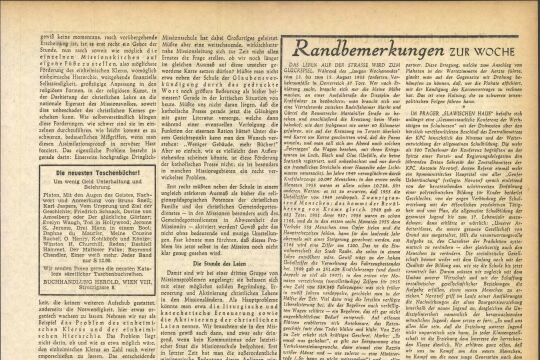Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
HANS JABLONKA
DER FRANZ, ERLAUSCHTE ich kürzlich das Gespräch zweier biederer Maurer in einem Wiener Gasthaus, der Franz sei nicht mehr ganz richtig im Kopf. Denn der Franz habe sich jetzt, und dabei könne er doch nicht einmal einen Bleistift gerade halten, eine elektrische Schreibmaschine gekauft. Anlaß genug für die beiden, den Geisteszustand ihres Arbeitskollegen einer eingehenden, in blumenreichem Wiener Dialekt formulierten Analyse zu unterziehen. Soviel dem Gespräch zu entnehmen war, hatte dieser Franz, von Beruf offenbar gesuchter Baufacharbeiter, sämtliche der gängigen Standardsymbole schon daheim stehen: eine Fernsehtruhe, einen Rieseneis-kasten, einen „gsunden“ Wagen; und jetzt, weil er nicht mehr wisse, wohin mit dem Geld, habe er sich die Schreibmaschine gekauft. Woher aber die „Marie“ käme? Nun, das sei doch ganz einfach: Der Franz verdiene gut, sein Sohn und seine Tochter auch, und außerdem gehen er und der Sohn, das sei doch selbstverständlich, jeden Samstag „am Pfusch“. Im letzten Monat, habe er geprahlt, hätten sie beide zusammen dreizehntausend Schilling verdient.
Diesen Franz als typisches Beispiel für die Lage der österreichischen Arbeiter zu nehmen, ist falsch. Er ist ein Extremfall, eine Ausnahme, die aber, indem sie übertreibt, besonders anschaulich charakterisiert. Ein Extremfall aber in der anderen Richtung ist der mir bekannte Tischlergehilfe Leopold M., der ebenfalls am Wochenende „pfuscht“ (und dabei hervorragende Arbeiten produziert). Sein Nebeneinkommen dient aber nicht dazu, Dinge zu erwerben, deren einziger Verwendungszweck ist, mit ihnen zu protzen; sondern Leopold M„ Vater dreier Kinder, braucht das „schwarze“ Geld. Vom Wochenlohn lassen sich zwar die unmittelbaren Lebensbedürfnisse decken, nicht aber das, was darüber hinausgeht: neue Mäntel für die Kinder; die Schulbücher für den Großen, der das Gymnasium besucht; der Kühlschrank (in einer größeren Familie kein Prestigesymbol, sondern eine Notwendigkeit); der Urlaubsaufenthalt (bei einem Bauern in der Steiermark).
Der zweite Fall mag zwar auch nicht allgemein gültig sein — eine Familie mit drei Kindern ist verhältnismäßig selten —, ist aber, eher als der zuerst angeführte Fall, typisch für die Situation unserer Gesellschaft: der sichtbare Wohlstand in den unteren und mittleren Einkommensschichten ist größer als sich auf Grund der offiziellen Einkommensstatistik — die sich auf Angaben der Sozialversicherungsinstitute und Steuerämter stützt — nachweisen läßt. Die Lücke zwischen dem statistisch erfaßten und dem tatsächlichen Einkommen füllt der Nebenverdienst aller Art, eben der „Pfusch“, aus.
Dieses Dialektwort hat in den vergangenen Jahren einen Bedeutungswandel durchgemacht. Bezeichnete es einst die Bastelei eines Amateurs, war es früher das Synonym für schluderhafte, schlechte Arbeit, so steht es heute für die Schwarzarbeit des Fachmanns, für die weder Steuern noch soziale Abgaben bezahlt werden.
DIE MÖGLICHKEITEN DES „PFUSCHENS“ sind so zahlreich wie die Berufsgruppen. Sie alle sind „Pfuscher“ : der. Radiomechaniker, der daheim Radioapparate repariert; die Schneiderin, die auf Empfehlung Kleider näht, aber keinen Gewerbeschein besitzt; der Staatsbeamte, der sich nach Dienstschluß der Buchhaltung von zwei Gemischtwarenhändlern und einem Handwerksmeister aus der Nachbarschaft widmet; die Bauarbeiter, die sich mit folgendem Inserat in einer Wiener Tageszeitung anboten: „Tatkräftige Maurerpartie, eigener Pkw, übernimmt am Wochenende Aufträge. Unter .Pauschale' an...“; der Angestellte, der abends und samstags als Aushilfsfahrlehrer tätig ist (er ist allerdings, weil ihn die Fahrschule bei der Sozialversicherung angemeldet hat.ein Grenzfall). Die Aufzählung ließe sich ad infinitum fortführen.
VOR ALLEM DEM HANDWERKER, dem „Professionisten“, bieten sich noch und noch Möglichkeiten steuerfreien Nebenverdienstes. Der Installateur kann frühestens in drei Wochen kommen? „Warten Sie, ich habe da einen Bekannten, der arbeitet bei einem Installateur — wenn Sie* wollen, rufe ich gleich einmal an.“ Der Malermeister sagt, er sei überlastet? „Ich glaube es ihm, doch — ja, der Sohn von unserer Hausmeisterin ist Anstreicher, der kommt Ihnen sicher am Samstag...“
Die Summen, die alljährlich durch den „Pfusch“ verdient werden, dürften in die Milliarden gehen. Es gibt natürlich keine Statistik über das Ausmaß der Schwarzarbeit; die von der Gewerbebehörde erfaßten und jeweils mit Geldstrafen von drei- oder vierhundert Schilling geahndeten Fälle sind nur der geringste Teil. Bei der Untersuchung des Problems ist man auf Schätzungen angewiesen, die indessen den tatsächlichen Verhältnissen ziemlich nahekommen dürften. So wurde errechnet, daß allein im Baugewerbe — unter der Annahme, daß nur sechs von zehn Bauarbeitern am Samstag schwarz arbeiten, jährlich an die 700 Millionen Schilling durch „Pfusch“ verdient werden. Dazu kommt das Heer der Anstreicher und Installateure, der Elektriker, Tischler und Spengler, der Radio-und Automechaniker, kurz alle Berufe, die sich mit Repararurarbeiten befassen. Aber dazu kommen noch die Dienstleistungen: die Aushilfskellner in den Ausflugsrestaurants, die nebenberuflichen Buchhalter und Vertreter, die Arbeiterfrauen, die eine Bedienung übernehmen, die Lehrer, die Nachhilfestunden erteilen. Sie alle verkaufen einen Teil ihrer Freizeit, um ihren sozialen Standard zu verbessern.
DIE BEHÖRDEN BEMÜHTEN SICH vor ein paar Jahren, zusammen mit der Handelskammer, der Schwarzarbeit Einhalt zu gebieten. Man hat Aufklärungskampagnen veranstaltet, man hat die Bevölkerung darauf hingewiesen, daß sich nicht nur der Schwarzarbeiter gewerberechtlich strafbar macht, sondern auch der Auftraggeber. Auch die Gewerkschaft trat für diese Aktionen ein; für Gewerkschaftsfunktionäre mag es unbegreiflich sein, daß die lautstark geforderte und nach mühsamen Verhandlungen erkämpfte Verkürzung der Arbeitszeit dazu führte, daß in der Freizeit — gearbeitet wird.
Der mit großem Aufwand gestartete Feldzug gegen das Pfuscherwesen kam allerdings allzubald einem Kampf gegen Windmühlen gleich. Strafen? Sie wurden verhängt, wenn die Behörde durch Zufall — oder durch den Neid von Arbeitskollegen — von Schwarzarbeit erfuhr. Als Regel aber gilt hier der alte Satz vom Richter, der nichts zu tun hat, wenn es keinen Kläger gibt. Die wendigen Plakate und Inserate, „Aufklärungsfilme“ und Rundfunk-Spots verpufften ins Leere: einfach aus dem Grund, weil die Kampagne an den tatsächlichen Gegebenheiten vorbeiging. Sie zeichnete das Bild des Pfuschers im ursprünglichen Sinn dieses Wortes (erinnert sich heute überhaupt noch jemand an diese Plakate mit der karikierten Figur des „Murks“, die 1960 überall zu sehen waren?), der aber längst nicht mehr gegeben ist, wodurch es dem ganzen Propagandafeldzug an innerer Glaubwürdigkeit mangelte.
VOLL PROBLEMATIK IST DAS PFUSCHERWESEN, das Wort „Unwesen“ scheint in der gegenwärtigen Situation bereits fehl am Platz. Dem Staat gehen direkte Steuern verloren, den Sozialversicherungsinstituten die sozialen Abgaben, denn stößt dem Schwarzarbeiter ein Unfall zu, nimmt auch er die Krankenkasse in AnspruchI Und über die Tatsache, daß das kollektivvertraglich verbriefte Mehr an Freizeit erst recht wieder zur Arbeit genutzt wird, wurden schon viele Bände verschiedenster Untersuchungen verfaßt; aber sie haben an den Gegebenheiten nichts geändert.
DER VERDIENST des „Pfuschers“ richtet sich aber auch danach, ob er weiter empfohlen wird oder nicht; dadurch fällt die Unmöglichkeit von Regreßansprüchen des Auftraggebers an den Schwarzarbeiter heute kaum noch ins Gewicht. Dazu paßt eine Geschichte, die kürzlich ein mir befreundeter Architekt zum besten gab: Einer seiner Bekannten baute sich ein Einfamilienhaus, das er, weil das billiger kam, fast zur Gänze in Wochenendarbeit von „Pfuschern“ errichten ließ. Die Schwarzarbeiter leisteten erstklassige Arbeit. „Schlampig“ ausgeführt war nur der Dachstuhl — der einzige Bauteil, den der Auftraggeber von einem befugten Handwerksmeister errichten ließ...
Der Zimmermeister mag selbstverständlich ein Einzelfall sein (und die Konstruktion des modernen Dachstuhls war ihm vorher noch nie untergekommen). Doch diese Geschichte kennzeichnet die Entwicklung, die beinahe zwangsläufig zum Überhandnehmen der Schwarzarbeit führen mußte: die Gewerbebetriebe sind überlastet, die Nachfrage ist allzuoft größer als die Kapazität. Das kann soweit gehen, daß beispielsweise ein Installateur, der laufend große Aufträge für Neubauten durchzuführen hat, nicht nur kaum die Möglichkeit, sondern auch gar kein Interesse aufbringt, kleine Reparaturarbeiten zu übernehmen — und wenn, muß er die Monteurstunde mit erheblichen Zuschlägen belegen, um etwa bei der Reparatur eines Wasserhahnes noch auf seine Rechnung zu kommen.
DER „ZWEITE ARBEITSMARKT* der „Pfuscher“ entwickelt sich aus dem Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, dessen Basis mit jeder weiteren Verkürzung der Arbeitszeit breiter wird. So problematisch diese Entwicklung auch sein mag - zur Zeit erfüllt der Schwarzarbeiter leider eine i offensichtliche ökonomische Funktion.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!