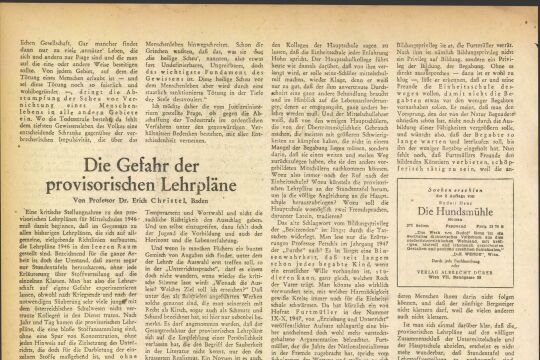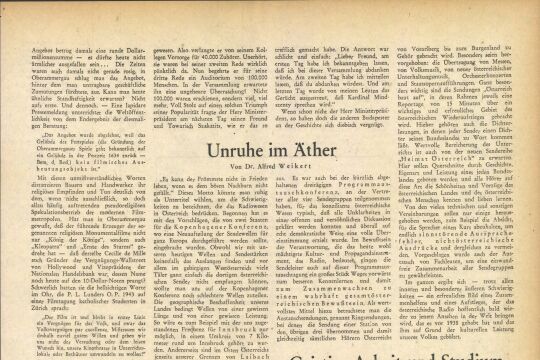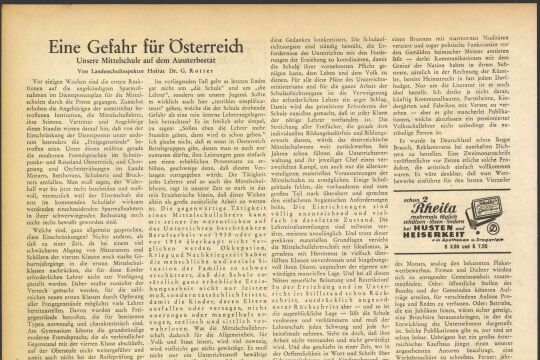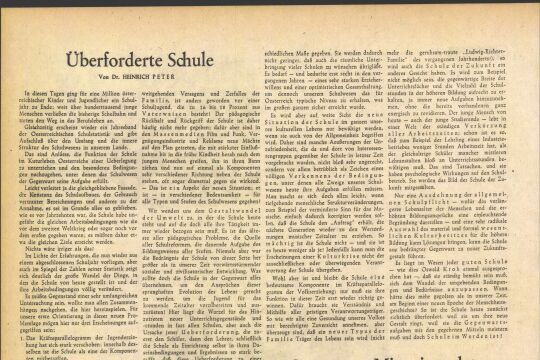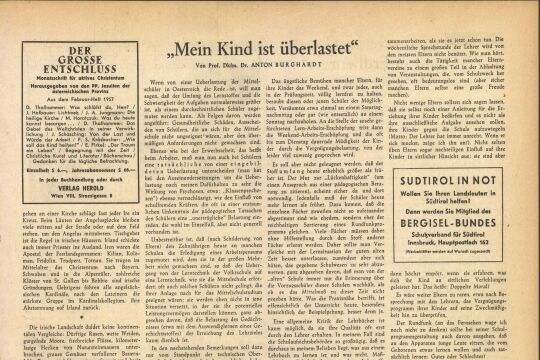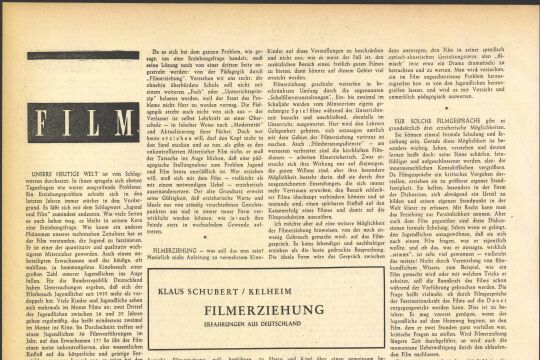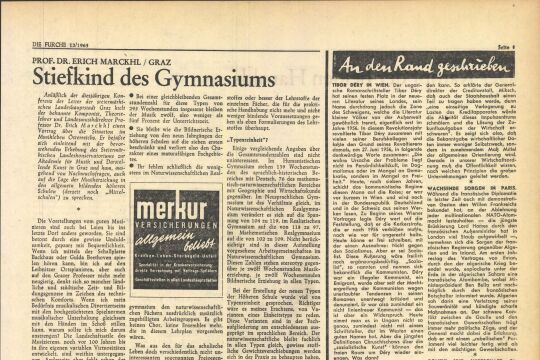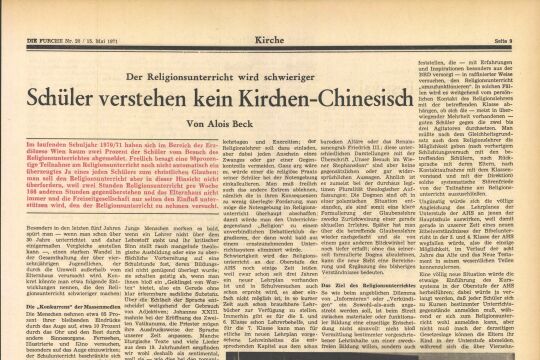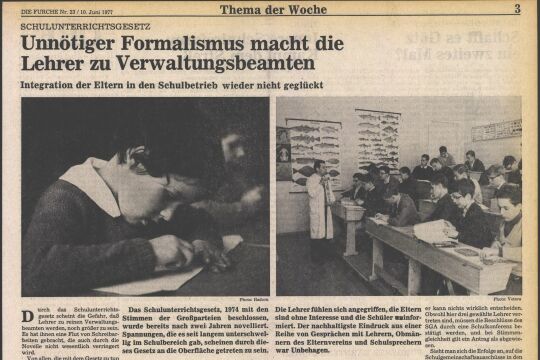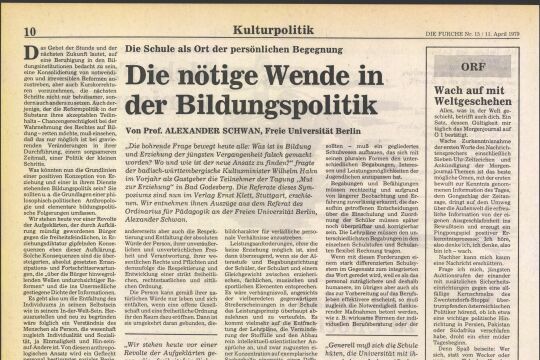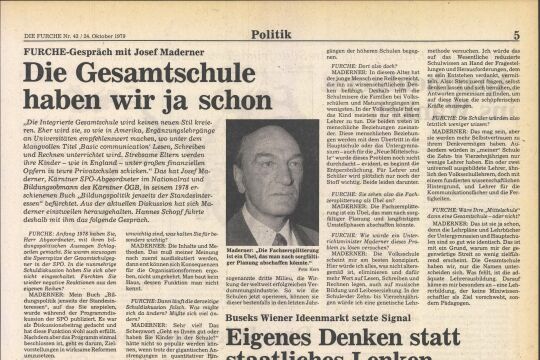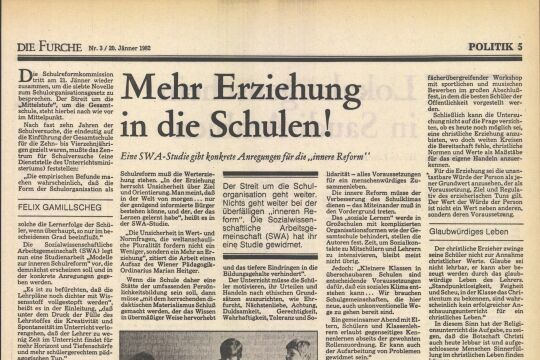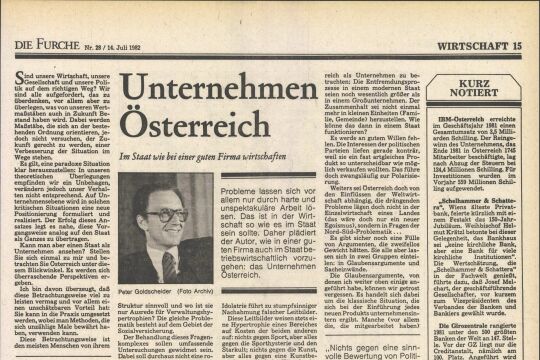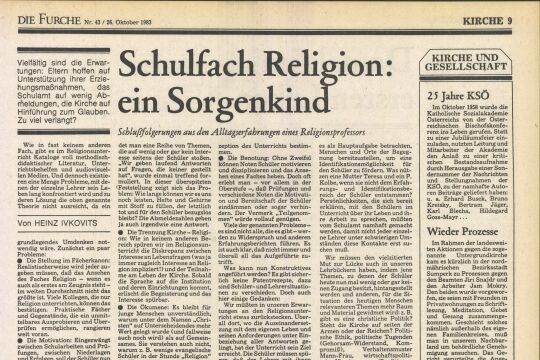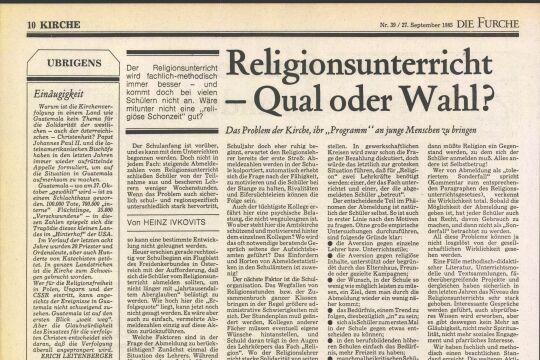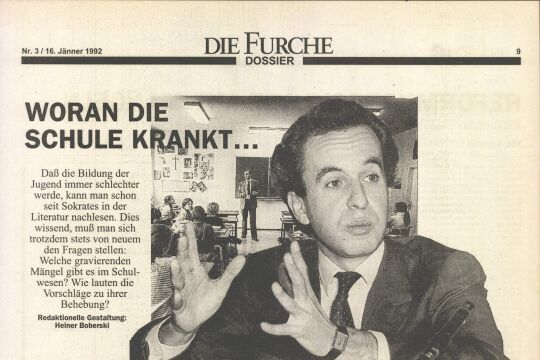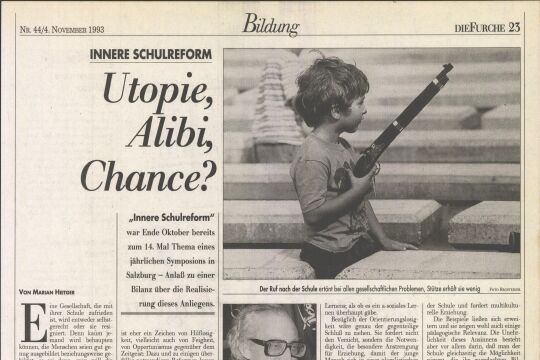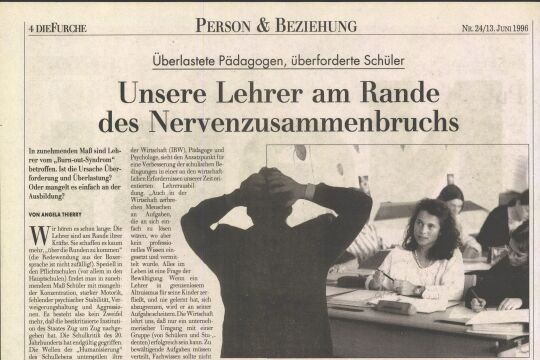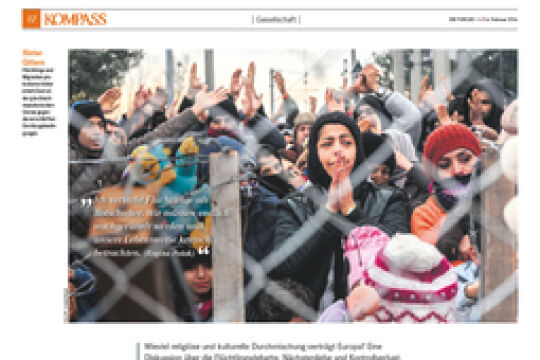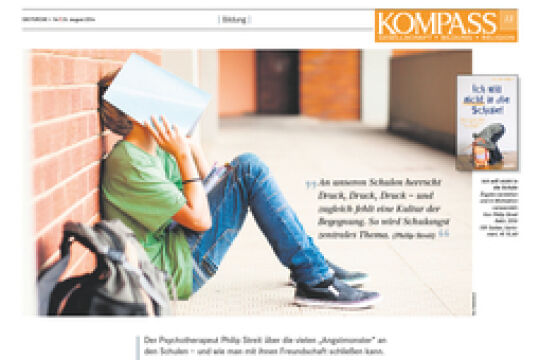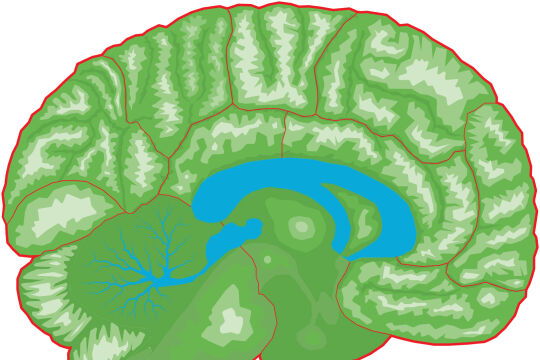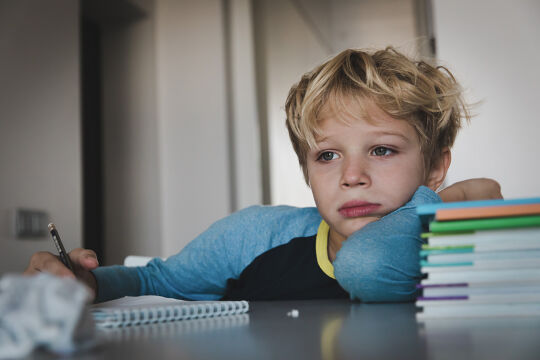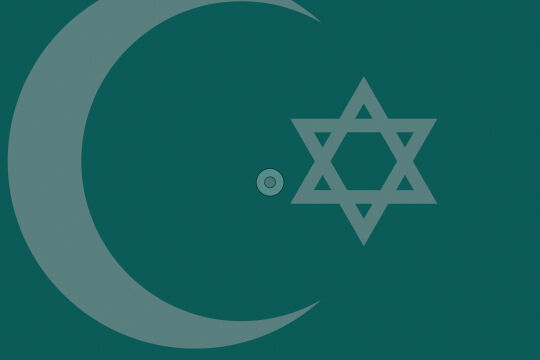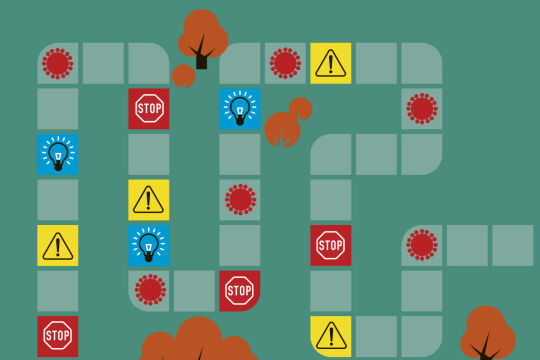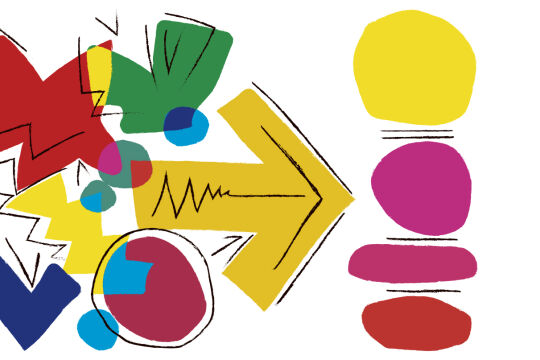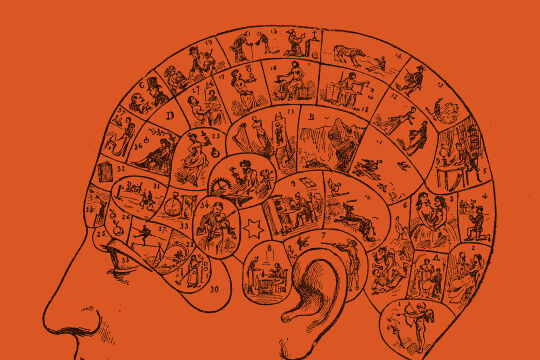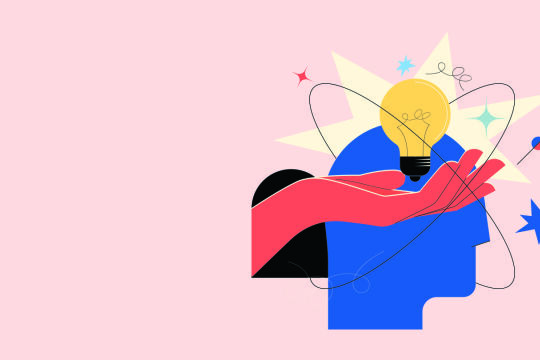Nahostkonflikt: Geschichtsstunde als Blackbox
Niemand weiß genau, was Österreichs Schüler(innen) über den Nahostkonflikt lernen, sagt der Historiker Werner Dreier. In der FURCHE fordert er eine breitere Debatte zur Priorisierung von Inhalten.
Niemand weiß genau, was Österreichs Schüler(innen) über den Nahostkonflikt lernen, sagt der Historiker Werner Dreier. In der FURCHE fordert er eine breitere Debatte zur Priorisierung von Inhalten.
Schule heißt auch Begegnung mit Menschen, die ihre Positionen sichtbar machen und ausverhandeln, erklärt Werner Dreier, Gründungsgeschäftsführer von erinnern.at. In Bezug auf den Nahostkonflikt sieht er diverse Haltungen mehr als Chance denn als Problem. Unser Bildungssystem sei stabil genug, um das auszuhalten.
DIE FURCHE: Herr Dr. Dreier, was lernen Heranwachsende in Österreichs Schulen eigentlich genau über den Nahostkonflikt?
Werner Dreier: Das ist aus unterschiedlichen Gründen schwer beantwortbar. Der hauptsächliche Grund ist, dass es kaum möglich ist, auch mit großem Aufwand nicht, zu erforschen, was Schülerinnen und Schüler tatsächlich im Unterricht lernen. Was in der Klasse vorgeht, ist eine Blackbox. Die eigentliche Frage ist daher: Wie steuert man Unterricht, wie bewirkt eine Gesellschaft, ein Ministerium, dass dieses oder jenes gelehrt wird?
DIE FURCHE: Und wie würden Sie diese Frage beantworten?
Dreier: Die eine Möglichkeit sind die Lehrpläne. In Österreich gibt es Rahmenlehrpläne, die schultypenspezifisch Themen vorgeben, die behandelt werden sollen. Ins Detail gehen dann die Schulbücher.
DIE FURCHE: Und wer legt deren Inhalt fest?
Dreier: Schulbuchautoren müssen sich am Lehrplan orientieren und füllen die Bücher mit Inhalt. Dann werden die Bücher einem staatlichen Approbationsverfahren unterzogen. Den Lehrpersonen steht wiederum frei, zusätzlich andere Unterrichtsmaterialien einzubringen. Sie können auch ganz ohne approbierte Lehrbücher unterrichten.
DIE FURCHE: Ausgehend vom Lehrplan. Wer entscheidet, was im Unterricht zu behandeln ist oder nicht?
Dreier: Damit machen Sie zwei Fragen auf. Erstens: Welche Rolle haben überhaupt Themen? Und zweitens: Wer schreibt die Lehrpläne?
DIE FURCHE: Welche Rolle spielen die Themen?
Dreier: Ab den 2000er Jahren hat sich etwa im Geschichtsunterricht eine Verschiebung weg von Themen hin zu Kompetenzen ergeben. Jetzt gilt es nicht mehr, eine Liste von Themen durchzuarbeiten, sondern man orientiert sich an Kompetenzen oder auch Konzepten, die die Lernenden im Zuge ihres Ausbildungsweges kennenlernen sollen. Antisemitismus wäre zum Beispiel ein Konzept. Das kommt aus der Geschichtsdidaktik, die sich ab den 1990er Jahren als Wissenschaft etabliert hat und diese Modelle entwickelte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!