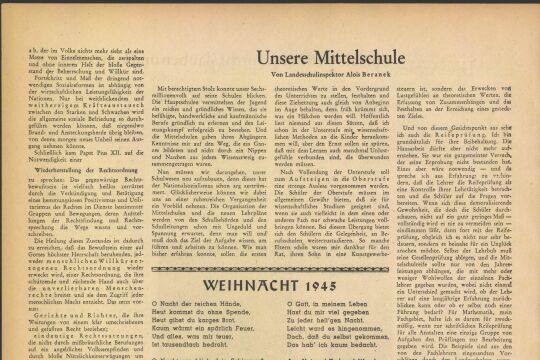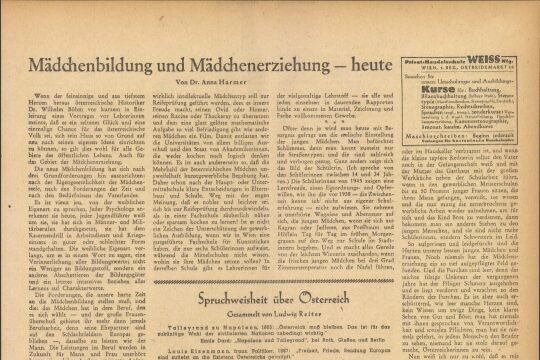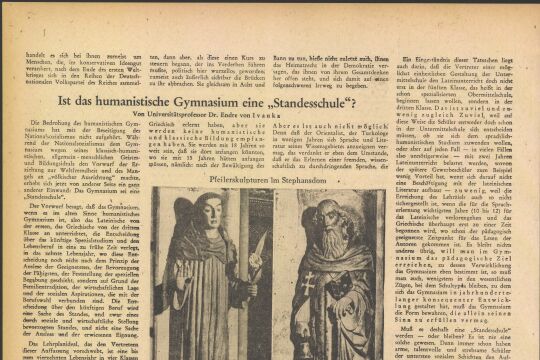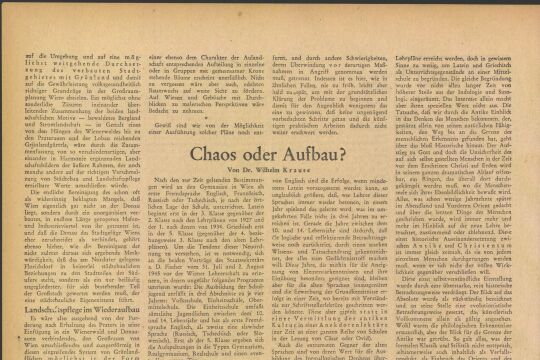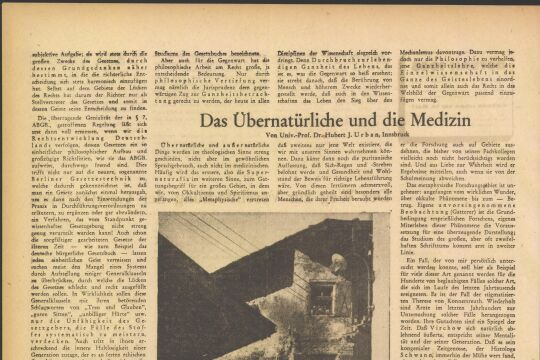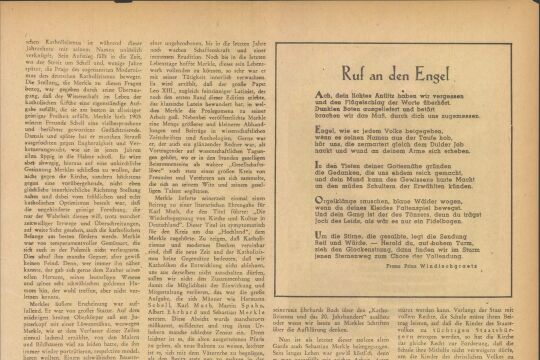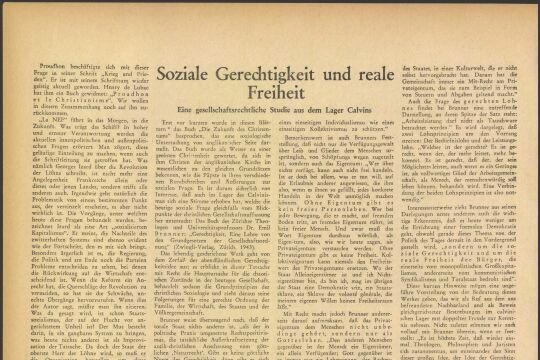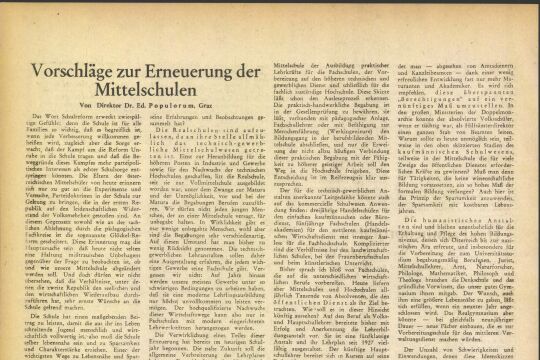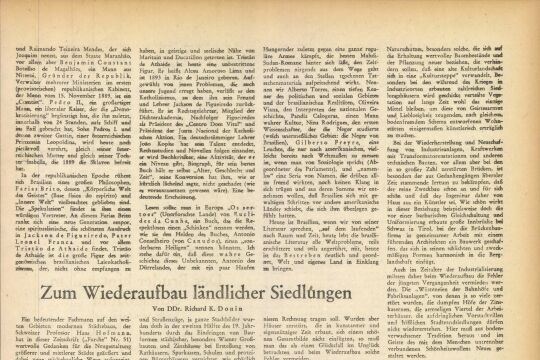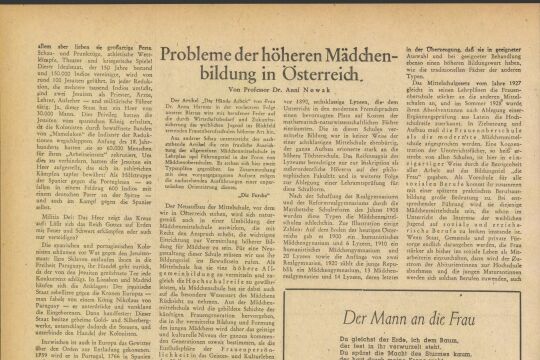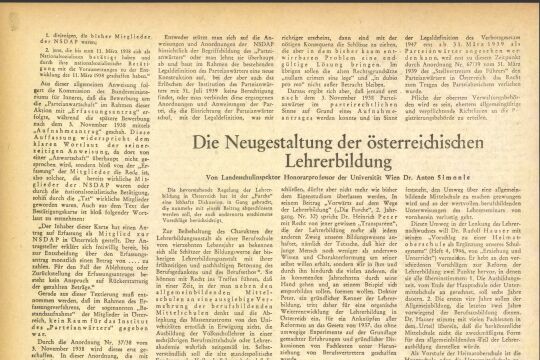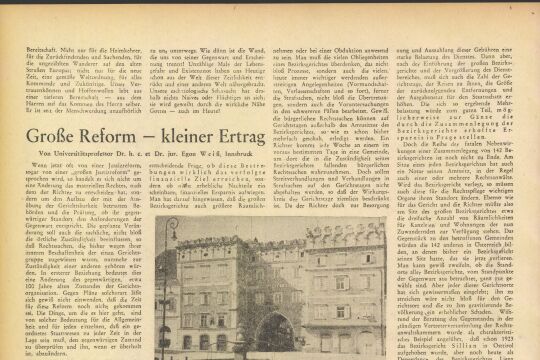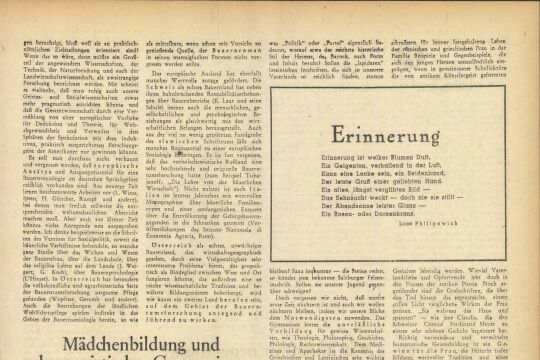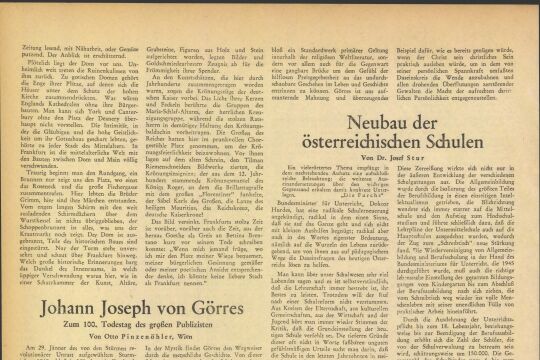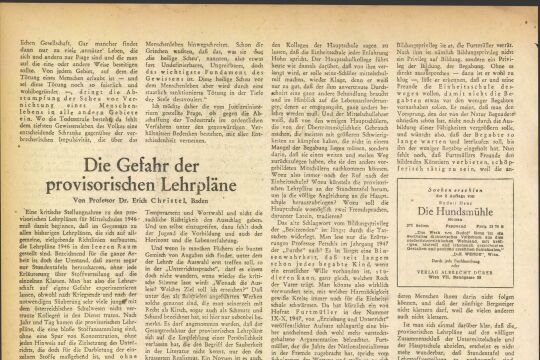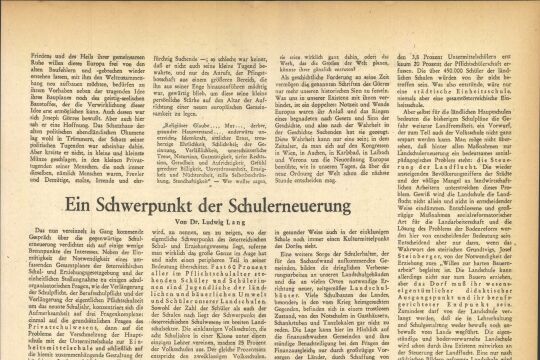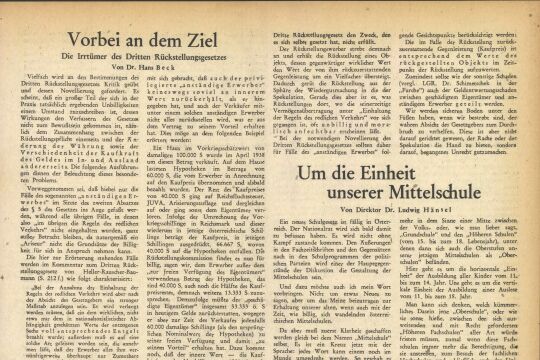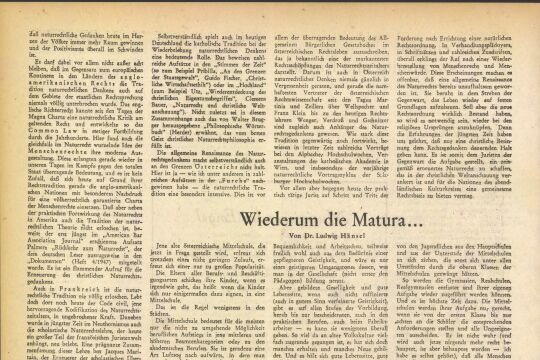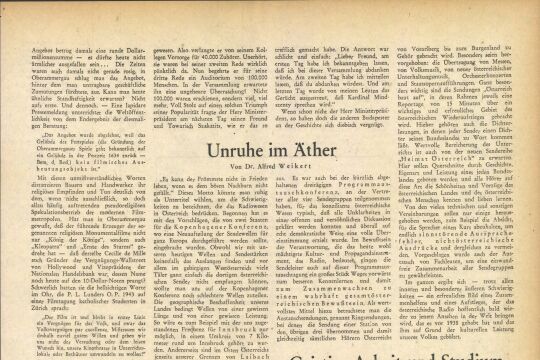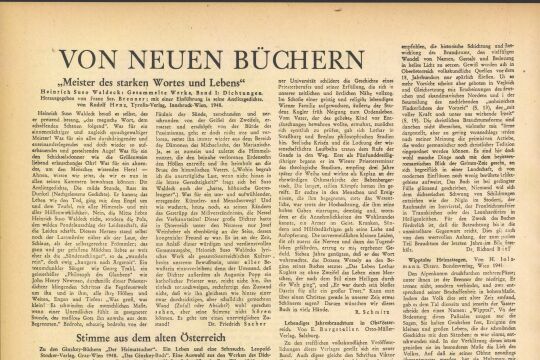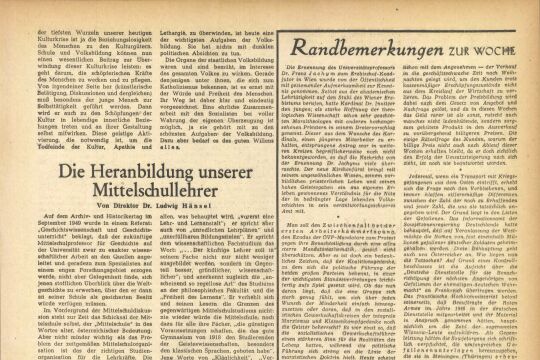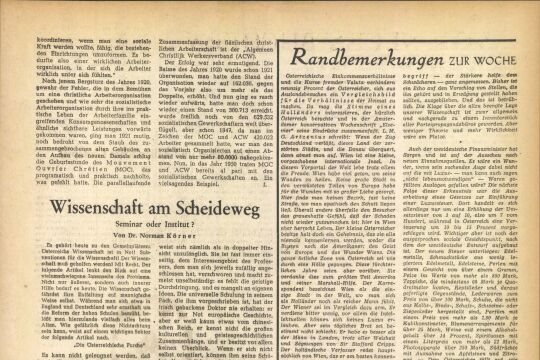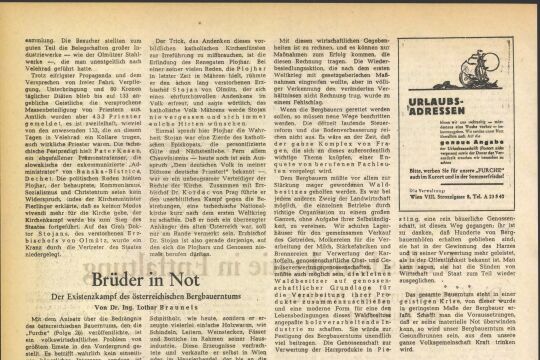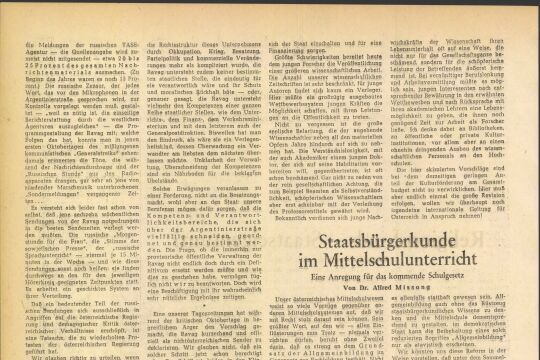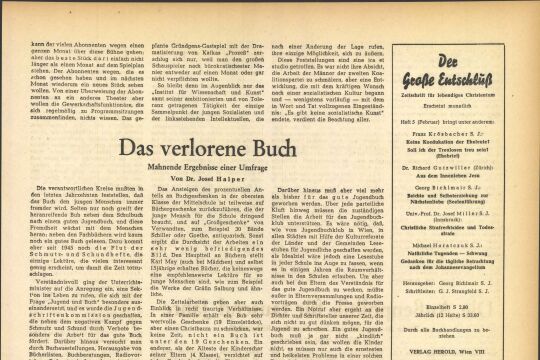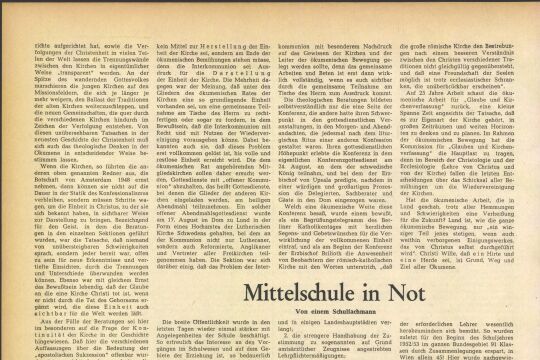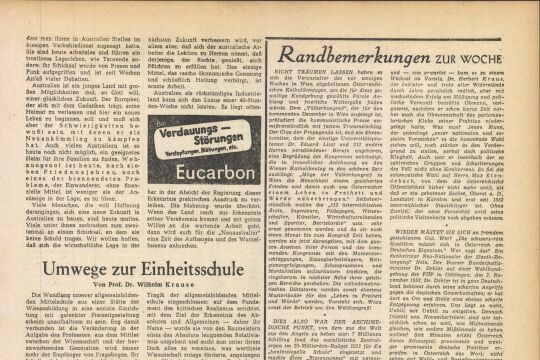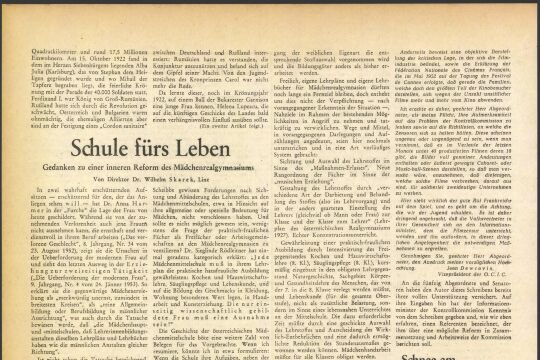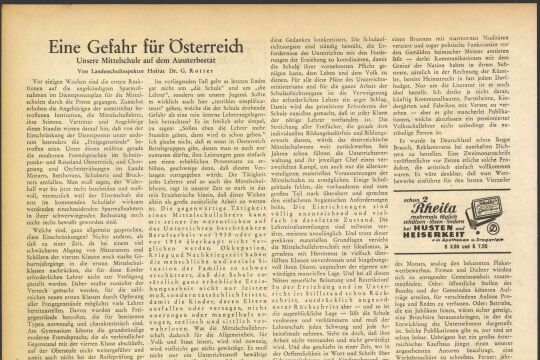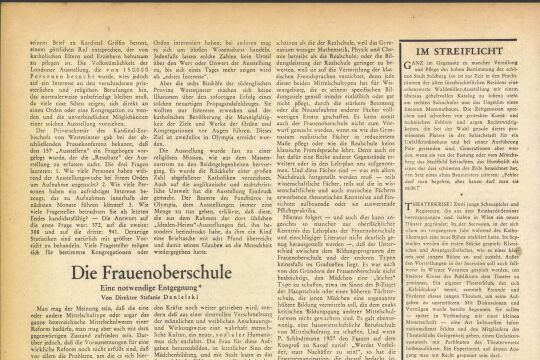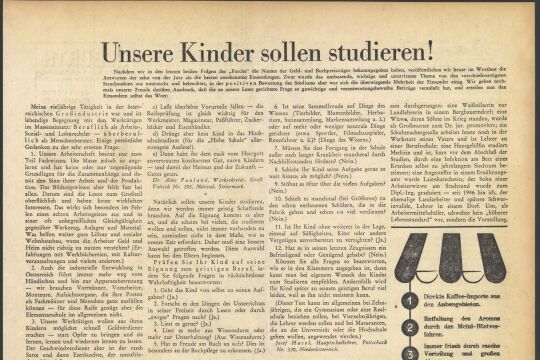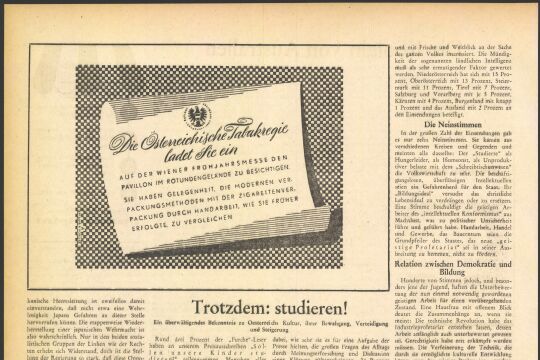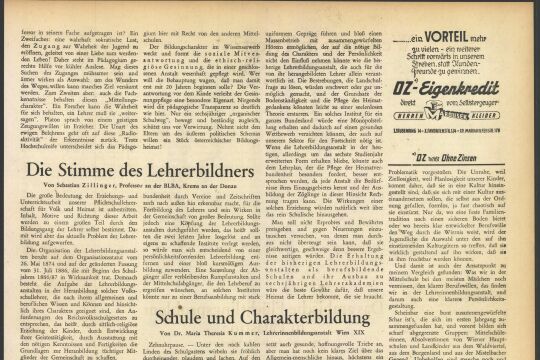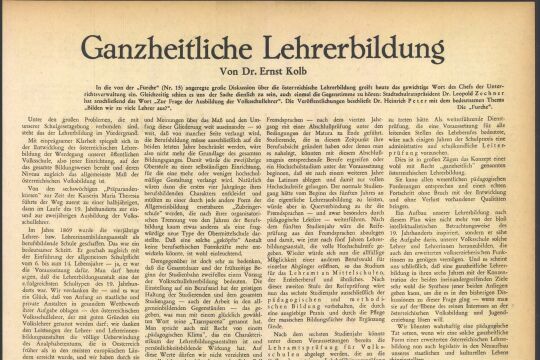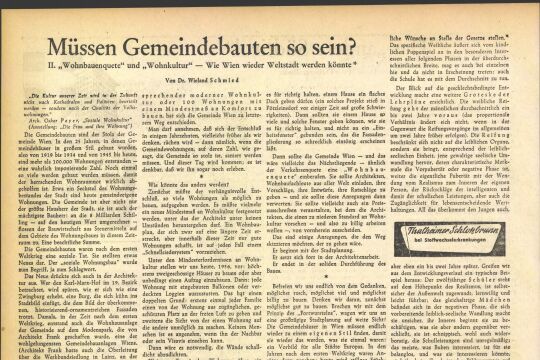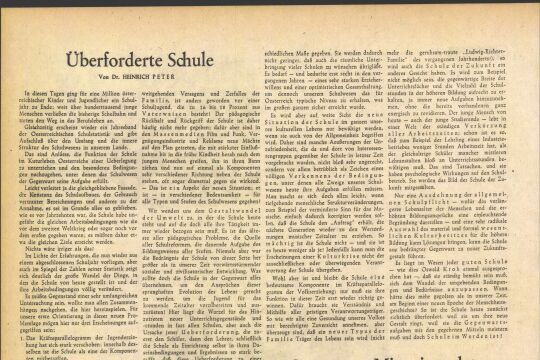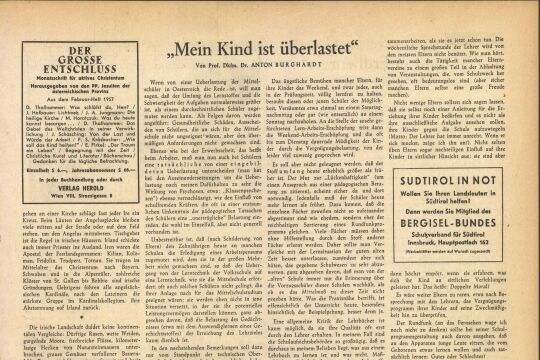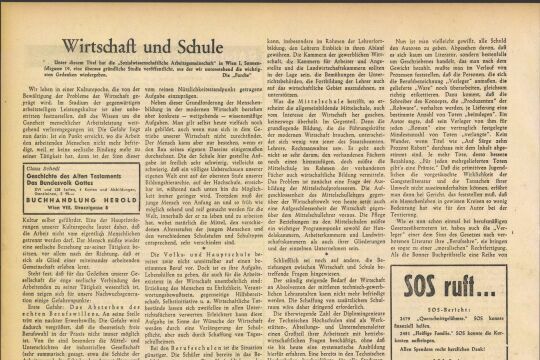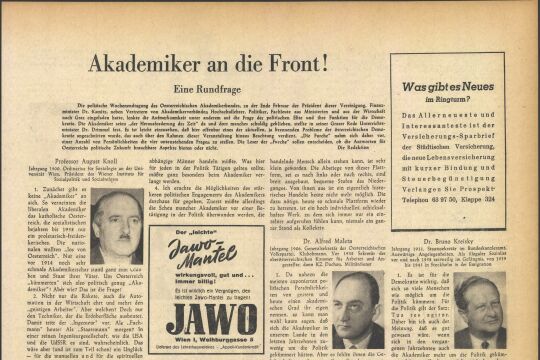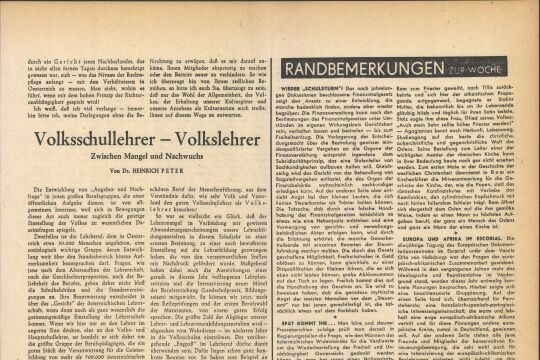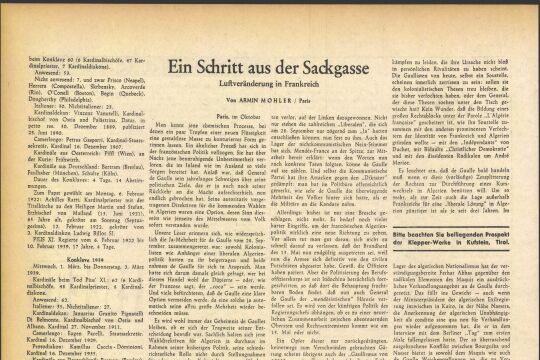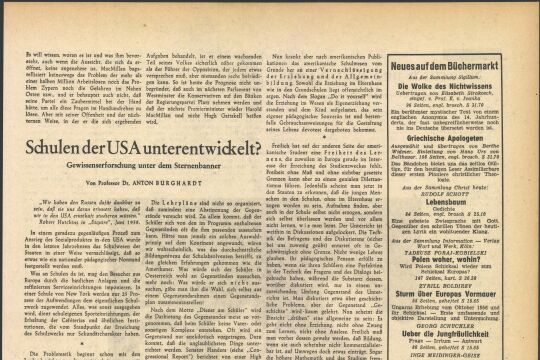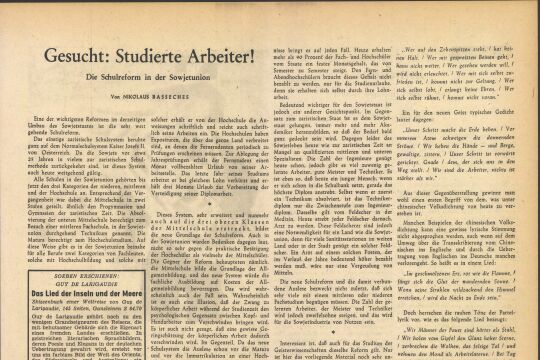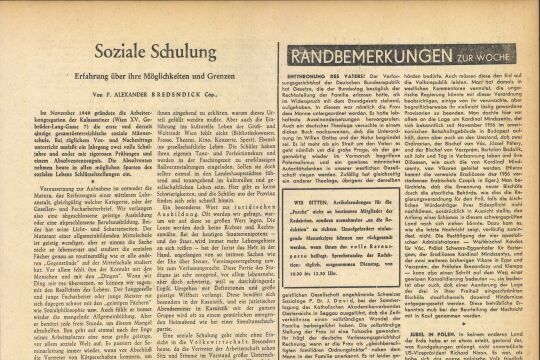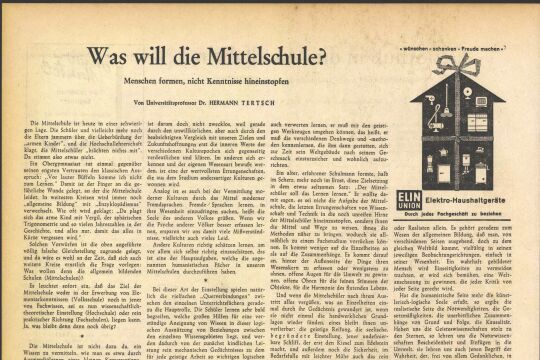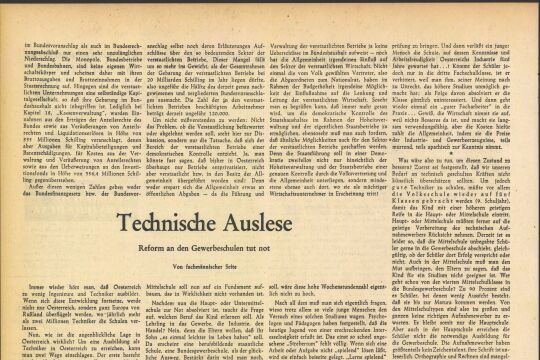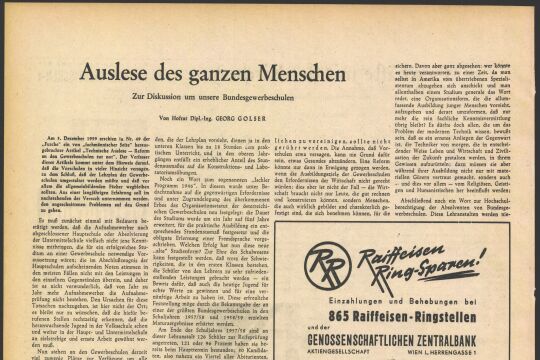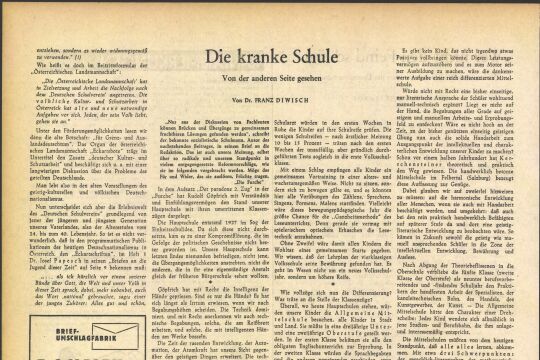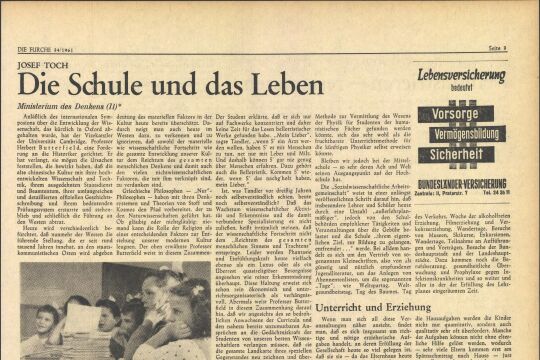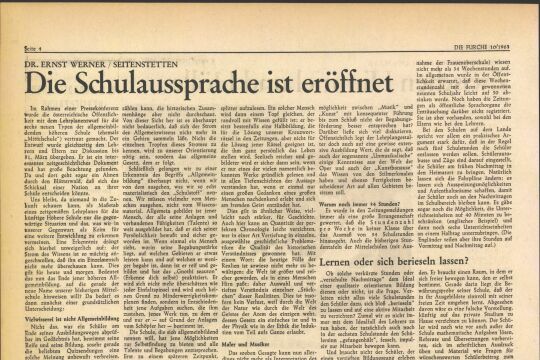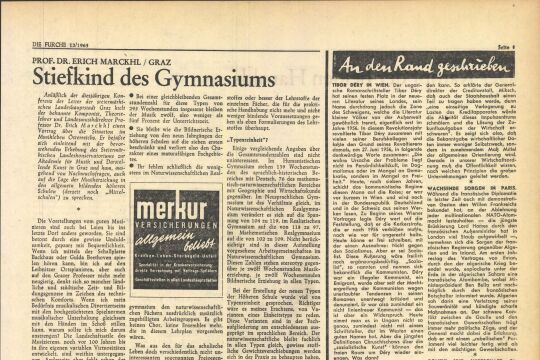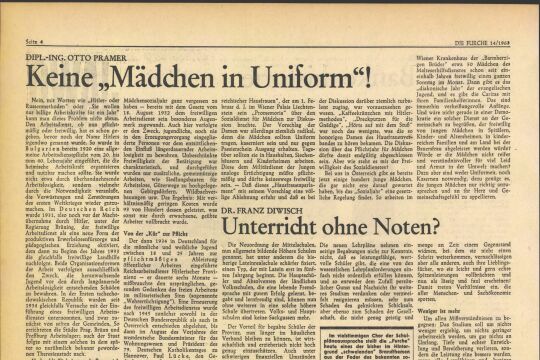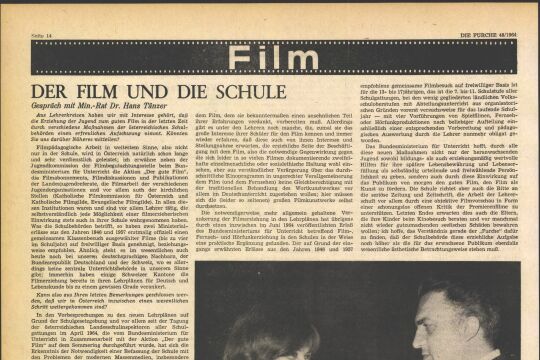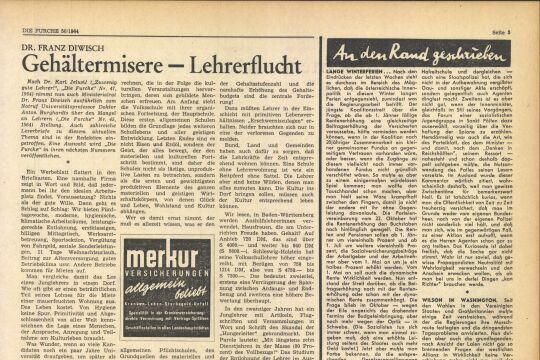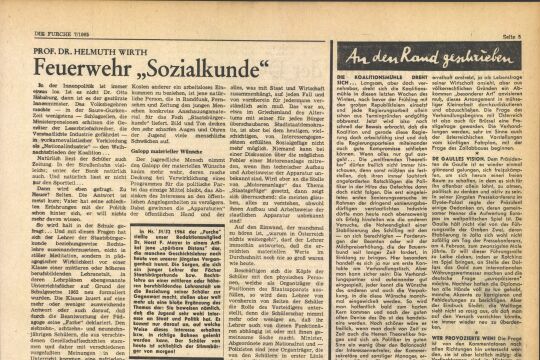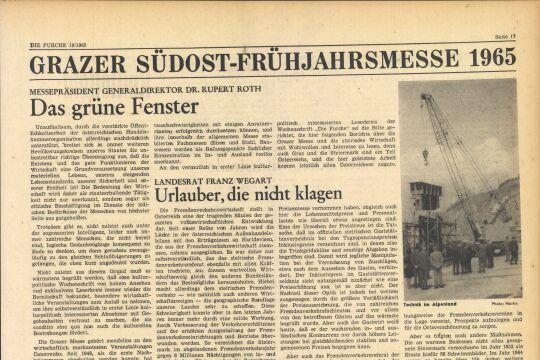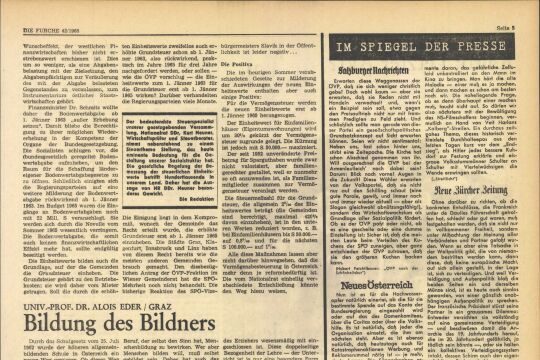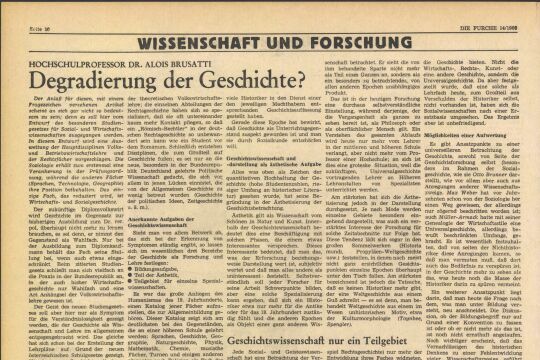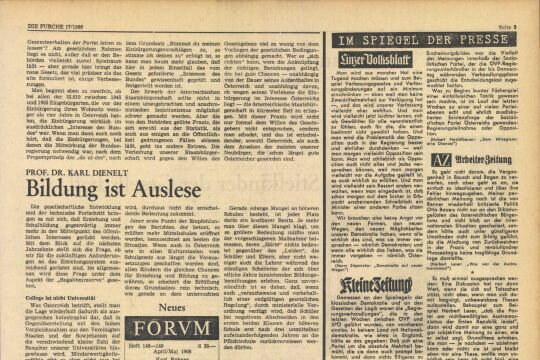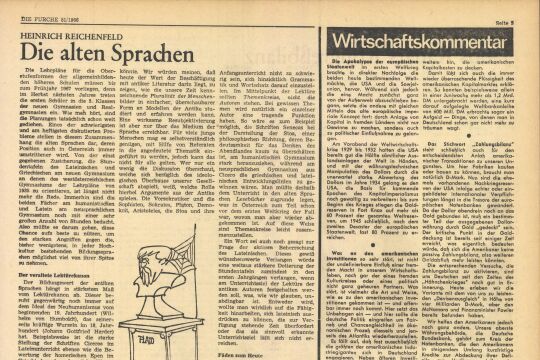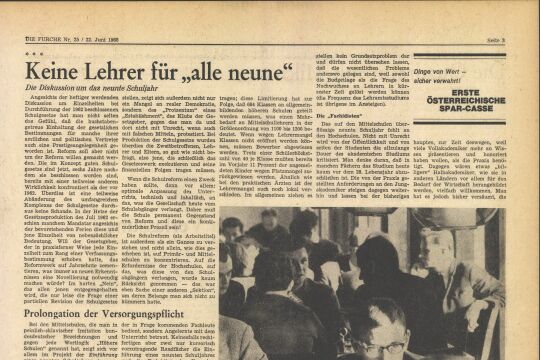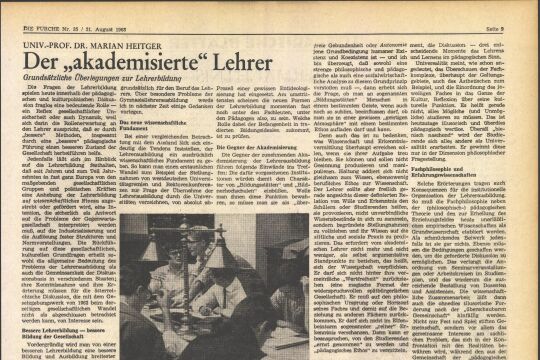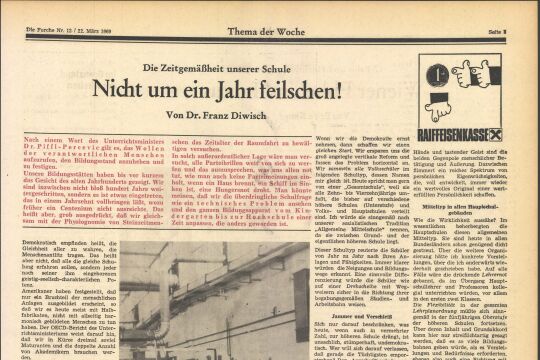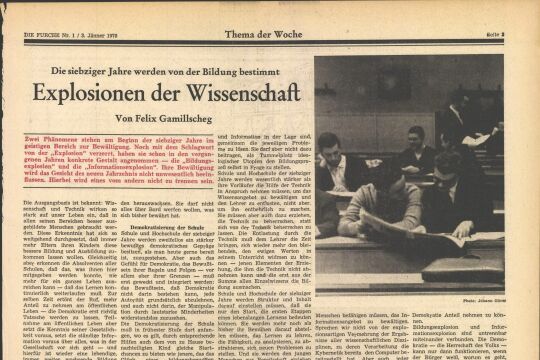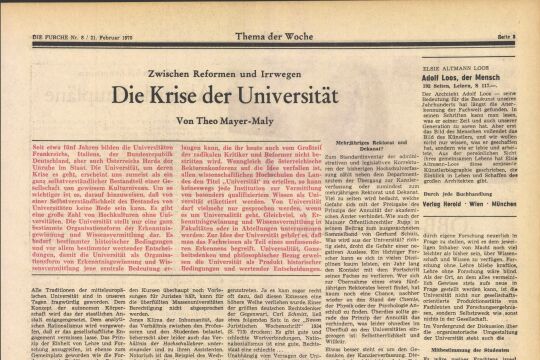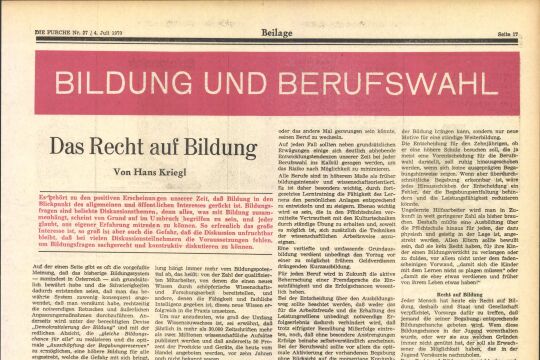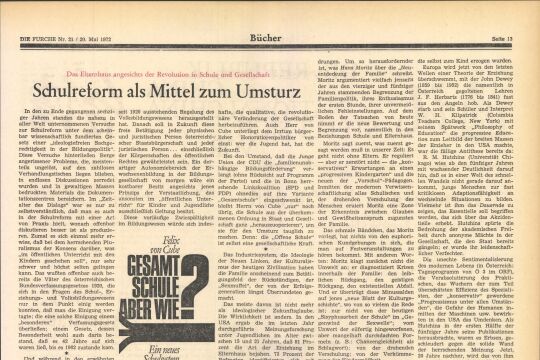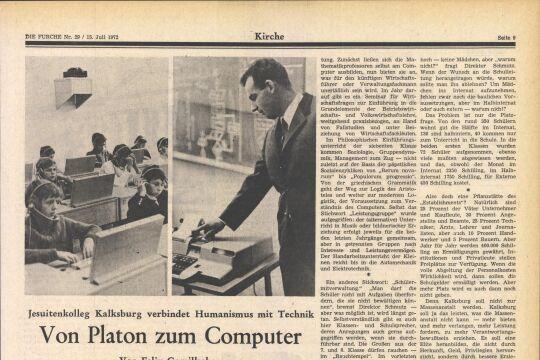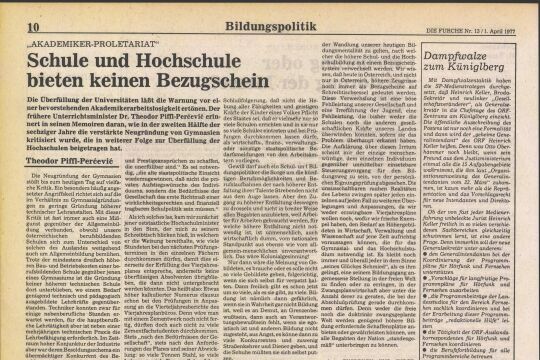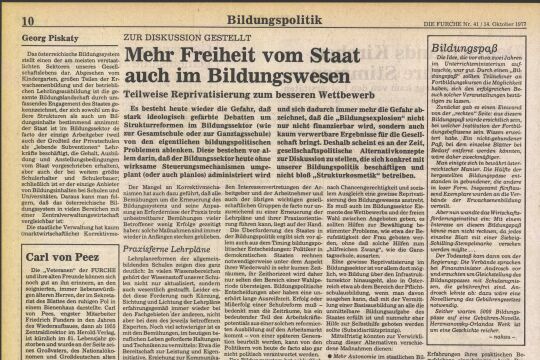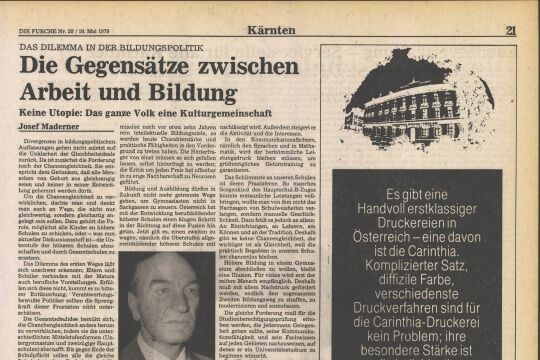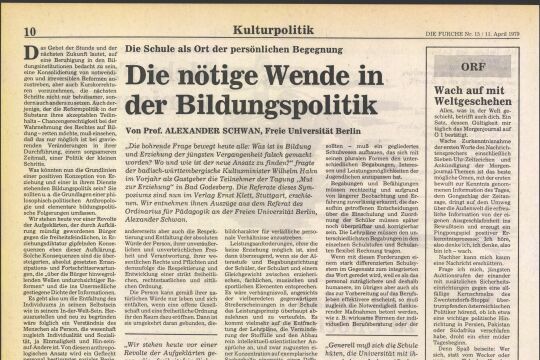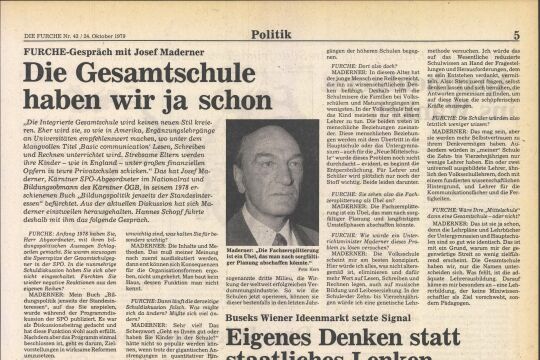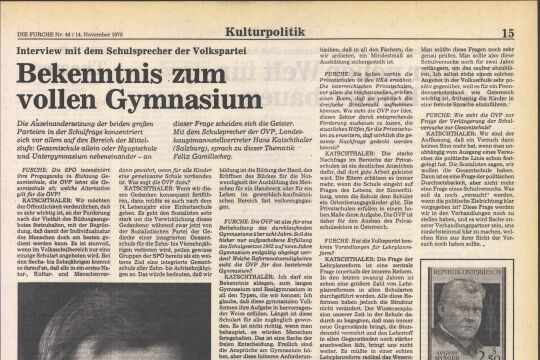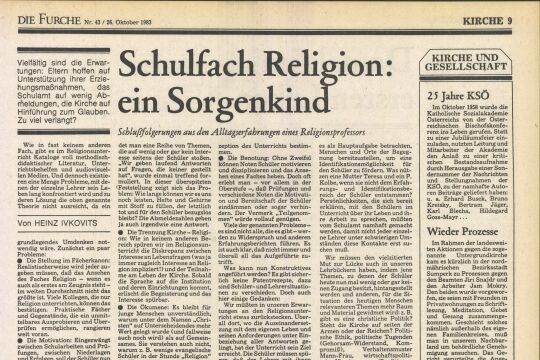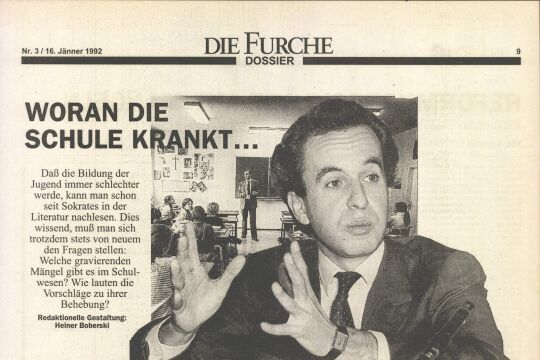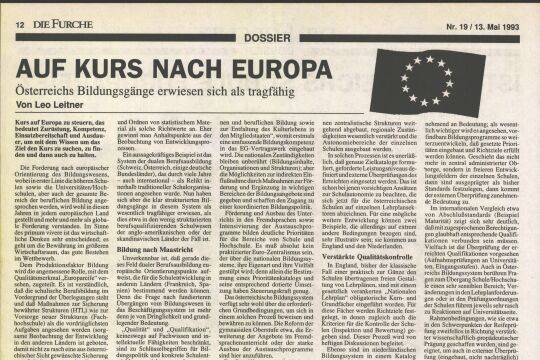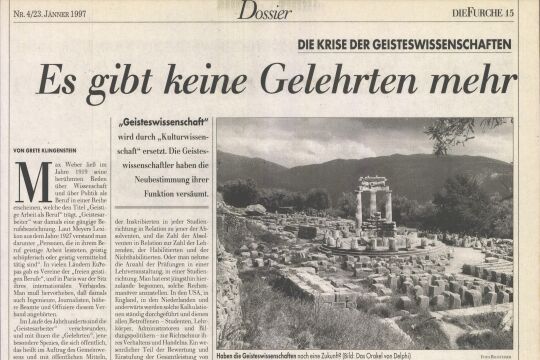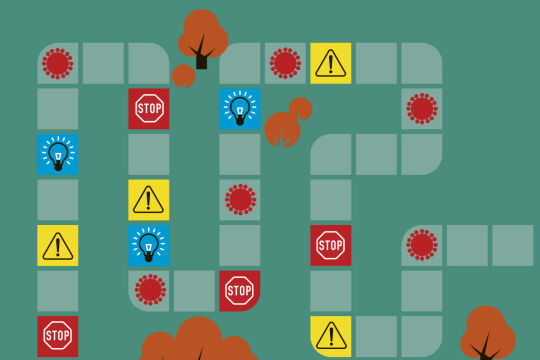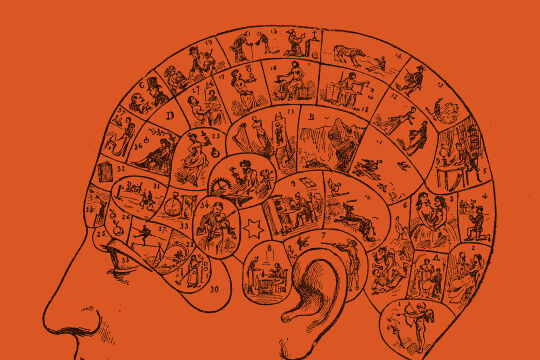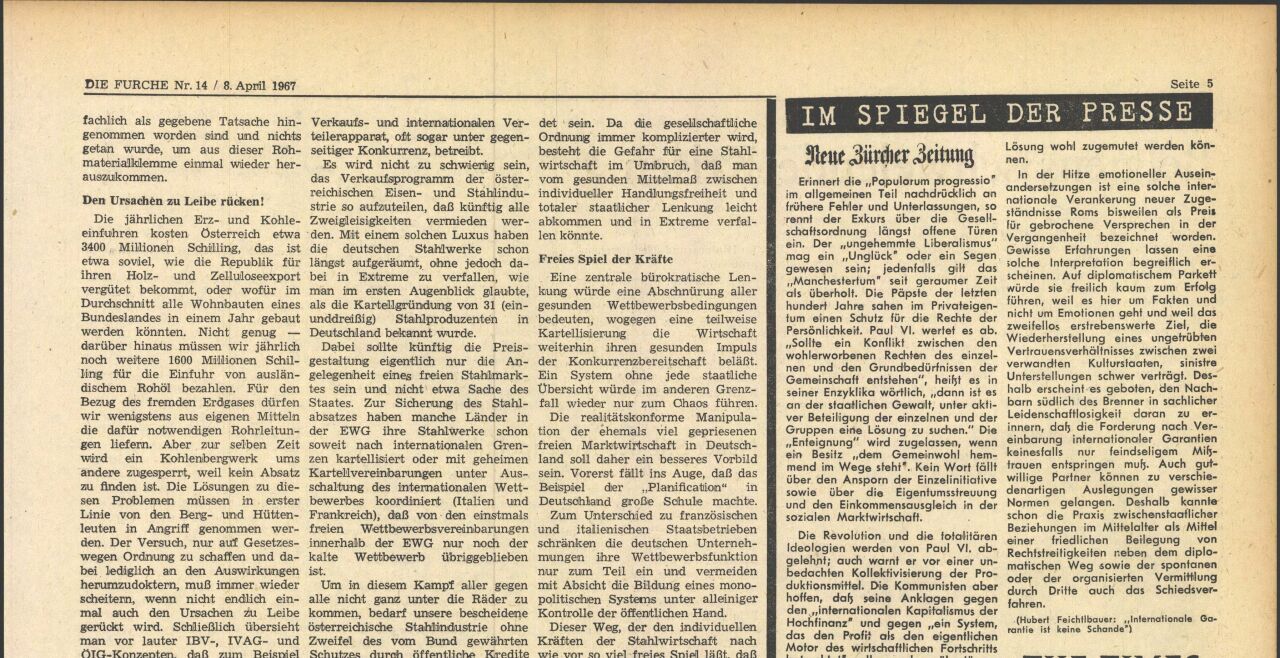
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Strukturprobleme der Schule
Unser ökonomisch orientiertes Zeitalter ist leicht geneigt, Strukturen rein von der mathematischen Seite her zu betrachten. Es nimmt daher nicht wunder, wenn auch in Darstellungen des Bundesministeriums für Unterricht Statistiken und quantitative Vorstellungen eine dominierende Rolle spielen: Produktionssteigerung im jährlichen Ausstoß von Maturanten, Errechnung von Notendurchschnitten der Schülerleistungen, Zahlenvergleiche mit ausländischen Schulsystemen, Rechenexperimente bei Erstellung von Stundentafeln für die Schulfächer und anderes mehr.
Gewiß ist das Studium von Tabellen nicht ganz unnütz; vor allem entlasten Zahlen — daher ihre große Beliebtheit in schwierigen Zeitläuften — persönliche Verantwortung und handhaben sich leichter als Grundfragen der Bildungstheorie. Aber mit Ziffern sollte man nicht an die Gestaltung der allgemeinbildenen Anstalten herantreten; und statt der billigen Berufung auf „moderne pädagogische und psychologische Erkenntnisse und Erfordernisse“ und dem routinemäßigen Liebäugeln mit „jüngsten Entwicklungen in anderen europäischen Schulsystemen“ sollte man sich mehr um das geistige Erbe der Nation und die daraus entspringenden Notwendigkeiten für unsere geistige Zukunft kümmern.
Immer mehr scheint in Vergessenheit zu geraten, daß die höhere Bildung auf einem geistigen Fundament beruht, das in Formziel und Inhalten durch das Kontinuum der kulturellen Entwicklung bestimmt wird. Die Tiefenpsychologie hat uns gelehrt, daß Menschen, in denen das Kontinuum ihrer geistigen Entwicklung gestört ist, schweren psychischen Erkrankungen erliegen. Ähnliches gilt vom Leben der Kultur. Die vielen Entartungserscheinungen kultureller Art, deren Zeugen wir tagtäglich werden, rühren von der Störung des geästigen Kontinuums, vom „Verlust der Mitte“, wie das ein bekannter Kunsthistoriker genannt hat, her.
Die höhere Schule, bis 1962 in Österreich Mittelschule genannt, ist ihrem historischen Ursprung und ihrer überwiegenden Überlieferung nach
Die technische und wirtschaftliche Entwicklung insbesondere der letzten Jahrzehnte hat daneben eine neue Form der höheren Schulbildung geschaffen: Die höhere Fachschule. Daraus ergibt sich das erste Strukturproblem: die saubere Trennung von Fach- und Allgemeinbildung. Mit Recht spricht das Schulorganisa-tionsgesetz von 1962 von dieser Dop-pelheit der höheren Bildung; leider hat man hier nur quantitativ, nicht aber von der Idee her gestaltet. Denn während die höheren Fachschulen ein klar umrässenes, durch die Spezialfächer definiertes Bil-dungs-, besser Ausbildungsprogramm haben, ist die höhere allgemeinbildende Schule nicht nur um ihre bildungstheoretische Grundlage gekommen, sondern zusätzlich weiter belastet geblieben mit überholten Vorstellungen der Fachspezialisierung: an die Stelle der wohlüberlegten, organisch gewachsenen Dop-pelheit von Gymnasium und Realschule, das heißt eines sprachlich fundierten und eines naturwissenschaftlich verankerten Bildungsganzen, sind rein quantitative Fächerkonglomerate getreten, die einerseits als Gymnasium (zum Teil ohne Griechisch) anderseits als Realgymnasium (zum Teil ohne Latein) der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und hier ergibt sich das zweite Sturkturproblem: Bildungsanstalten sind nicht die Summe ihrer Fächer, vielmehr leiten umgekehrt die Schulfächer ihre Existenzberechtigung von den relevanten Bildungsprinzipien her. Diese müssen also in erster Linie definiert werden.
Zweifellos ist die menschlichste der menschlichen Begabungen — woran große Denker wie Cicero und Augustinus als erste geglaubt haben —, die Sprache. Folglich führt der unmittelbare Weg Zur höheren Bildung, wenn man darunter die Menschwerdung des Menschen versteht, über die Sprache, das heißt über das Eindringen in den Bau der Sprache (Grammatik) und über die Auseinandersetzung mit dem sprachlichen Kunstwerk (Literatur).- Berufen wir uns auf das Kontinuum der Kultur, unserer europäischen Kultur, so fällt auf dem sprachlichen Sektor dem Lateinischen und dem Griechischen zweifellos besonderes Gewicht zu. Am Rande .bemerkt: Im Rahmen der rein formalen Bildung ist die ausreichende Pflege der Mathematik ein über jede Diskussion erhabenes Anliegen. Natürlich kann nicht geleugnet werden, daß es auch einen nicht-sprachlächen Weg zu höherer Bildung gibt, nämlich den über die Naturwissenschaften, wenngleich er ein mittelbarer und wahrscheinlich auch komplizierterer ist. Jedenfalls gibt es Kerngebiete der höheren Allgemeinbildung, an die nicht gerührt werden darf. Zu diesen treten, wie das der bedeutende Schultheoretiker L. Hansel genannt hat, Orientierungsgebiete, das heißt Bildungsschwerpunkte, die zusätzlich durch die jeweilige Zeitlage bestimmt sind.
Und hier erwächst das dritte Strukturproblem, nämlich die Frage der Zuordnung dieser Orientierungs-gebiete zum Kerngebiet. Hier muß, will man überhaupt zu echten Bildungserfolgen gelangen, das Prinzip der Wahlfreiheit, allenfalls einer bedingten Wahlfreiheit für die Studierenden der Oberstufe eintreten.
Alle diese Fragen haben offengelassen. Site bieten unter Auflösung des Kerngebietes eine Fülle von „Typen“ an, ohne daß man weiß, in welchem Sinne überhaupt von Typen zu reden ist. Es gibt haufenweise Lateinstunden, ohne daß das Fach in einem Bildungsprogramm verankert wäre; es gibt eine Oberstufenmathematik mit sage und schreibe zwei Stunden pro Woche; es gibt ein musisch-pädagogisches Realgymnasium, das offensichtlich zu dem Zwecke eingeführt wurde, um die Öffentlichkeit oder gewisse Schulerhalter über den Verlust der Lehrerbildungsanstalten hinwegzu-trösten, vielleicht auch hinwegzutäuschen; es gibt vor allem eine Unmenge von Schülern, die ohne geistige Interessen dem wissenschaftlich gerichteten Unterricht der allgemeinbildenden höhemen Schule zuströmen, dort vor allem ein Reifezeugnis, durchaus nicht unbedingt geistige Reife zu erhalten wünschen und, trotz des Widersinns, hierin von den Schulbehörden tatkräftig unterstützt werden.
Strukturproblem, nämlich das des völlig veralteten Berechtägungswesens. Zugegeben: die differenzierte Wirtschaft und die hochentwickelte Technik brauchen große Mengen verläßlicher Spezialisten der mittleren Kategorie. Aber ist unsere Schule der höheren “Allgemeinbildung die geeignete Ausbildungsstätte dazu? Oder sollen wir sie in diesem Sinne umformen — und dabei das geistige Fundament opfern, auf dem immer noch der österreichische Akademiker unbesorgt seine Spezialbildung aufbauen kann? Man sollte hellhörig werden, wenn man erfährt, daß bei der Forumdiskussion der österreichischen Hochschülerschaft am 14. Dezember 1966 in Wien ein Universitätsprofessor aus den Vereinigten Staaten verwundert dem Vertreter des Bundesministeriums für Unterricht zurief: „Und gerade Sie als Österreicher verfechten ökonomische Prinzipien im Aufbau der allgemeinbildenden höheren Schule?“
Wenn wir nämlich fortfahren, in Fragen der Allgemeinbildung ökonomisch zu denken, dann könnte einmal der Zeitpunkt kommen, wo über dem Mangel an geistigen Gütern der Überfluß an materiellem Besitz nicht mehr lohnt, oder, was noch schlimmer wäre, daß bei einem Zusammenbruch der Wirtschaft ein völliges Nichts der Rest wäre.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!