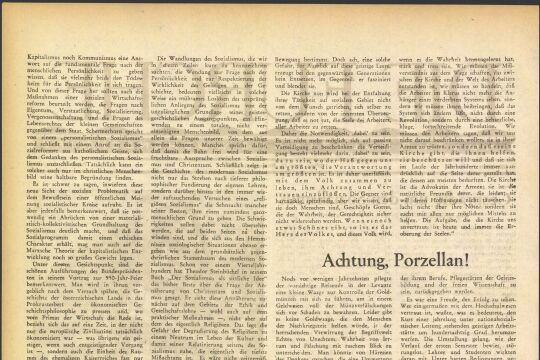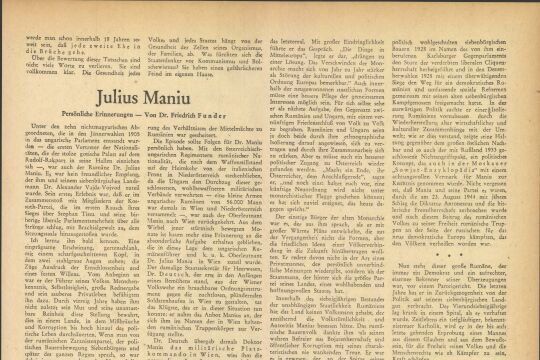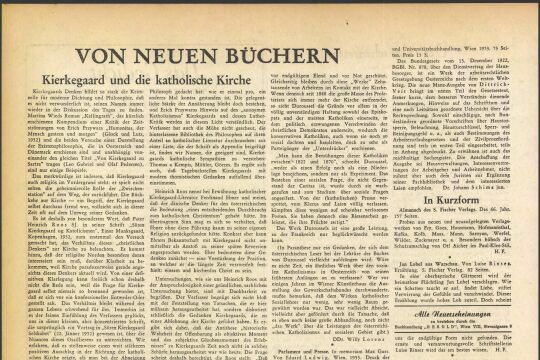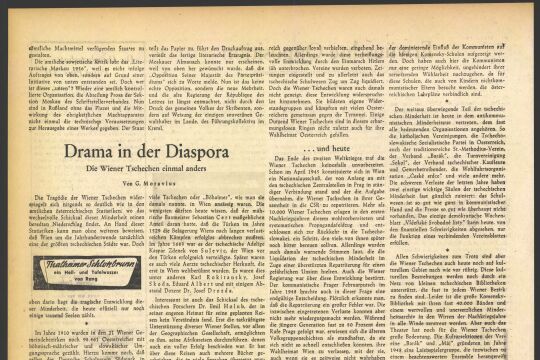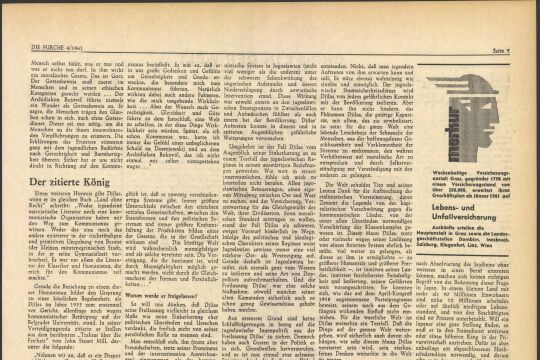So ambitioniert die neue Studentenbewegung für ein besseres Bildungssystem begann, so groß ist die Gefahr, dass sie mangels Unterstützung austrocknet. Analyse eines Verebbens.
Manchmal keimt bei näherer Betrachtung zeitgenössischer Ereignisse der Verdacht, die Geschichte wiederhole sich sehr wohl, oder präziser: sie versuche sich an einer historischen Kopie. Ein solcher Eindruck drängt sich angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage an den Universitäten Österreichs auf. Vor einer Woche beispielsweise lobte der Essayist Robert Misik im stickigen, nach Essen und Rauch stinkenden Auditorium Maximum der Uni Wien in glühenden Worten die Proteste österreichischer Studenten. Niemand, so Misik, hätte erwartet, dass ein angeblich unorganisierter Haufen Studierender binnen weniger Tage eine Organisation auf die Beine stellen könne, die jene der etablierten Parteien weit in den Schatten stelle.
Vor 41 Jahren schrieb der Schriftsteller Cees Nooteboom Reportagen über die Studentenrevolte in Frankreich im Mai 1968. Darin heißt es: „Die Universitätsgebäude schwirren vor Aktivität, beherrscht von einem Minimum an sichtbarer Organisation und einem Maximum an strategischer Intelligenz und Taktik.“ Was würden Österreichs protestierende, twitternde, flickernde, bloggende Studenten wohl darum geben, könnten sie dem Vorbild ’68 folgend auch nur einen Teil ihrer gerechtfertigten Forderungen nach „Bildung statt Ausbildung“, einer Redemokratisierung des Universitätsbetriebes und einer Modernisierung des Bildungssystems in Österreich erreichen.
Die Rahmenbedingungen dafür stünden historisch gesehen gar nicht schlecht, unübersehbar sind die Parallelen: Die Arbeitslosigkeit stieg in Frankreich 1968 erstmals nach dem Krieg wieder auf über zehn Prozent. Gleichzeitig hatten sich die Studentenzahlen an den französischen Universitäten binnen zehn Jahren vervierfacht. Aus überfüllten Hörsälen quollen Perspektivenlosigkeit und Unmut statt satter Bildungszufriedenheit. Ein junger rüpelhafter Student namens Daniel Cohn-Bendit eroberte damals die Tribünen und später die Barrikaden auf den Straßen von Nanterre und Paris mit seinen Brandreden gegen den „Raubtierkapitalismus“ und die Entsolidarisierung der Gesellschaft.
So wie damals suchen die österreichischen Studenten auch heute wieder die Nähe der Gewerkschaften. Am Erscheinungstag dieser FURCHE-Ausgabe wollen sie im Schulterschluss mit den um höhere Löhne kämpfenden Metallern demonstrieren und auch gemeinsam mit den Kindergärtnerinnen die Straßen füllen. Damit allerdings endet der historische Duplikationsvorgang – und eigentlich auch die Hoffnung auf Erfolg.
Die fehlende Idee
Zum einen fehlt der Bewegung eine einende Idee, die die Studenten 1968 über den marxistischen Klassenkampf gewannen, der in seiner extremen Ausführung etwa in Italien zur Gründung der Roten Brigaden führte. Heute gibt es aber weder die mit Marcuse vollgesogenen „freien Menschen“, noch die Schwadronen dreinschlagender Polizisten und radikaler Ordnungshüter auf der Gegenseite. Vielmehr wird der Aufstand von der Politik milde zu Tode gelobt, ohne konkret auf die Forderungen einzugehen. Bürgerliche und rechte Studentengruppierungen wiederum üben sich erfolgreich im divide et impera. Unter den Namen „studieren statt blockieren“ und „Uni verändern“ laufen die Gegenblogs zur Hauptströmung „Die Uni brennt“. Die Forderungen der Uni-Besetzer werden dort als kommunistisch und unkonstruktiv gescholten.
Die Gewerkschaften selbst geben sich zurückhaltend. „Es wird keine landesweite gemeinsame Bewegung geben“, sagt der Chef der Metallergewerkschaft Franz Riepl. Fehlen aber die Gewerkschaften, fehlt auch der Motor, die Studentenproteste mit Geld und dem geballten Apparat eines Sozialpartners zu unterstützen. Jene 100.000 Euro, die die Hochschülerschaft zur Unterstützung des Besetzungskomitees bereitstellt, werden bei aller individueller Begeisterung nicht so lange halten wie der Wille der Regierung, die Proteste mit geringfügigen Zugeständnissen auszusitzen. In diesem Fall würde wohl nichts als ein schaler politischer Nachgeschmack und die schnell verblassende Erinnerung an eine von Robert Misik so bezeichnete „Freiheitsparty“ zurückbleiben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!