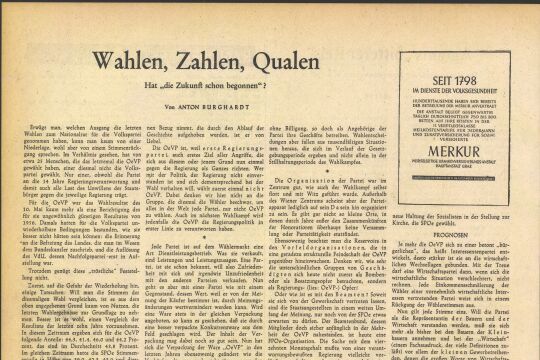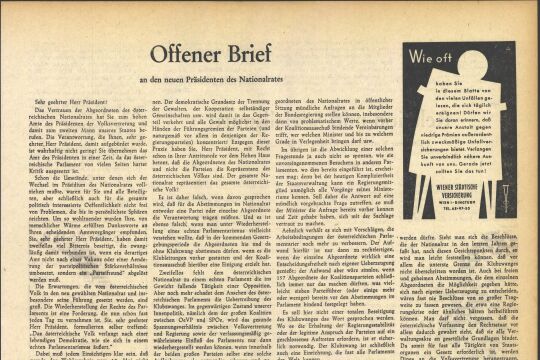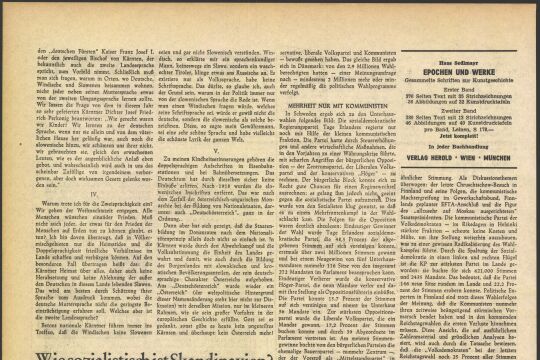Eine sozialistische Initiative zur Reform des Wahlrechtes erregt, trotz Badewetter und Urlaubszeit, gegenwärtig die Gemüter des politisch interessierten Teiles der Öffentlichkeit. Das allerdings mit Recht: denn das parlamentarische Wahlrecht zählt unzweifelhaft zu den Wesensmerkmalen eines demokratischen Staates; dies vor allem auch in dem Sinne, daß man beispielsweise die echte Demokratie von der Volksdemokratie oder einer „gelenkten“ Demokratie schon allein an den Möglichkeiten der Kandidatenaufstellung, der Wahlwerbung und der freien und geheimen Stimmabgabe unterscheiden kann.
Aber selbst innerhalb der westlichen Demokratie ist das Wahlrecht ein ernstes Problem, und zwischen zwei Gundsätzen — dem der Mehrheitswahl und dem der Verhältniswahl — wird ein Meinungsstreit mit bisher unentschiedenem Ausgang geführt. Unbestritten ist lediglich, daß sowohl das Mehrheitswahlsystem als auch das Verhältniswahlsystem Vorzüge wie Nachteile aufweisen und daß es daher mehr auf die jeweilige politische Situation ankommt, welchem System der Vorzug zu geben ist.
Das Mehrheits Wahlsystem beruht auf dem lapidaren Grundsatz, daß die Mehrheit entscheidet, also gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Genaugenommen müßte man freilich von Mehrheitswahlsystemen sprechen, da es dfe relative Mehrheitswahl und die absolute Mehrheitswahl gibt. Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Wenn A, B und C zur Wahl stehen und A 45, B 3 5 und C 20 Stimmen erhält, ist nach dem Grundsatz der relativen Mehrheit A mit 45 Stimmen gewählt, da er relativ — das heißt im Verhältnis zu den anderen Kandidaten — die meisten Stimmen auf sich vereinen konnte; hingegen gilt nach dem Grundsatz der absoluten Mehrheit nur derjenige als gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.
Würde man den Grundsatz der relativen Mehrheit auf die Wahl einer Volksvertretung anwenden, so bestünde die Gefahr, daß eine Partei, die in allen Wahlkreisen beispielsweise 45 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen konnte, 100 Prozent der zu vergebenden Mandate erhielte — und zwar dann, wenn die restlichen 5 5 Prozent der Stimmen sich auf mehrere andere Parteien in der Weise verteilten, daß keine einzige von ihnen mehr als 44 Prozent erhalten hätte. Obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr dagegen spricht, daß es jemals zu einer derartigen Stimmenverteilung kommen könnte, wird doch in den meisten Ländern der Grundsatz der absoluten Mehrheit angewendet; bei diesem System sind dann allerdings zwei Wahlgänge erforderlich.
Das Verhältniswahlsystem hat das Ziel, eine Volksvertretung zu schaffen, innerhalb der die Parteien, wie schon der Name sagt, verhältnismäßig in derselben Stärke vertreten sind, wie abgegebene gültige Stimmen auf sie entfielen. Eine Partei, die beispielsweise 40 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinte, soll nach diesen Grundsätzen auch 40 Prozent der Abgeordneten stellen usw. Allerdings wird in der Praxis dieses System ebensowenig in seiner reinsten Form angewendet, wie etwa das Mehrheitswahlsystem in der Form der relativen Mehrheit. In allen Ländern, in denen das Verhältniswahlsystem Anwendung findet, werden zur Vermeidung einer allzu großen parteipolitischen Zersplitterung Vorkehrungen getroffen, die geeignet sind, kleine Parteien zu benachteiligen und größere Parteien unter Umständen zu bevorzugen. Dies geschieht etwa dadurch, daß ein gewisser Mindestprozentsatz abgegebener gültiger Stimmen gefordert wird, damit eine Partei überhaupt Mandatare stellen kann. In unserer Nationalratswahlordnung ist das System etwas komplizierter, führt aber zum gleichen Ergebnis.
Die wohl schärfste Kritik des Verhältniswahlsystems hat F. A. He r-m e n s in seinem Buch „Demokratie oder Anarchie“ folgendermaßen geäußert: „Die Mannigfaltigkeit der Interessen und Meinungen, die in jeder Nation zu jedem Zeitpunkt ihrer Geschichte bestehen, ist in der Tat nicht abzusehen. Wenn wir die Funktion eines Parlaments einzig und allein darin erblicken, alle diese Differenzierungen ,in verkleinertem Maßstab' wiederzugeben, so vergessen wir, daß die Hauptaufgabe in einer Demokratie, wie; in anderen Regierungsformen, darin besteht, ,e pluribus unum', das heißt aus Uneinheitlichkeit Einigkeit zu schaffen ... Das wahre Problem liegt nicht darin, die Interessen richtig zu vertreten, .sondern vor allem darin, eine Autorität zu finden, welche das Schiedsrichteramt ausüben kann. Mit anderen Worten: die Vertretung der Interessen bleibt eine verlockende Illusion, wenn es nicht darüber hinaus eine unabhängige Macht gibt, die für Voraussicht und Gerechtigkeit sorgen kann...“
Hingegen führen die Anhänger des Mehrheitswahlsystems folgende Vorteile ins Treffen: Bei diesem System entscheide sich der Wähler in erster Linie für die Person, während die Partei eine untergeordnete Rolle spielt; beim Verhältniswahlsystem müsse sich der Wähler für die Partei entscheiden, während er auf die Auswahl der Kandidaten für das Parlament kaum einen Einfluß auszuüben vermag. Dadurch nehmen aber die Parteien einen starren Charakter an; sie propagieren politische Programme und werden fast zu Weltanschauungsgemeinschaften, was naturgemäß die politische Auseinandersetzung ungeheuer erschwert. Die
Anhänger des Mehrheitswahlsystems sehen ferner einen Vorteil darin, daß bei dieser Wahlart die personelle Zusammensetzung der Volksvertretung dauernd in Fluß bleibt; eine kleine Veränderung des Wahlergebnisses kann beträchtliche Verschiebungen bei der Verteilung der Sitze im Parlament verursachen, während beim Verhältniswahlsystem nur ein politischer Erdrutsch größere Veränderungen in der Zusammensetzung der Volksvertretung zur Folge haben kann, da ja die Spitzenkandidaten aller Parteien immer wieder zum Zuge kommen.
Ein weiterer Vorteil wird von den Anhängern des Mehrheitswahlsystems darin gesehen, daß ein Abgeordneter, der die absolute Mehrheit in einem Wahlkreis erlangen möchte, die Ansprüche der verschiedensten Interessengruppen unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls betrachten muß, da meistens die Angehörigen einer bestimmten Interessengruppe in keinem Wahlkreis eine Mehrheit bilden. Ferner muß der einzelne Abgeordnete beim Mehrheitswahlsystem einen engeren Kontakt mit der Wählerschaft aufrechterhalten. Wenn hingegen der kleine Einmannwahlkreis verschwindet und das Verhältniswahlsystem angewendet wird, so bedeutet dies auch, daß die Parteileitung nicht mehr auf einer so volkstümlichen Grundlage aufgebaut sein muß. Durch das Recht, die Kandidatenliste aufzustellen, werden beim Verhältniswahlsystem die Parteiführer zu einer Art Diktatoren, denen die Abgeordneten zu gehorchen haben.
An allen diesen grundsätzlichen Fragen des parlamentarischen Wahlrechtes geht die sozialistische Initiative zur Änderung der Nationalratswahlordnung allerdings vorüber. Ihre Absicht besteht — wenn man es kurz ausdrücken will — lediglich darin, eine größere „Gerechtigkeit“ in unser Verhältniswahlsystem zu bringen. Zum besseren Verständnis muß man sich also zunächst vor Augen halten, worin denn die „Ungerechtigkeit“ unseres geltenden Wahlrechtes bestehen soll:
Das Verfahren bei Nationalratswahlen ist derzeit so gestaltet, daß beispielsweise nach der Nationalratswahl 1959 — die amtliche Statistik der Wahl 1962 liegt noch nicht vor und kann daher nicht als Beispiel herangezogen werden — die ÖVP mit einem Stimmenanteil von nur 44,2 Prozent einen Anteil von 47,9 Prozent aller Abgeordneten des Nationalrates, die SPÖ mit einem Stimmenanteil von 44,8 Prozent nur einen Anteil von 47,3 Prozent aller Abgeordneten und die FPÖ mit 7,7 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen gar nur 4,8 Prozent aller Mandatare stellte. Für diesen Umstand sind verschiedene Faktoren maßgeblich: Ins Gewicht fallend ist vor allem die Tatsache, daß die 165 Nationalratsmandate auf die 25 Wahlkreise entsprechend der Bürgerzahl und nicht nach der Zahl der Wahlberechtigten aufgeteilt werden; es entfallen also in den einzelnen Wahlkreisen auf jedes zu vergebende Mandat verschieden viele Wahlberechtigte, ud zwar schneiden Wahlkreise mit einer gegenüber der Zahl der Wahlberechtigten verhältismäßig großen Bürgerzahl besser ab als andere; das ist also in kinderreichen Gegenden der Fall, weil die Zahl der Kinder in der Bürgerzahl inbegriffen ist, nicht aber in der Zahl der Wahlberechtigten.
Beispielsweise gab es bei der Wahl im Mai 1959 einen Wahlkreis, in dem auf ein zu vergebendes Mandat 24.219
Wahlberechtigte entfielen und einen anderen, in dem auf ein zu vergebendes Mandat 33.590 Wahlberechtigte kamen, also um rund 29 Prozent mehr. Da außerdem die Wahlzahl für jeden einzelnen Wahlkreis gesondert errechnet wird, kostete bei der Wahl des Jahres 1959 ein Nationalratsmandat im ersten Ermittlungsverfahren mindestens rund 20.000 Stimmen, in manchen Wahlkreisen aber bis zu fast 27.000 Stimmen. Im zweiten Ermittlungsverfahren waren zwischen 35.000 und rund 45.000 Stimmen zur Erlangung eines Restmandates erforderlich.
Die Einteilung des Bundesgebietes in Wahlkreise ist ebenso wie die Verteilung der Mandate auf die einzelnen Wahlkreise gemäß der Bürgerzahl in der Bundesverfassung verankert. Daran kann gegen den Willen der ÖVP nicht gerüttelt werden. Die sozialistische Initiative ist aber darauf abgestellt, unter Umständen nur mit Unterstützung der freiheitlichen Abgeordneten Gesetzeskraft erlangen zu können. Daher beschränken sich die Abänderungsvorschläge auf:
• die Bildung von nur neun Wahlkreisen entsprechend den Bundesländern;
• die Bildung von nur zwei Wahlkreisverbänden;
• die Ersetzung des Erfordernisses des sogenannten Grundmandates durch eine Fünf-Prozent-Klausel;
• schließlich die Hinaufsetzung der Abgeordnetenzahl des Nationalrates von bisher 165 auf 180.
Bleibt die Frage, was damit bezweckt wird. Die den sozialistischen Vorschlägen von mancher Seite unterschobene Wahlarithmetik wird jedenfalls nicht erreicht und ist — zumindest in der Schärfe mancher Verdächtigungen — wohl auch gar nicht angestrebt worden; nach Berechnung von Fachleuten würde sich bei Verwirklichung der sozialistischen Änderungswünsche der gegenwärtige Nationalrat aus 86 ÖVP-Abgeordneten (jetzt 81),
80 SPÖ-Abgeordneten (jetzt 76) und 14 FPÖ-Abgeordneten (jetzt 8) zusammensetzen. Der Abstand zwischen ÖVP und SPÖ würde also nicht geringer; Nutznießer wären im Grunde die Freiheitlichen, während man den Kommunisten mit der Fünf-Prozent-Klausel weiterhin den Eintritt in das Parlament zu verwehren hofft.
Das praktische Ergebnis der vorgeschlagenen Wahlreform bestünde einzig darin, daß eine kleine Koalition eine bessere parlamentarische Basis fände. Gegenwärtig könnte die SPÖ mit der FPÖ nur die knappe Mehrheit von 84 Abgeordneten gegenüber
81 der ÖVP bilden; das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, daß bisweilen der von der SPÖ gestellte Zweite Präsident den Vorsitz führen muß und daher an Abstimmungen nicht teilnehmen kann; in diesem Falle würde schon die Abwesenheit von zwei weiteren Abgeordneten der kleinen Koalition die Mehrheit zunichte machen. Da schließlich immer ganze Abgeordnete und nicht nur Bruchteile von solchen fehlen, ist wahrscheinlich die Hinaufsetzung der Mandatszahl eines der Hauptanliegen der sozialistischen Wahlreforminitiative.
Hierfür soll die Bevölkerung einen Mehraufwand von mehr als zwei Millionen Schilling jährlich auf sich nehmen. Nicht unerwähnt darf ferner in diesem Zusammenhang die Tatsache bleiben, daß in der letzten Gesetzgebungsperiode acht Abgeordnete überhaupt nicht und zwölf Abgeordnete nur einmal das Wort ergriffen! Das sind rund zwölf Prozent der derzeitigen Abgeordnetenzahl, und es wäre vielleicht klüger, erst einmal diese Arbeitskraftreserve besser auszuschöpfen, als eine Erhöhung der Mandatszahl um rund zehn Prozent zu propagieren.
So zumindest stellt sich das Problem in den Augen unverbesserlicher Anhänger der großen Koalition dar.