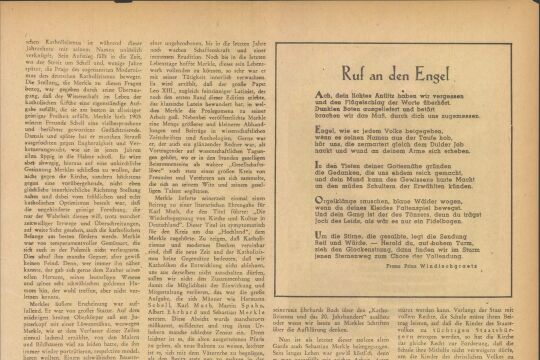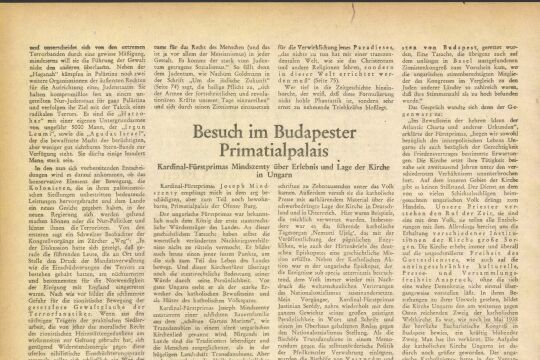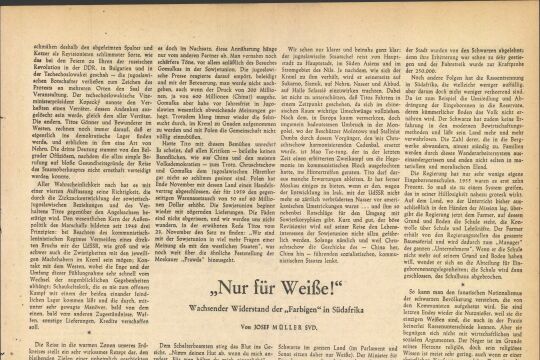Bestimmungen über das niedersächsische Schulwesen, die, wenngleich nicht in dem von Nuntius Bafile angestrebten Ausmaß, die staatliche Gemeinschaftsschule sanft, aber unverkennbar zugunsten der katholischen Bekenntnisschule zurückdrängten; selbst eine Novellierung des niedersächsischen Schulgesetzes von 1954 wurde deshalb in Aussicht genommen. (Sie sollte darin bestehen, die Bestimmungen über die staatlichen Schulen etwas verwaschener auszudrücken und damit dem Konkordat freie Bahn zu schaffen.) Waren die Konkordatsverhandlungen zunächst hinter nicht allzuweit geöffneten Türen geführt worden, so brodelte es bald nach Bekanntwerden des Ergebnisses von der Nordsee bis zum Harz, von der Elbe bis zur Weser. Die gegen 20.000 Mitglieder des Gesamtverbandes niedersächsischer Lehrer — der dem Deutschen Gewerkschaftsbund angehört! — stiegen auf die Barrikaden; die Protestanten, die schon 1955 im Loccumer Vertrag ihr Verhältnis mit der Regierung geregelt hatten, fühlten sich benachteiligt, obwohl bereits mit den evangelischen Landeskirchen ein Zusatzabkommen ausgearbeitet wurde, und warnten, von Landesbischof Lüje abwärts, vor der verstärkten politischen Aktivität der Katholiken. Der Lehrkörper der Pädagogischen Hochschule Osnabrück, der von dem Konkordat direkt betroffen war, protestierte. Im gesamten deutschen Blätterwald hallte es von Kulturkampfgeschrei. Während sich die CDU vorsichtig zurückhält, segelt die SPD unter Führung von Ministerpräsident Diederichs volle Kraft voraus, der Ratifizierung entgegen.
Für und wider die katholische Schule
In einem vorwiegend katholischen Land wie Österreich ist es leicht, ob solcher Aufregung den Kopf zu schütteln. Deutschland hat nie ein Reichsschulgesetz zustande gebracht. Bis 1920 waren die öffentlichen Volksschulen fast durchweg katholisch oder evangelisch; selbst das höhere Schulwesen war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts konfessionell aufgespalten. Eine Zwangseinigung erfolgte unter dem Nationalsozialismus. Somit ist die Simultan - oder Gemeinschaftsschule neben allen grundsätzlichen Bedenken noch mit dem geschichtlichen Odium einer liquidierten Diktatur belastet.
Gründe werden für und gegen die konfessionelle Schule vorgebracht. Dafür: nur sie garantiere eine weltanschaulich fundierte, katholische beziehungsweise protestantische Erziehung der Kinder (wobei sich die Protestanten noch eher mit der Gemeinschaftsschule befreunden); nur sie gewährleiste das im Grundgesetz festgelegte, allerdings nicht expressis verbis auf die Schule bezogene Elternrecht. Gegen die Bekenntnisschulen wird die administrative Kompliziertheit der Doppel- oder Dreigeleisigkeit des Schulwesens angeführt, die mangelhafte Ausbildung an so zwangsläufig entstehenden „Zwergschulen“; die Betonung des konfessionellen Gegensatzes; der Gewissenszwang für mehr als 100.000 deutsche Kinder, die eine Schule der anderen Konfession besuchen, weil es am Ort nur diese eine Schule gibt; und, was vielleicht praktisch am schwersten wiegt: die Schwierigkeit, zumal bei dem bestehenden Lehrermangel, überzeugte Katholiken und Protestanten als Lehrer zu finden, ist doch die religiöse Uberzeugung Voraussetzung ihrer Anstellung. So heißt es im bayerischen Schulorganisationsgesetz von 1950: „An Bekenntnisschulen sind nur Lehrer zu verwenden, die geeignet und bereit sind, die Kinder nach den Grundsätzen des betreffenden Bekenntnisses zu unterrichten und zu erziehen.“ In Bayern gibt es 80 Prozent katholische Bekervtnis-schulen, in Nordrhein-Westfalen ebenso viele evangelische.' Woher so viele ungeheuchelt katholische beziehungsweise evangelische Lehrer nehmen? Niedersachsen selbst hat knapp 19 Prozent Katholiken; es herrscht dort entsprechend dem Schulgesetz, auf dessen Fortschrittlichkeit die Niedersachsen sehr stolz waren, die Gemeinschaftsschule vor, nur in Oldenburg gibt es größtenteils evangelische Bekenntnisschulen.
Nicht alle Länder schwören auf die Bekenntnisschule: in Rheinland-Pfalz soll man auf das Anerbieten eines Konkordats abgewunken haben; die katholischen Bischöfe in
Nordrhein-Westfalen dagegen sprachen sich mehrmals für die Bekenntnisschule aus.
Schule als Politikum
Natürlich ist die Schule ein Politikum ersten Ranges, wie gerade der Fall Niedersachsens beweist. Eine unvoreingenommene Stellungnahme hat es schwer. Bemerkenswert ist immerhin, daß die freiere Luft des Konzils und der Auftrieb, den die ökumenischen Bestrebungen dadurch erhielten, wenn auch offenbar nicht in der Kurie, so doch in manchen Theologenkreisen dahingehend gewirkt haben, dieses Problem neu
zu durchdenken. In der seit Jänner erscheinenden theologischen Zeitschrift „Concüium“, die über eine stattliche Reihe angesehenster internationaler Mitarbeiter verfügt, stellte der italienische Schulfachmann Gozzer „Vorüberlegungen zum Problem der katholischen Schule und der christlichen Erziehung“ an, die, ohne auf das deutsche Schulwesen Bezug zu nehmen, die Ansicht zum Ausdruck bringen, in den letzten Jahrzehnten habe sich das Schulwesen insofern gewandelt, als es seinen weltanschaulichen Charakter verloren habe. Die Erziehung liege heute vorwiegend direkt bei den
Eltern und der kirchlichen Gemeinschaft. Der Staat habe sein Erziehungsmonopol verloren. In der demokratischen und pluralistischen Gesellschaft sei es christlichen Eltern erlaubt, ihre Kinder in nicht konfessionell gebundene staatliche Schulen zu schicken; diese müßten dort durchaus nicht in ihrer religiösen und moralischen Entwicklung Schaden leiden.
Jedenfalls ist die Frage der konfessionellen Schule in Fluß — nicht nur in Deutschland, sondern In allen Ländern mit mehrkonfessioneller Bevölkerung. Nur Holland ist bisher eine befriedigende Lösung gelungen.
„Schlechter Boden für die Demokratie“, stellte der sonnenverbrannte Engländer so endgültig fest, daß ich nicht widersprechen konnte. Er lebte jahrelang Im Land und kannte es besser als es viele seiner Einwohner kennen. Wir saßen auf der Terrasse des berühmten „Grand Hotel“ an der Sharia el-Nil, der breiten Prachtstraße mit schattigen Bäumen, die sich direkt am Blauen Nil hinzieht und früher Kitchener Avenue hieß. Uber Khartum lag die sengende Maisonne, und es hatte 38 Grad dm Schatten. Wir unterhiel-
ten uns über die Sudanesen. „Die Araber sind rückständig, arm und unwissend“, sagte mein Gesprächspartner, „aber sie sind es nicht genug, um nicht ihrerseits die Niloten zu verachten, die noch rückständiger, ärmer und unwissender sind.“
Religiöser Fanatismus, Intoleranz, unüberwindliche politische Gegensätze, ein haßvoll brodelnder ethnischer Konflikt zwischen Nord und Süd, „Weiß“ und „Schwarz“, beherrschen tatsächlich Alltag und Politik im Sudan. „Sehen Sie“, fügte der Engländer hinzu, „solange wir hier regierten, war alles ruhig.“ Und: „Daß wir hier so ungestört reden können, verdanken wir dem General! Fragen Sie ihn, wie er das anstellt! Er wird Ihnen ein Plädoyer halten für die Diktatur!“
Die Diktatur ist im Ruhestand
Diese Szene spielte sich ab, als im ehemaligen Kharfcumer Gouverneurpalast noch „der General“ — Ferik Ibrahim Abbud — herrschte, der die junge parlamentarische Demokratie 1958 kampflos durch ein Militärregime ersetzt hatte. Es funktionierte unauffällig und gut. Bis zu seinem Sturz, 1964, erschien der Sudan als einer der ruhigsten Araberstaaten. Der „milde Diktator“ lebt jetzt im Ruhestand. Seitdem gibt es wieder innerpolitische Wirren und außenpolitische Instabilität. Vorläufiger Höhepunkt war soeben der — fehlgeschlagene — Offiziersputsch. Die kurz vorher abgehaltenen zweiten Wahlen in der Geschichte des unabhängigen Sudans endeten ohne klare oder auch nur regierungsfähige Mehrheitsverhältnisse, und hinter dem wolkenlos blauen Himmel lauert, wie ein Gewitter, die ständige Umsturzdrohung.
Ihr Hintergrund ist nicht die Tagespolitik, sondern eine ethnische, religiöse, zentralistische, wirtschaftliche und oziale Expansion. Sie begann im Zeitalter der Sklavenjagdän, erlebte ihren Höhepunkt, als die Türkenkrieger des Khediven, Mohammed Ali, im 19. Jahrhundert bis tief in den afrikanischen Süden vorstießen, fortgesetzt wurde mit militärischen Mitteln während dos anglo-
ägyptischen Kondominiums, und wuchert weiter, seit der Sudan selbständig ist. Hinter ihr stehen einträchtig das landhungrige Ägypten und die sudanischen Araber.
Bevor der Sudan 1956 frei wurde, strebte die ägyptische Politik — unterstützt von den mit ihr sympathisierenden arabisch-sudanesischen Kreisen — die „Einheit des Niltals“ an. Eine Volksabstimmung endete mit der Unabhängigkeitserklärung, aber der neue Staat wurde Mitglied der Araberliga. Dabei ist er gar nicht rein arabisch, und daher rühren auch alle seine seitherigen Wirren.
Neger und Araber
Die sechs Nordprovinzen werden bevölkert von acht Millionen Arabern und islamischen Sudannegern. In den drei Südprovinzen Oberer Nil, Äquatoria und Bahr el-Ghazal leben etwa drei Millionen heidnische und teils christliche Niloten, die sich schon deshalb nicht zum Arabertum bekehrten, weil die Religion Mohammeds früher ausschließlich durch arabische Sklaven jäger zu ihnen
kam- Daher und aus tief verwurzelten rassischen, kulturellen und Mentalitätsunterschieden kommt der Gegensatz Neger—Araber.
Die Kluft zwischen Nord und Süd
Die sudanesische Regierung versuchte kürzlich, Vertreter der ver-fehdeten Provinzen bei einer Round-Table-Konferenz zusammenzubringen, an der auch Beobachter aus den Nachbarstaaten Ägypten Ghana, Kenia, Nigeria, Tansania und Uganda teilnahmen. Die Konferenz scheiterte, weil man arabischerseits nicht auf die südliche Minimalforderung nach Ablösung der zentralistischen durch eine föderalistische Staatsverfassung einging. Die Konferenzempfehlungen sehen Maßnahmen zur Linderung des Flüchtlingselends und der Hungersnot vor, zur Bekämpfung der Meuterei und der Wiedereröffnung der Schulen. Südprovinzler sollen bei der Stellenbesetzung mehr berücksichtigt werden, und man denkt an die Errichtung einer Universität.
Das sind aber, meinen Kenner der
Verhältnisse, periphere Probleme. Die muselmanischen Nordsudanesen blicken verächtlich auf die Südsudanesen herab, die sie für würdelos, unbegabt und minderwertig, ja für primitiv, falsch, gefährlich und wild halten. Auch heute noch behandeln die einen die anderen häufig sogar öffentlich nicht besser als Sklaven. Die Niloten ihrerseits hassen die Araber, die sie zuerst vorwiegend als Sklavenjäger und betrügerische Händler, und hernach als Unterdrük-ker kennenlernten.
Seit der Sudan unabhängig ist, will die Regierung die Integration der Südprovinzen erzwingen — mit militärischen Mitteln. Indessen geraten viele Patrouillen und Strafexpeditionen in Hinterhalte und werden entwaffnet oder aufgerieben. Auch geheime Waffentransporte aus Ägypten, die — via Sudan — für die Kongorebellen bestimmt waren, verschwanden schon spurlos im Urwald. So kommen die nilotischen Widerstandsgruppen zu Waffen.
Ausländische Beobachter sind überzeugt, daß dieses Problem unlösbar ist, solange die Nordsudanesen den Unabhängigkeitsdrang der Südsudanesen gewaltsam unterdrücken und teilweise noch immer mit dem Anschluß an Ägypten liebäugeln. Dadurch werden die separatistischen Tendenzen im Süden, dia auf einen Anschluß an Äthiopien und andere Nachbarländer oder einen eigenen Staat abzielen, nur bestärkt. Gehen die ihrer Natur nach intoleranten Araber von ihrer Un-nachgiebigkeit nicht ab, sagen dies Leute, ist jede Forderung nach politischer Stabilität ein „Plädoyer fürdi Diktatur“. Darin ist der Sudan nur ein weiteres Beispiel für die Lage in anderen Staaten Afrikas, deren kolonialer Zufälligkeit entsprungene Grenzziehung heute nur noch durch machtpolitische Interessen, nicht durch natürliche ethnische, sprachliche oder kulturelle Merkmale zu rechtfertigen ist