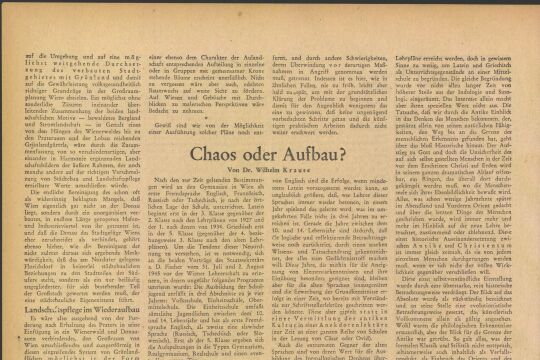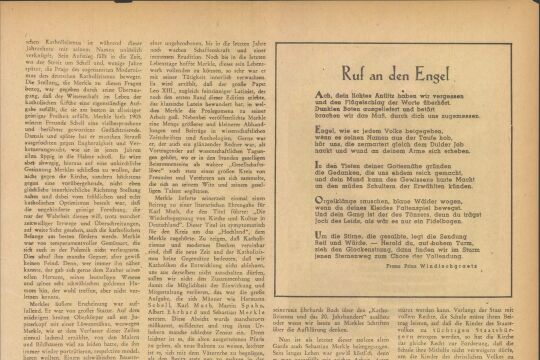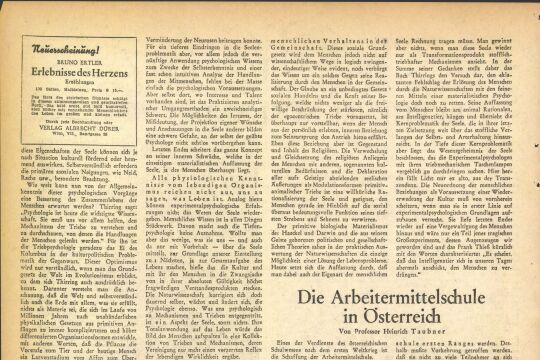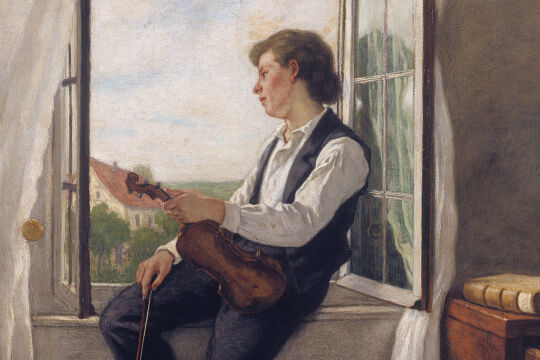Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wie lehren wir morgen?
Zwischen der Vermittlung von Wissen in den Schulen und der Verwertung, wenn nicht Kommerzialisierung dieses Wissens nach Schulabgang ist eine Verzögerung vorhanden. Was etwa in der ersten Klasse einer höheren Schule in einem praxisgebundenen Gegenstand gelehrt wird, kann bisweilen erst nach neun Jahren mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. Falls sich aber die Wirklichkeit, auf die hin der Gegenstand abgestellt ist, geändert hat, ist das Schulwissen in einem abwertenden Sinn von „historischer“ Qualität und scheinbar nicht praktikabel. Die Verzögerung zwischen der Aneignung von Wissen und der Wissensverwertung jenseits der Schule und angesichts einer gewandelten Wirklichkeit ist aber unvermeidbar, wenn nicht sogar nützlich. Auch in den berufsbildenden Schulen.
Wirft man der Schule vor, sie vermittle ein Wissen von gestern in der Gegenwart für eine Welt von morgen, dann sollte man den Pädagogen doch sagen, wie sie es anders machen könnten! Der Schule ist es nun einmal aufgegeben, ein bereits feststehendes und gleichsam amtlich als lehrbar anerkanntes Wissensgut dem Schüler pädagogisch reduziert zu bieten. Die Schule darf nicht versuchen, die Wirklichkeit, das, was sich in verwirrender Vielfalt als aktuelle „Praxis“ darstellt, bis in die Details von Handgriffen synchron zu kopieren und in die Enge eines „Gegenstandes“ zu pressen. Geschieht dies, kommt es unter anderem auch zur geistigen Überfütterung, die, wie wir einem fundierten Artikel in der Zeitschrift „Die Industrie“ entnehmen, vor allem von den französischen Pädagogen beklagt wird. Es gibt außerdem kein gültiges Modell der Wirklichkeit, das im Unterricht verwertbar wäre.
Wirklichkeit in den Bereich des Schulunterrichtes aufnehmen, soll also bedeuten, ihr erkennbares Gerüst darstellen. Mehr zu fordern heißt die Schule überfordern. Sicher ist es ungemein wichtig, daß die Pädagogen, und unter ihnen vor allem die beamteten Schulwissenschaftler, die Erkenntnisse der sogenannten Zukunftswissenschaft, die heute beileibe keine Utopie mehr ist, beachten und die Lehrpläne so weit offenhalten, daß sich der Lehrer ohne umständliche gesetzliche Regelung an neue Erkenntnisse anpassen kann. Grundsätzlich ist aber für den Pädagogen die Zukunft immer wieder eine verlängerte Gegenwart, von der weg freilich Untersuchungen lohnend sind, wie sie zum Beispiel von der Ständigen Konferenz der deutschen Kultusminister angestellt worden sind, die sich mit dem Schul- und Lehrerbedarf im Zeitraum 1961 bis 1970 geradezu prospektiv befaßten. Bei der Abfassung der Lehrpläne ist daher eine Be-dachtnahme auf ernst zu nehmende Voraussagen, die ohnedies nur säkulare Züge ausweisen, zu beachten, ebenso bei der Lehrerbildung und vor allem bei der Lehrerfortbildung, für die es in unserem Land aus finanziellen Gründen noch keine Konstitution in der Art von Verwaltungsakademien gibt
Unverkennbar weist die Wirklichkeit, zum Beispiel die technische und kommerzielle Praxis, eine Dynamisierung auf. Was heute noch gültig ist, gehört morgen schon zu den Ladenhütern des Wissens. Nicht wenige Lehrer müssen zwischen der Beendigung ihres Hochschulstudiums und dem Ende ihrer Dienstzeit ihr Wissen mehrmals von Grund auf erneuern. Aus diesem Grund gewinnt das Problem der pädagogischen Ökonomie wachsende Bedeutung.
Dabei soll als pädagogische Ökonomie zweierlei verstanden werden, einmal die angemessene, wenn nicht in manchen Fächern radikale Kürzung des Stoffvolumens, das zuweilen randvoll mit Details angefüllt ist, die oft keinerlei Aussagecharakter haben. Die Frage, was vom Schulstoff, der ein Wissensgut des Lehrers, sein „Betriebsvermögen“, darstellt, nicht zu bringen ist, scheint in manchen Situationen wichtiger K seih als die Frage was zu bringen ist. Die Addition von Einzelheiten gibt jedenfalls noch immer kein Ganzes, sondern ist Ausdruck einer sinnlosen Beschäfti-gungstheraphie, deren Kosten weder den Eltern noch dem Staat zuzumuten sind. Daher die Forderung nach einer Anwendung des pädagogischen Sparsamkeitsprinzips: das Plansoll eines vorgeschriebenen Lehrstoffes mit einem Minimum an Aufwand, das heißt rationell, darbieten.
Die pädagogische Ökonomie soll sich aber auch im Sinn eines Optimumprinzips darart vergegenständlichen, daß mit gegebenen Mitteln (Lehrern, Lehrmitteln und verfügbarer Stundenanzahl) möglichst viel Wissen geboten und im Schüler verfestigt werden kann. Eine optimale Wissensvermittlung beruht auf einer Reihe von Bestimmungsfaktoren, unter anderen auf der menschlichen und pädagogischen Qualität des Lehrers und auf einer vom Lehrer — und vor allem von diesem — zu schaffenden günstigen pädagogischen Atmosphäre. Einige, wenn auch ganz wenige Lehrer gehen immer noch davon aus, daß es während des Unterrichts nur ein Gefühl geben könne, das der Angst, deren „Produktion“ sie als ihre erste Aufgabe ansehen. Am liebsten würden sie zur Selbstbestätigung ihrer pädagogischen Qualität „Angstmesser“ einführen. Bedeutsam ist schließlich auch das Ausmaß der Zeit, die der Lehrer als Rahmen für seine unterrichtlichen Darstellungen hat.
Nicht unwesentlich sind aber die technischen Hilfsmittel, die in manchen Gegenständen verwendet werden sollen oder müssen. In diesem Zusammenhang einige Worte zu den sogenannten Lehrmaschinen, die man vor allem in den USA, wenn auch vorläufig nur im Rahmen der betrieblichen Fortbildung und in Ergänzung der ohnedies schon eingeführten audiovisuellen Hilfsmittel ausprobiert
Die Lehrmaschinen (Teaching machines) sind in den USA in erster Linie ein Ersatz für die dort immer knapper werdenden Lehrer und haben sogar ins Kinderspielzeug Eingang gefunden. Das erste maschinelle Lehrgerät ist übrigens schon im Jahre 1886 in den USA patentiert worden.
Die Maschinen sind sogenannte Simulatoren, die einfach einen bestimmten Lehrstoff, ebenso wie dies sonst im Unterricht geschieht, in Programmschritten als Stoff darbieten, mit dem sie gefüttert werden. Nach der Skinner-Methode folgt dem ersten Programmschritt (der Information) ein zweiter (die Frage), der eine Lücke enthält, in welche die vorher gegebene Information eingefügt werden muß. Der dritte Schritt ist dann die Antwort. Wird keine richige Antwort gegeben, springt die Maschine auf die erste Frage zurück. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis sich der Lernende die Information angeeignet hat, was ihm von der Maschine bestätigt wird.
Die Maschine stellt also ein Transportmittel für Informationen dar, eine Verkettung von Informationen, die je für sich erst ausgelöst werden, wenn eine richtige Antwort vorliegt, und ist auf die Methode des Auswendiglernens abgestellt. Neben der Skinner-Methode gibt es auch andere Methoden.
Wenn die Lehrmaschinen in den USA auch da und dort den ohnedies fehlenden Lehrer ersetzen können und müssen, sind sie trotzdem nichts weniger als ein Ersatz des Lehrers an sich. Wenn Lehrer überhaupt ersetzbar sind, dann jene kaum mehr anzutreffenden Lehrpersonen, die sich auf das Vorlesen eines Stoffes beschränken oder sich mit dem Aufschreiben von Resultaten begnügen, ohne eine Erläuterung geben zu können oder geben zu wollen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!