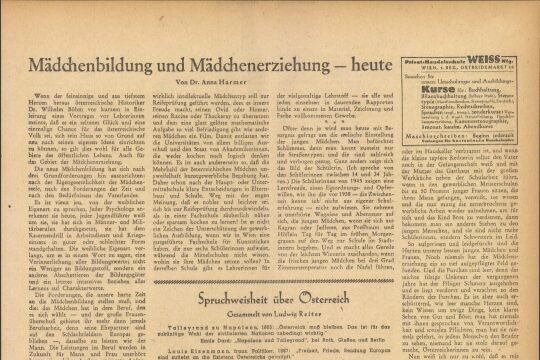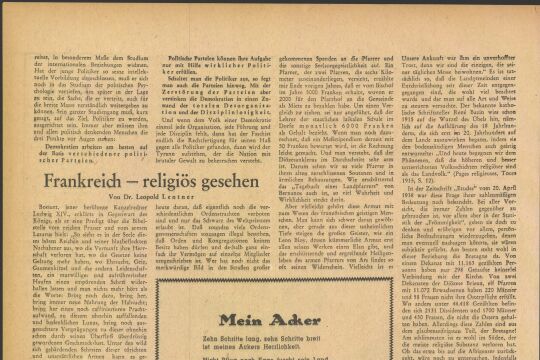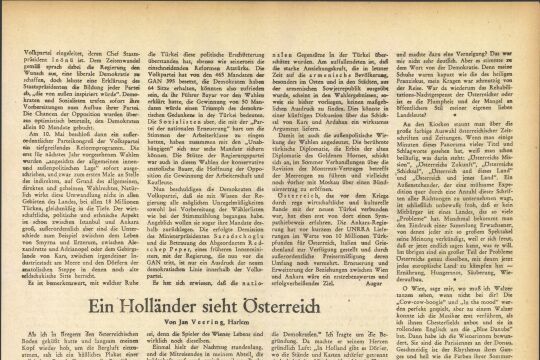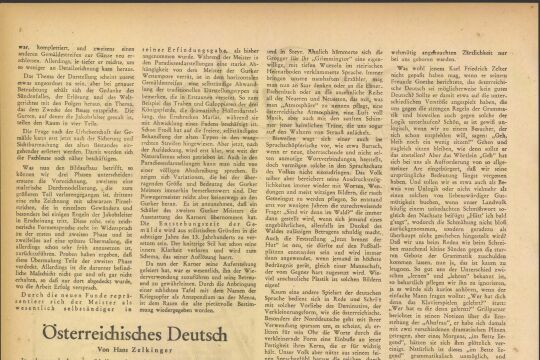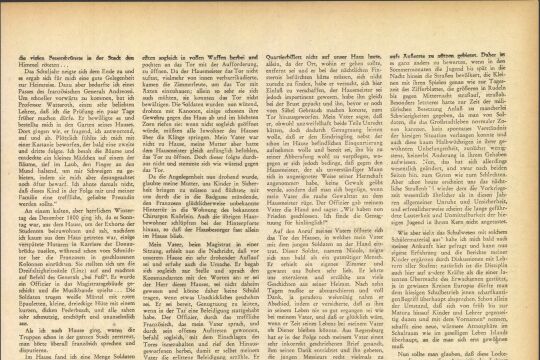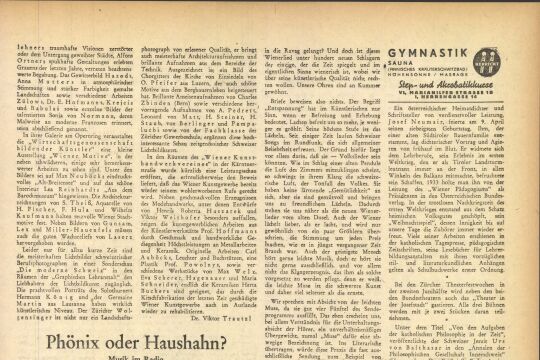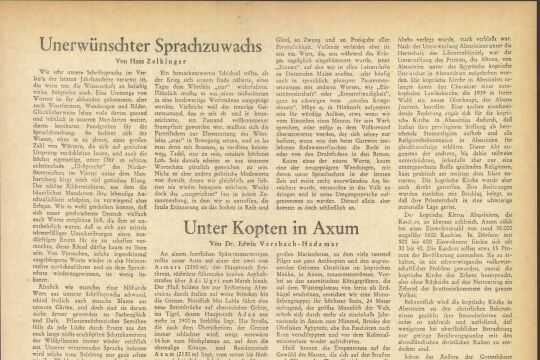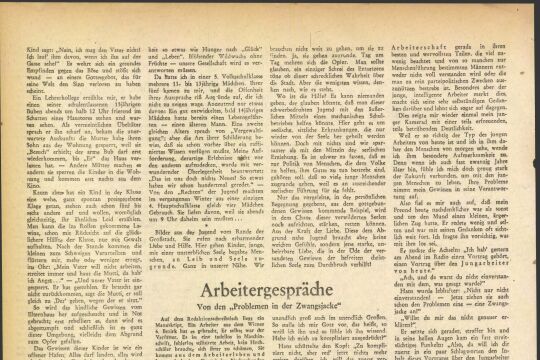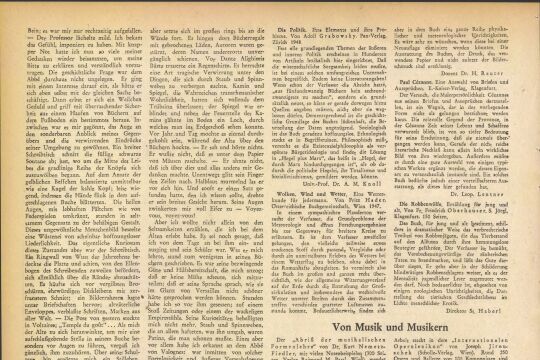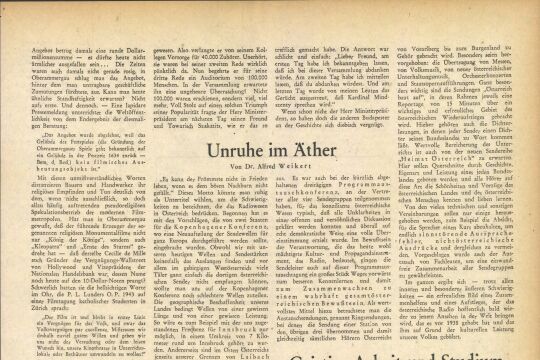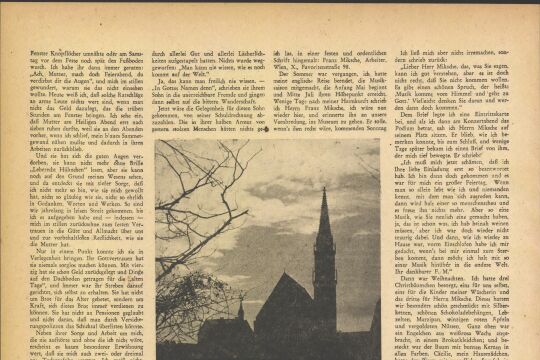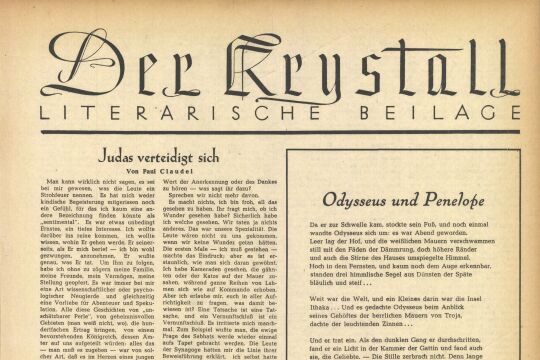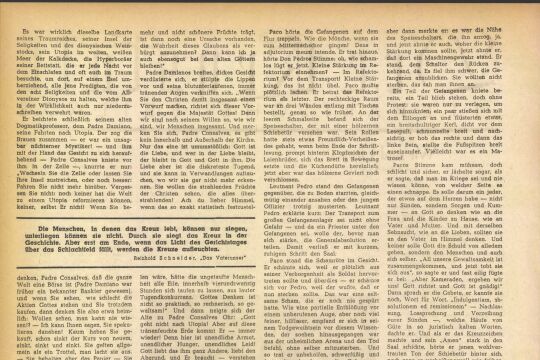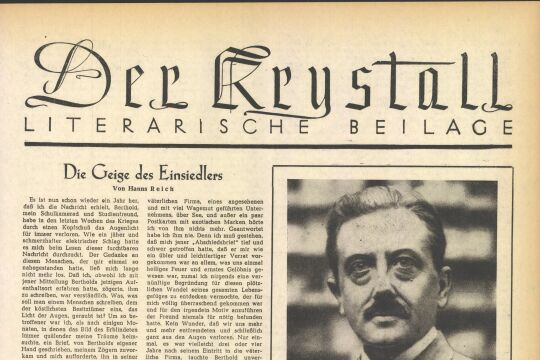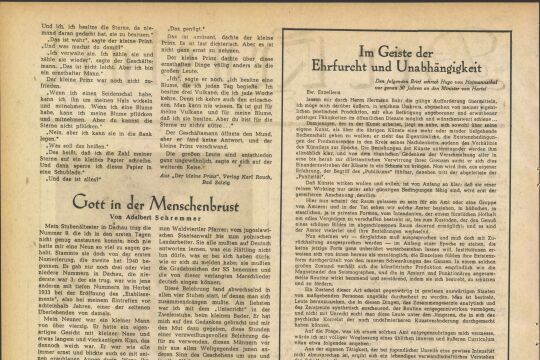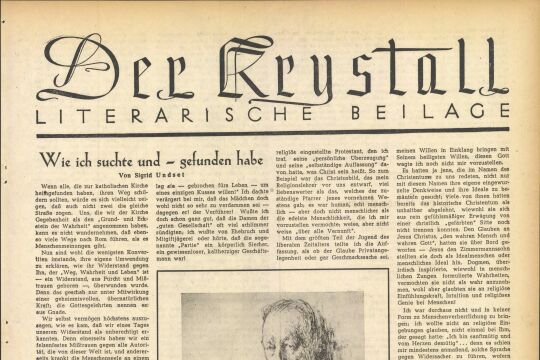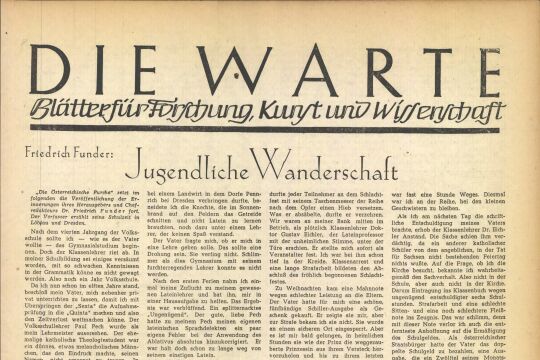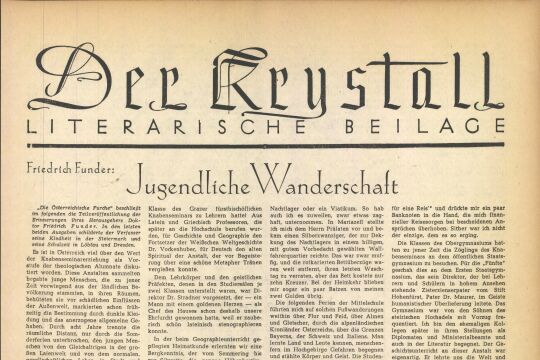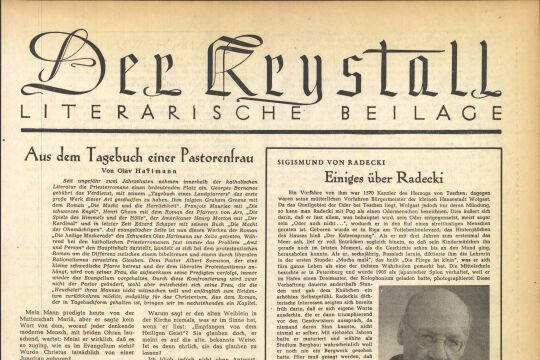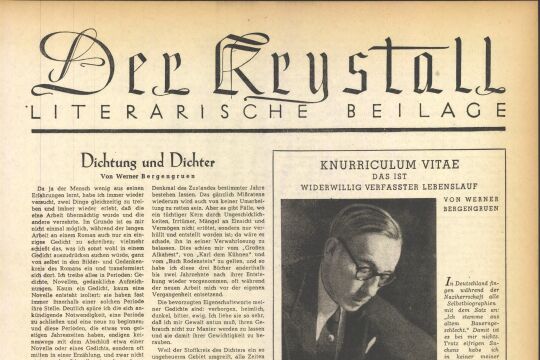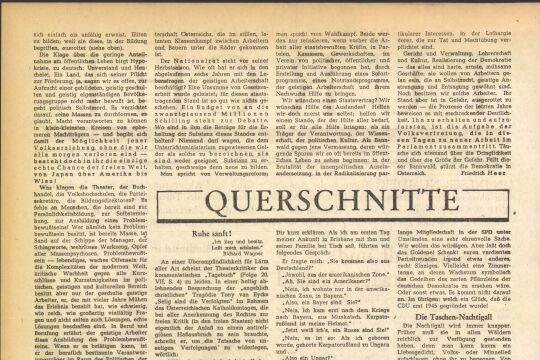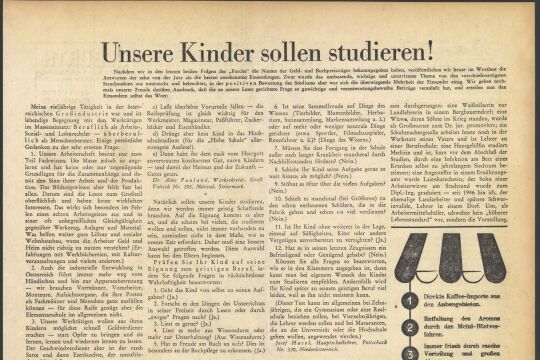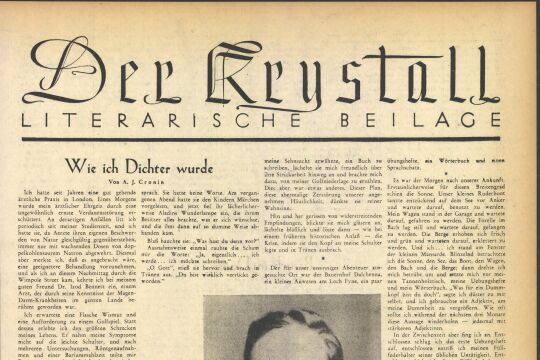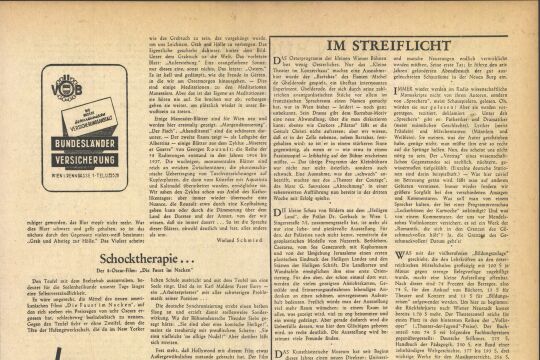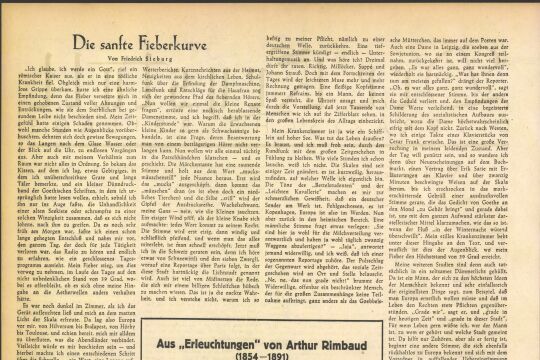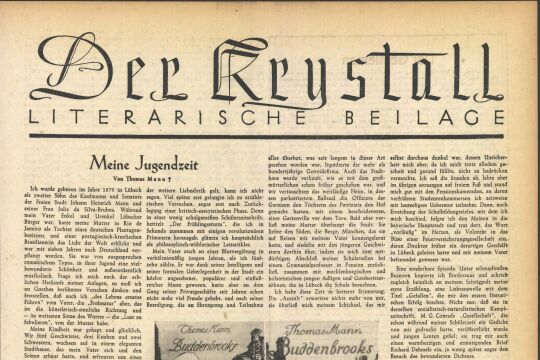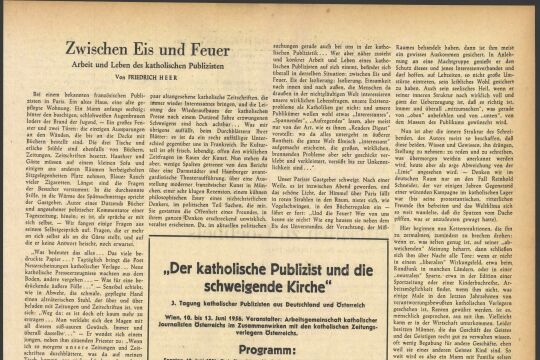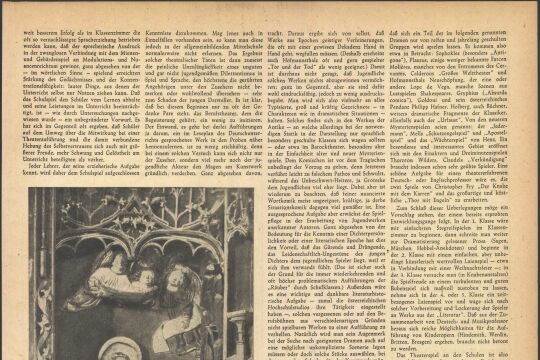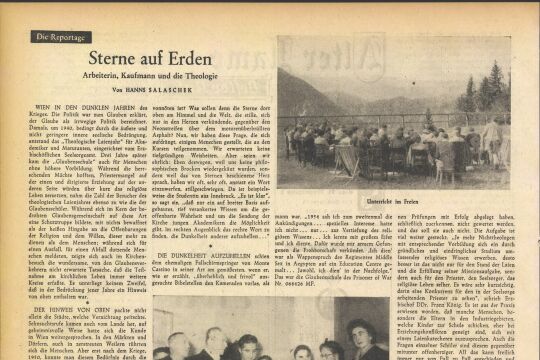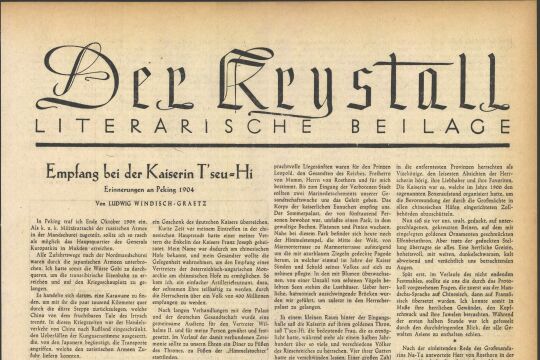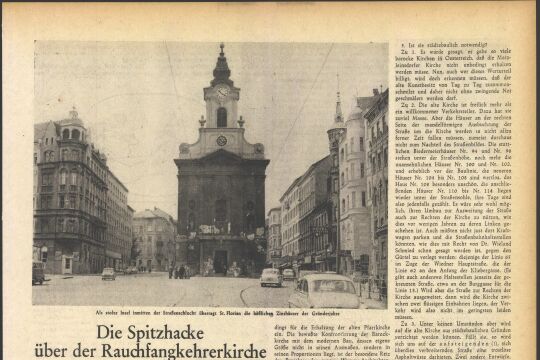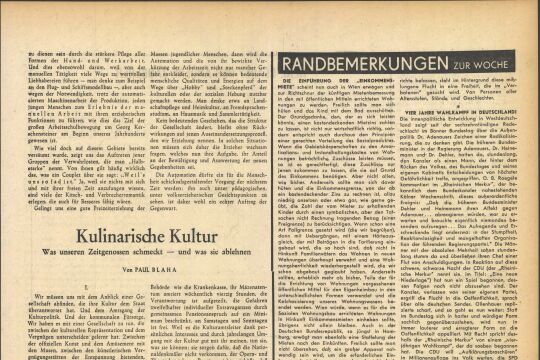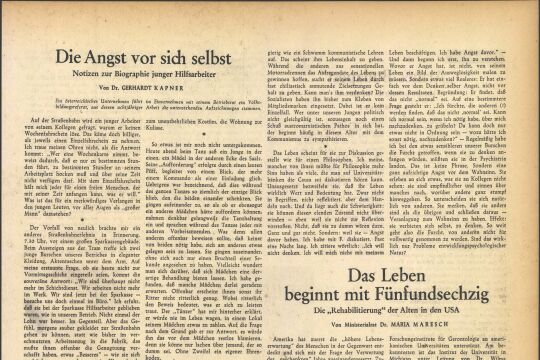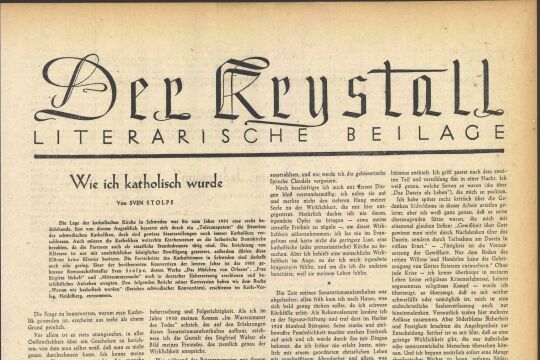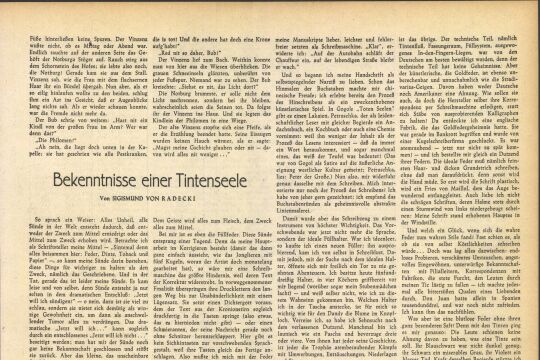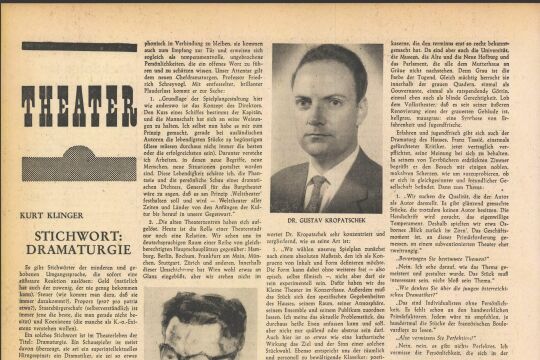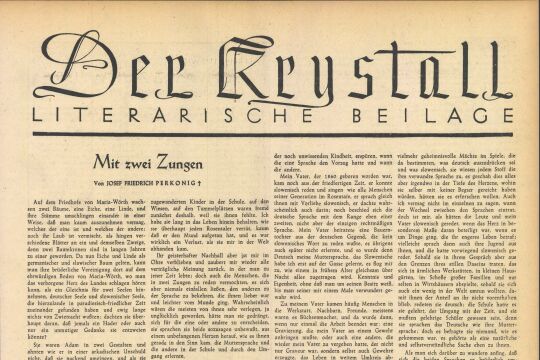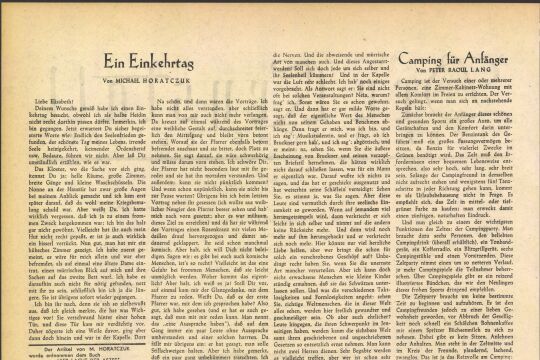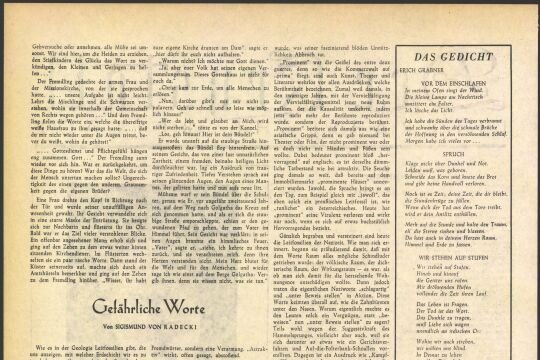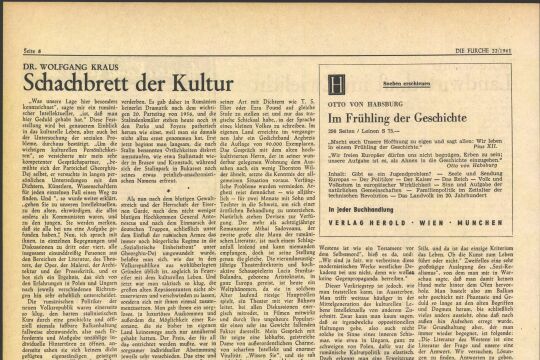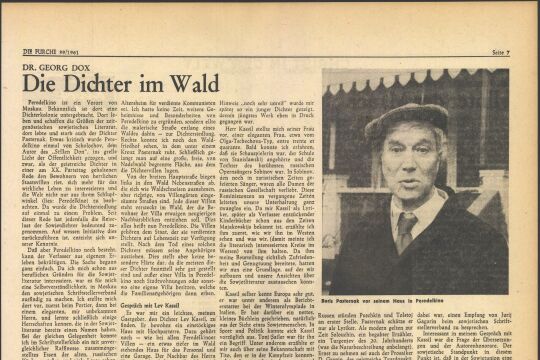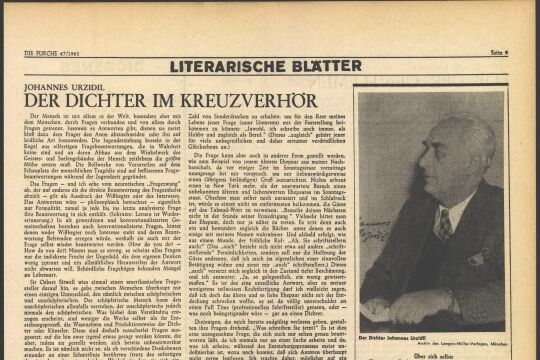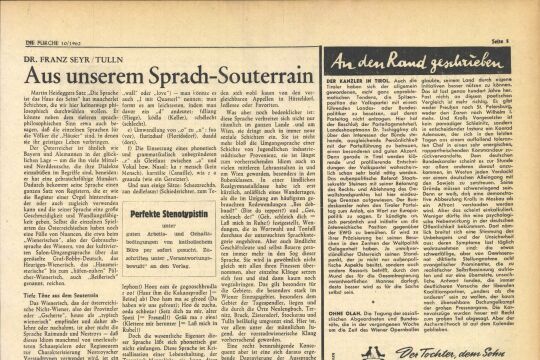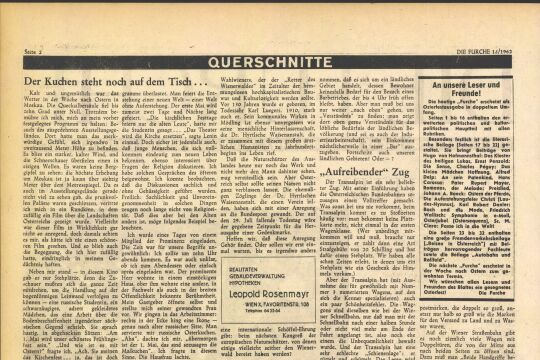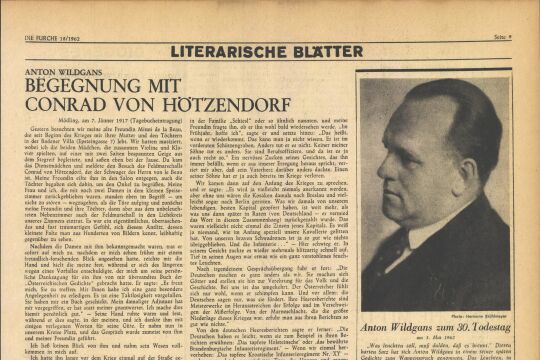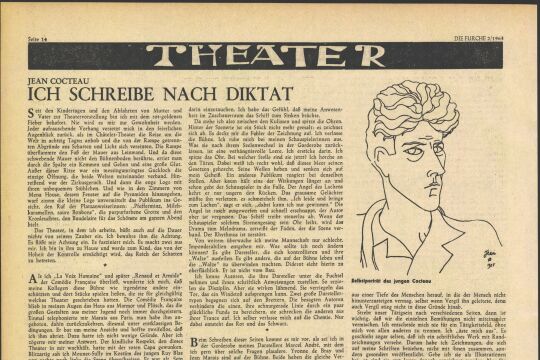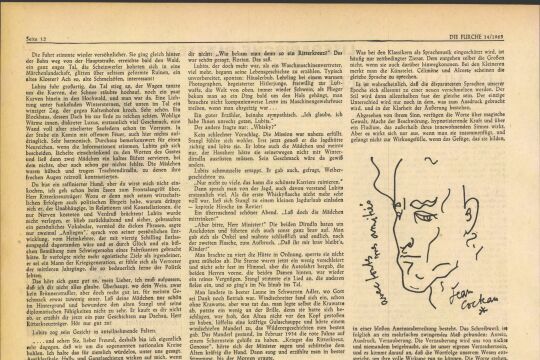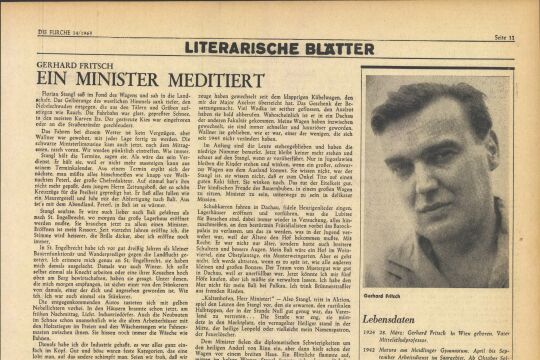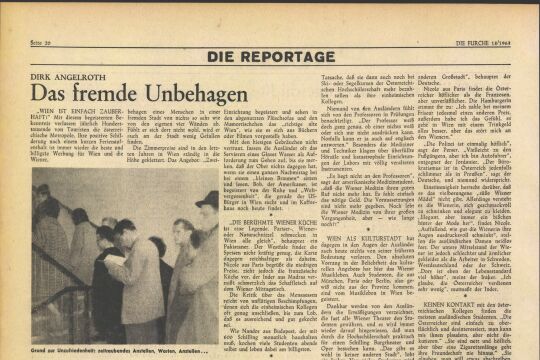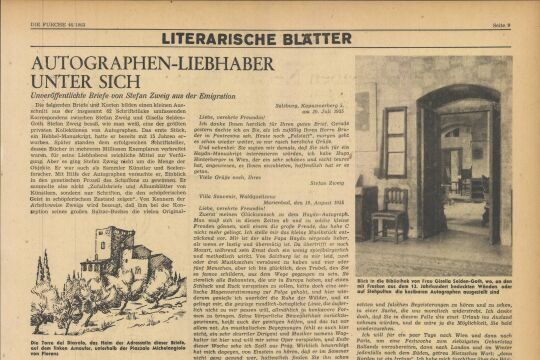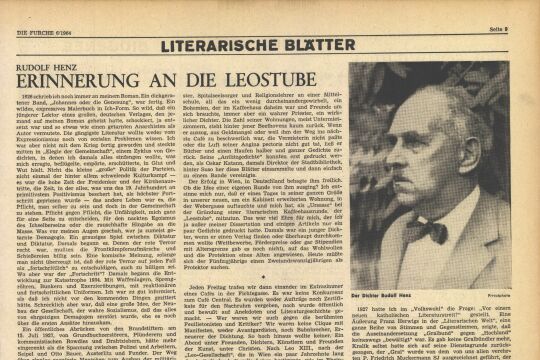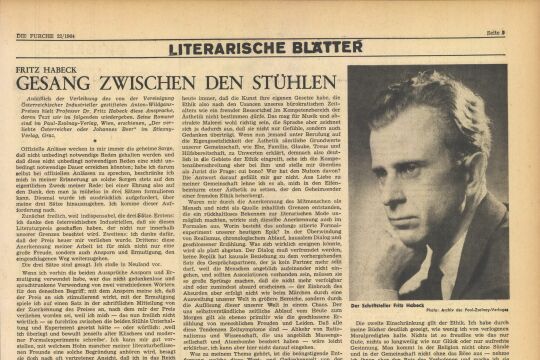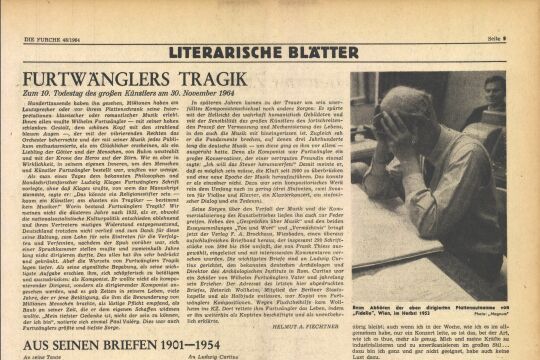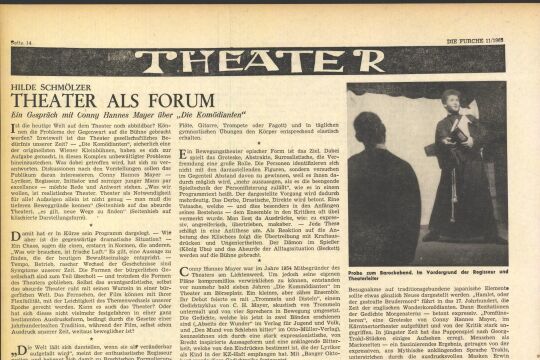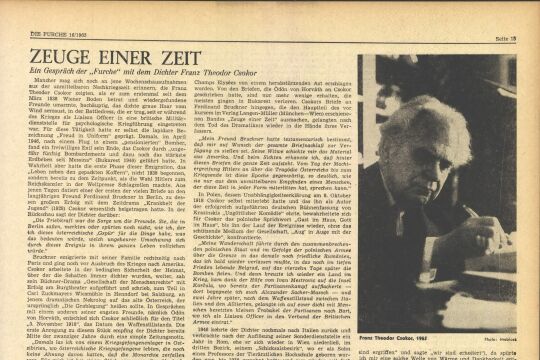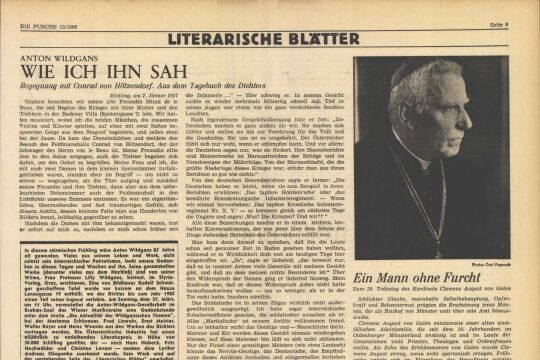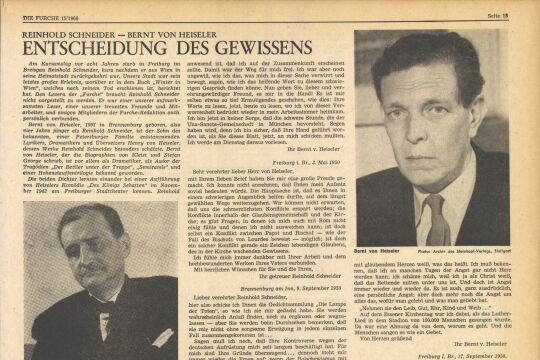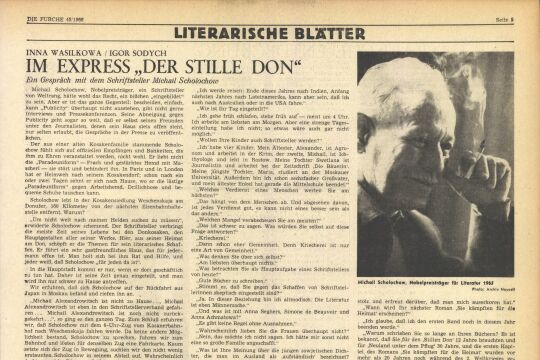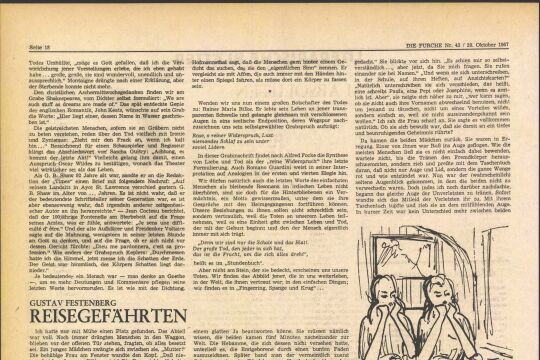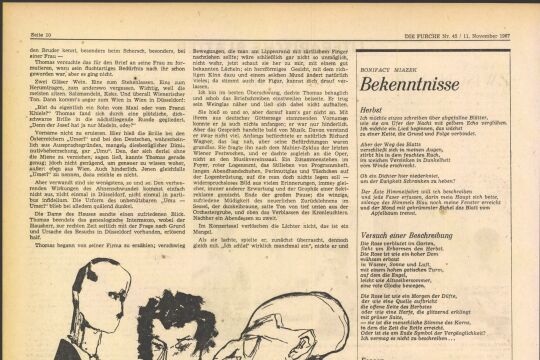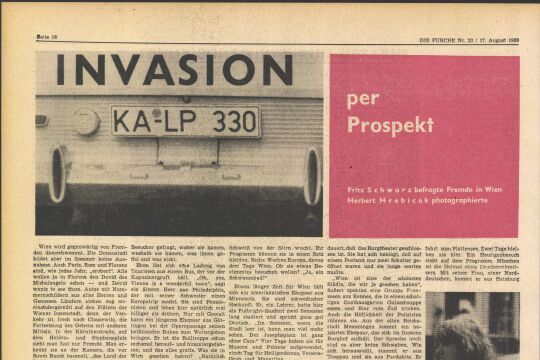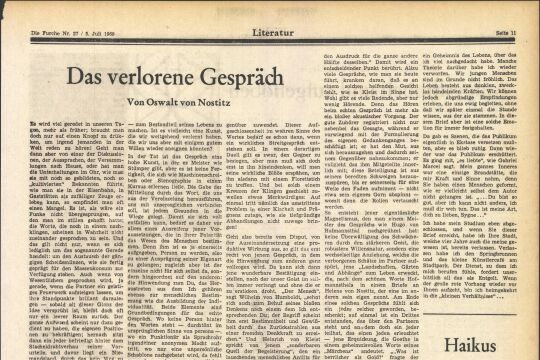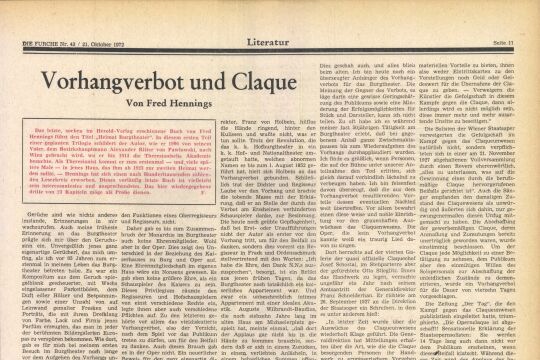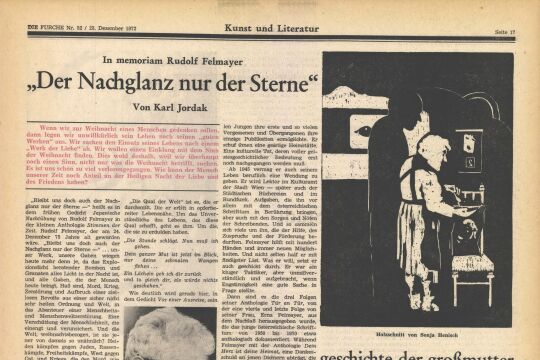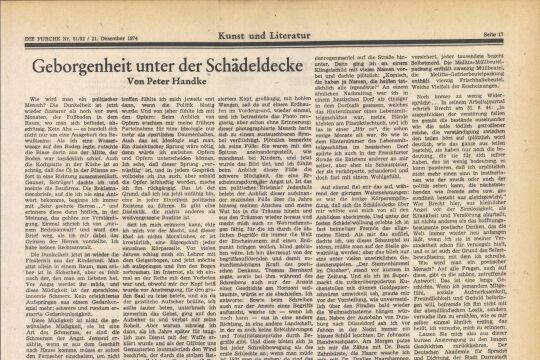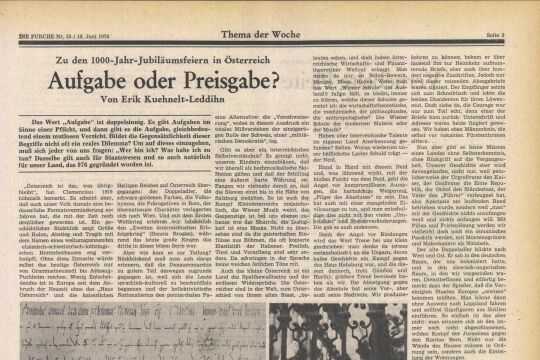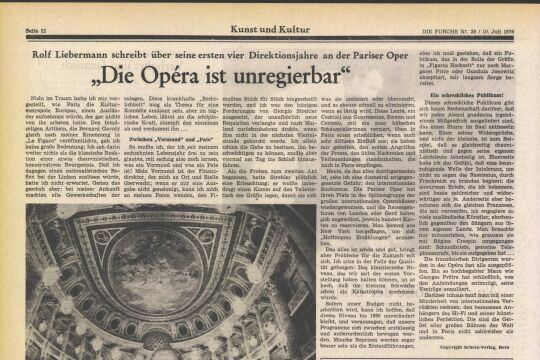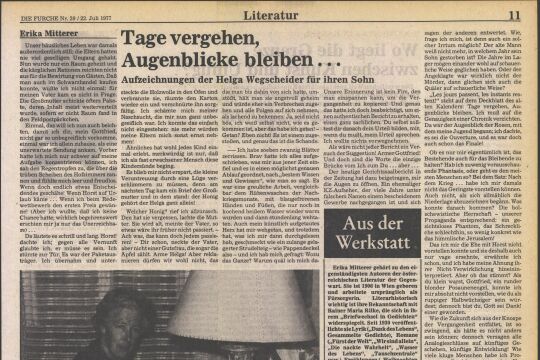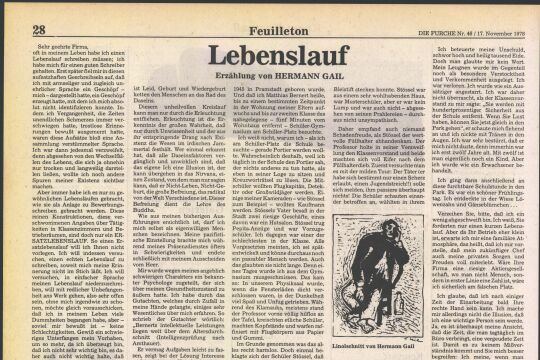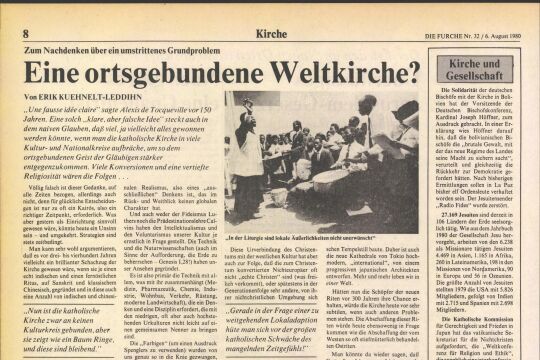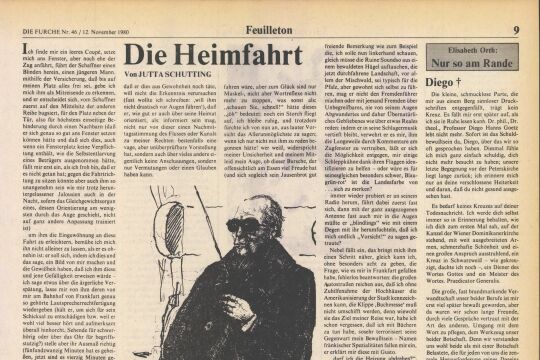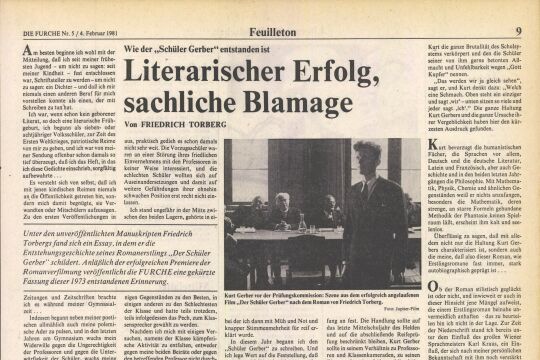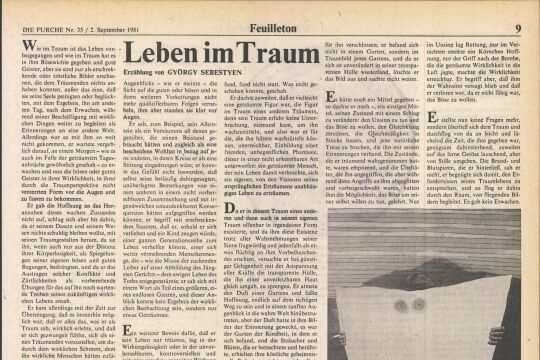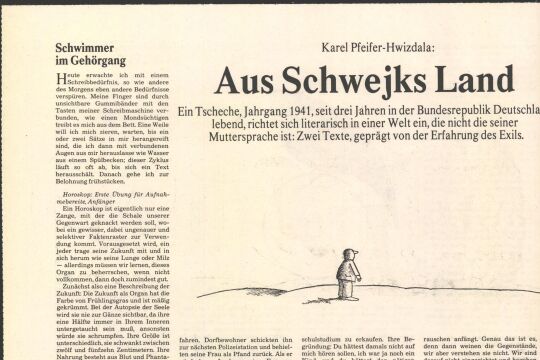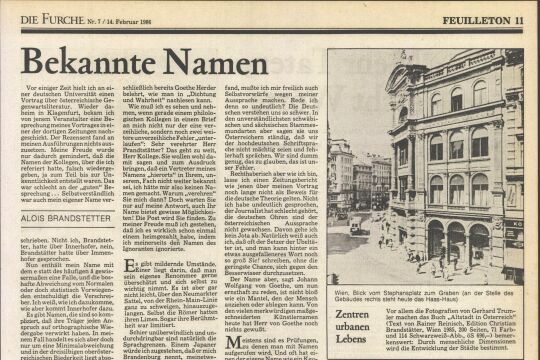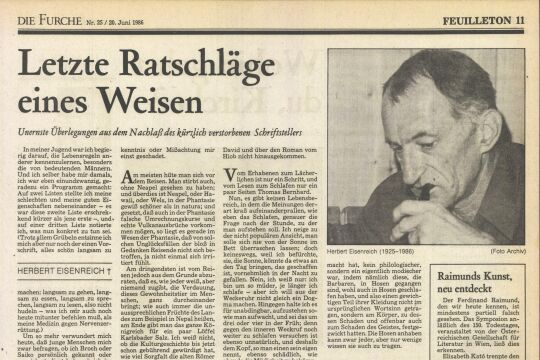Als mein Dialekt „Pfiat di“ sagte.
Vor wenigen Tagen ist mein Klavier nach Wien übersiedelt. Nach zehn Jahren Fernbeziehung ist es mir endlich aus dem Weinviertel in die Stadt gefolgt. Schrecklich verstimmt, versteht sich. Jetzt muss es sich erstmal an die neue Umgebung gewöhnen, dann können die Saiten daran angepasst werden.
Auch mein Klang hat sich mit dem Umzug verändert. Besser gesagt, meine Sprache. Die Vokale wurden glatter, die Zwielaute weicher. Je länger ich in der Stadt lebte, desto stärker wurde der Dialekt aus meinem täglichen Sprachgebrauch verdrängt. Und desto öfter musste ich mich bei Besuchen am Land der Frage „Warum red’st’n du so Deitsch?!“ stellen. Gemeint war Bundesdeutsch – und das gilt unter gebürtigen Ländlerinnen und Ländlern als hochnäsig. Dialekt hingegen ist bodenständig. Wer ihn ablegt, hält sich für etwas Besseres.
Der Wandel meines Sprachgebrauchs war jedoch keineswegs ein bewusster, sondern mehreren Umständen geschuldet. Erstens war mein Studiengang der Theater-, Film- und Medienwissenschaften ein Zufluchtsbecken für Numerus Clausus-Flüchtige. Ich war also umgeben von tatsächlich Bundesdeutsch-Sprechenden, die es maximal amüsant fanden, wenn ich Weinviertlerisch laberte, jedoch nur einen Bruchteil davon verstanden (Was heißt denn bitte ‚Sapperlot‘?). Zweitens bestanden 90 Prozent meiner Studienzeit daraus, geisteswissenschaftliche Texte zu verfassen oder ausgearbeitete Argumentationen zu präsentieren. Was soll ich sagen – es wirkt einfach glaubwürdiger, wenn man dies in vollständigen, grammatikalisch richtigen Sätzen tut. Die aschbachereske Arbeitsweise war damals leider noch nicht en vogue. Und drittens beschäftigte ich mich aufgrund meiner Leidenschaft fürs Theater zeitgleich viel mit den Eigenheiten der österreichischen Aussprache. Deutsche Schriftsprache im niederösterreichischen Slang klingt auf einer Bühne so ähnlich wie mein zehn Jahre unberührtes Klavier.
Bitte nicht falsch verstehen – ich liebe meinen Dialekt (auch wenn ich zugeben muss, dass Niederösterreich wohl die uncharmantsten von allen österreichischen Varietäten aufweist). Es gibt Momente, da kippt der Schalter in meinem Sprachzentrum automatisch in Richtung Mundart um. Wenn ich mit meiner Oma spreche. Wenn der Sarkasmus einfach raus muss. Oder, wenn ich mich herausgefordert fühle. Meine ländlichen Sprachkritiker wären erstaunt, wie oft mir im vermeintlich professionellen Rahmen ein „Jo, owa…“ entweicht.
Mein Klavier wird sich bald an die neue Umgebung angepasst haben, die Saiten entsprechend gestimmt sein. Selbst wenn man sich um einen einwandfreien Klang bemüht, werden sich die Saiten aber früher oder später wieder in ihren Ursprungszustand verziehen. Des is fix.

Ihre wöchentliche Portion Digital Dirndl
Aufgewachsen im Weinviertel, dann übersiedelt nach Wien, ist Margit Körbel mittendrin im Konflikt von gemütlicher Landidylle und rauschendem Stadtleben, Traditionen und deren Bruch, Millennials und Babyboomern. Wöchentlich schreibt Sie von Ihren Erlebnissen. Hier kostenlos abonnieren.
Aufgewachsen im Weinviertel, dann übersiedelt nach Wien, ist Margit Körbel mittendrin im Konflikt von gemütlicher Landidylle und rauschendem Stadtleben, Traditionen und deren Bruch, Millennials und Babyboomern. Wöchentlich schreibt Sie von Ihren Erlebnissen. Hier kostenlos abonnieren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!