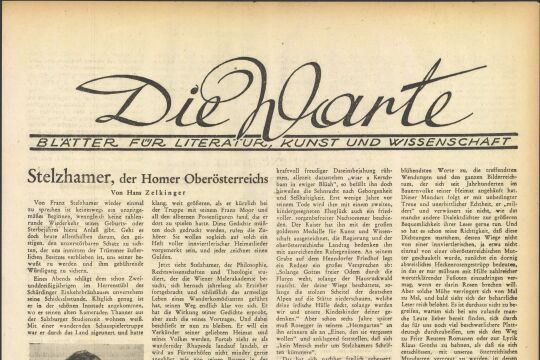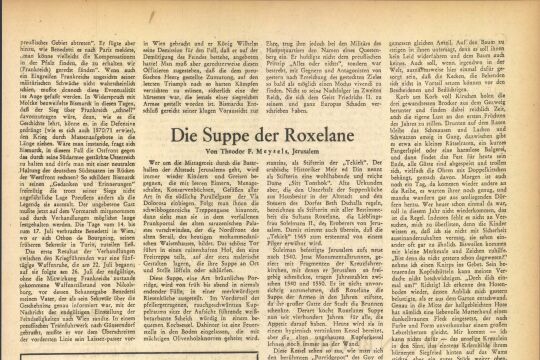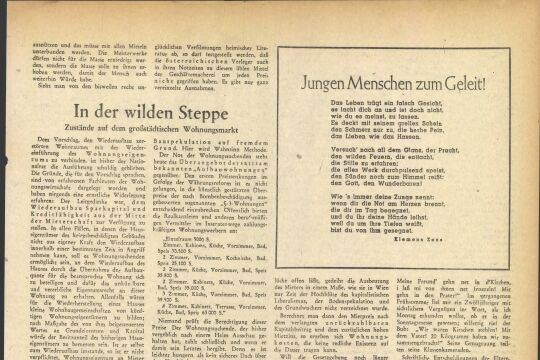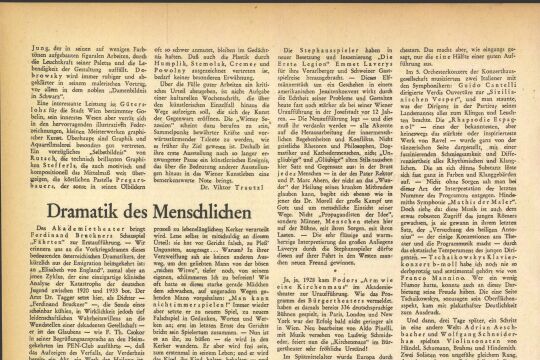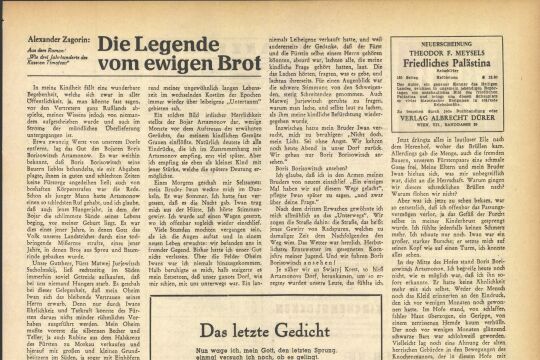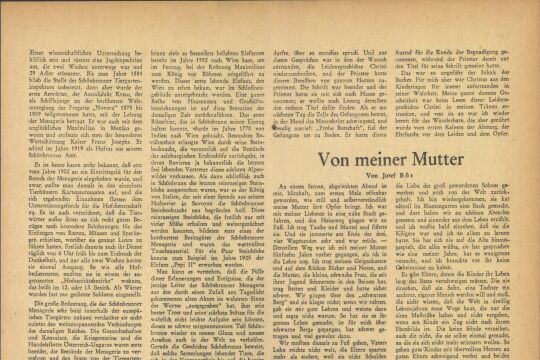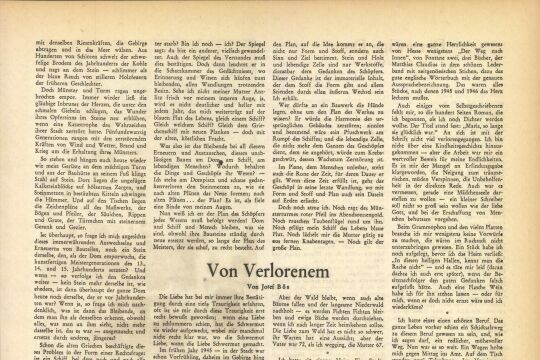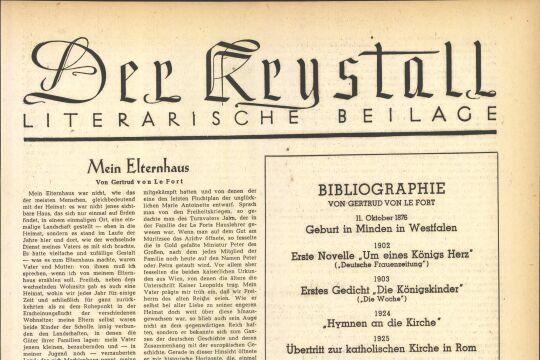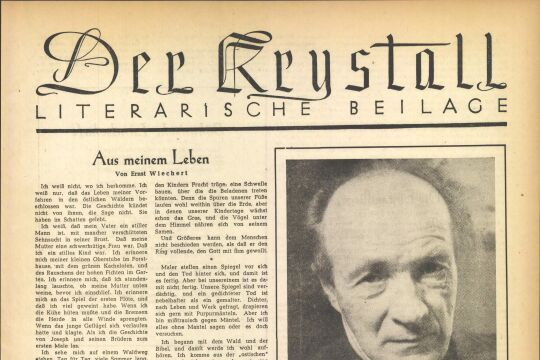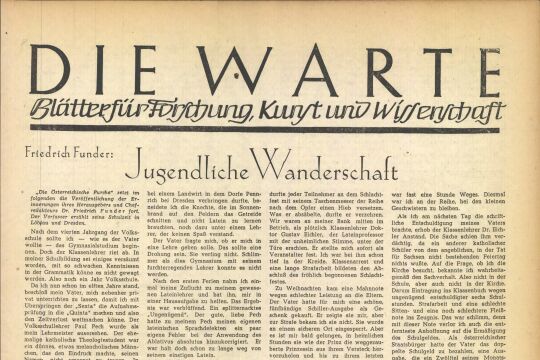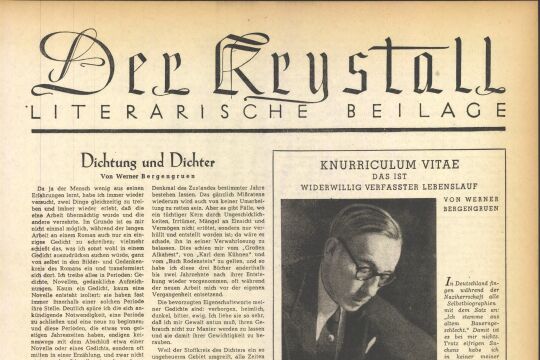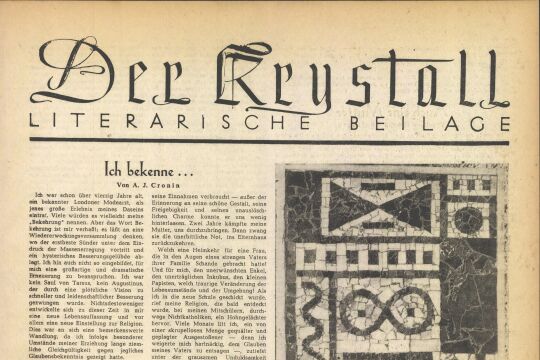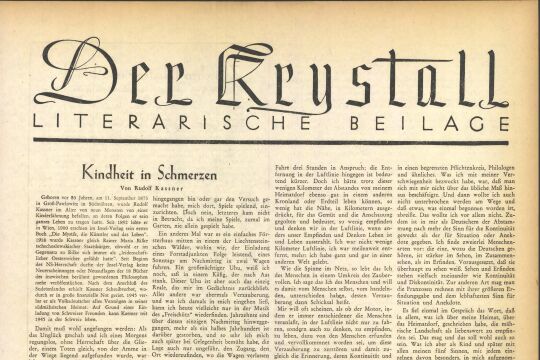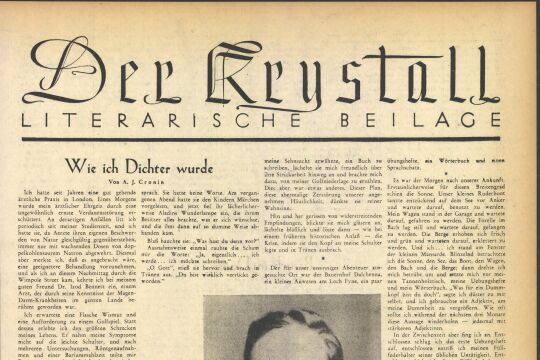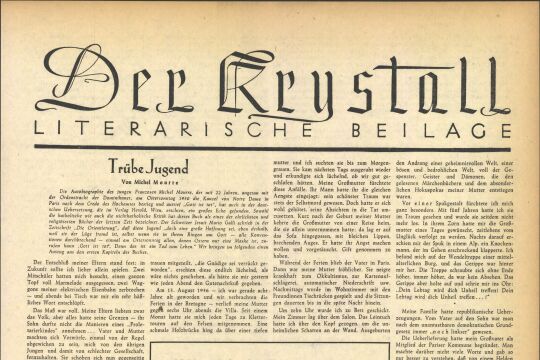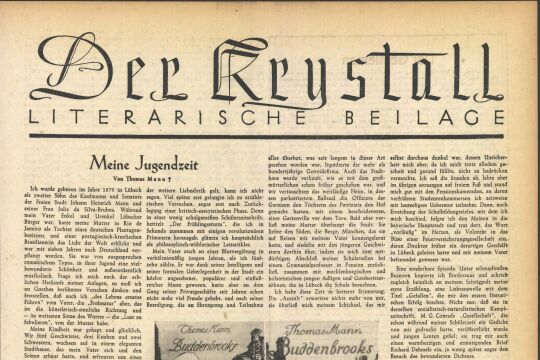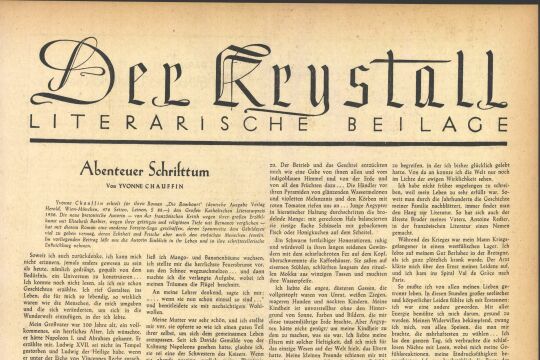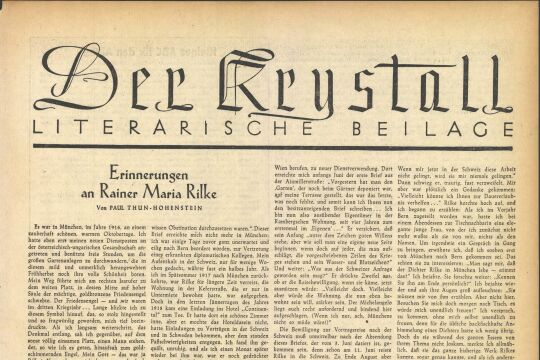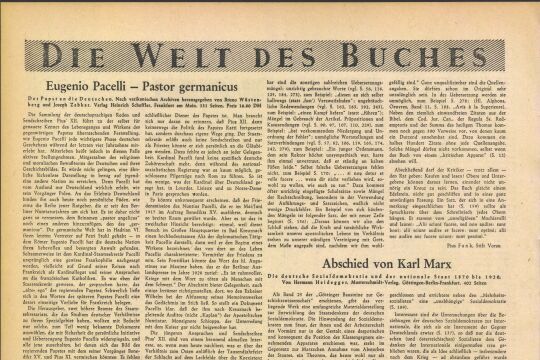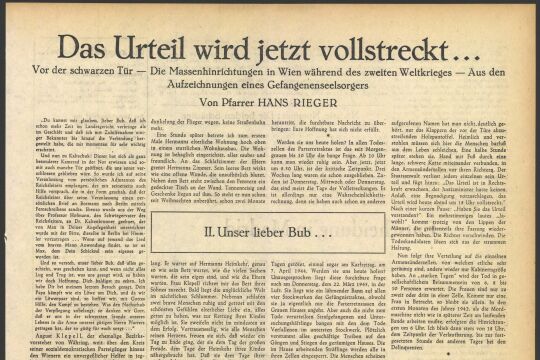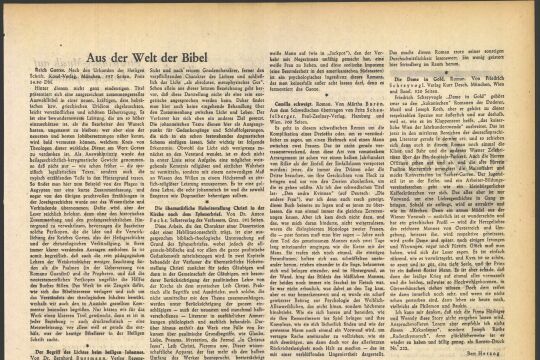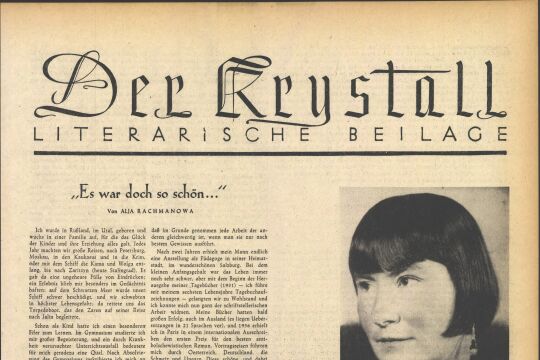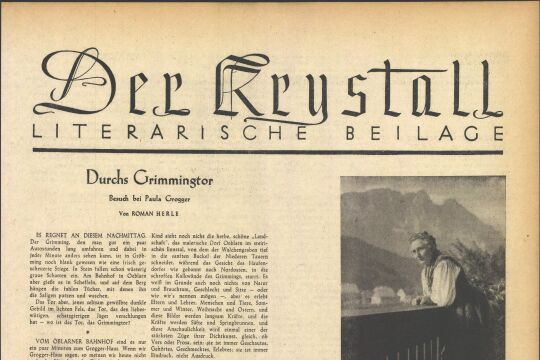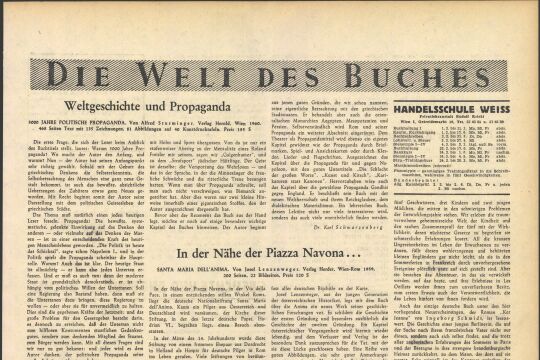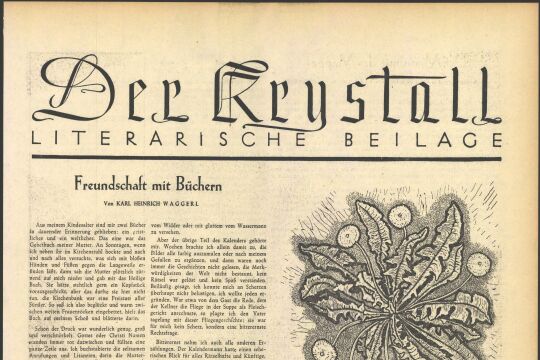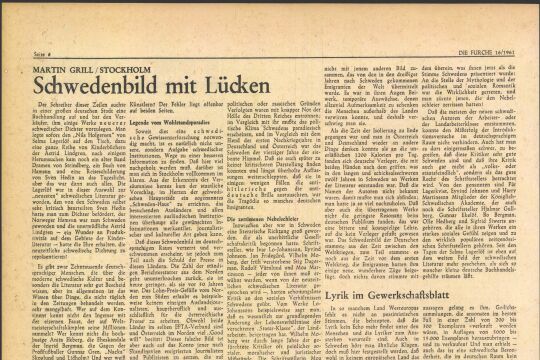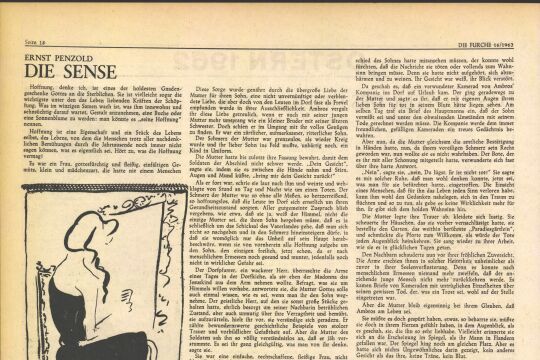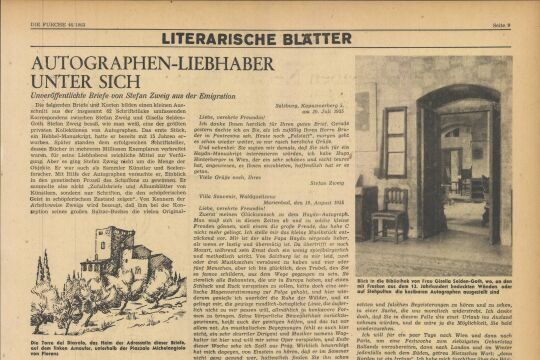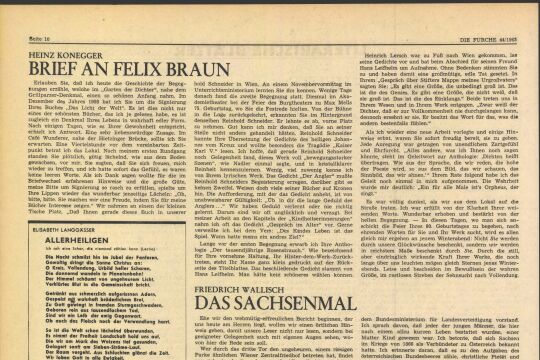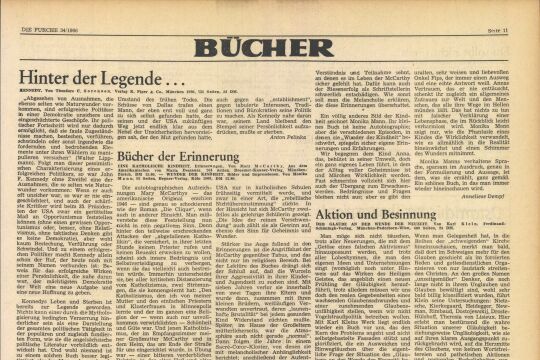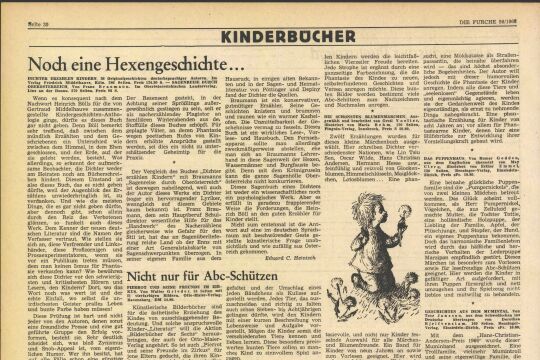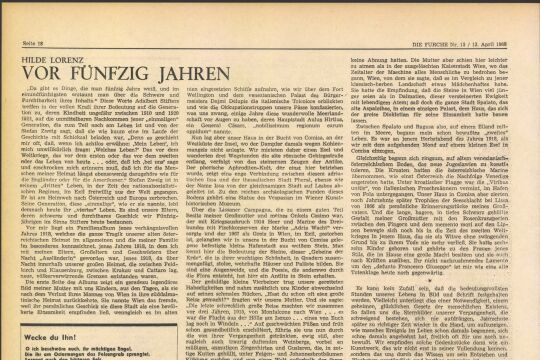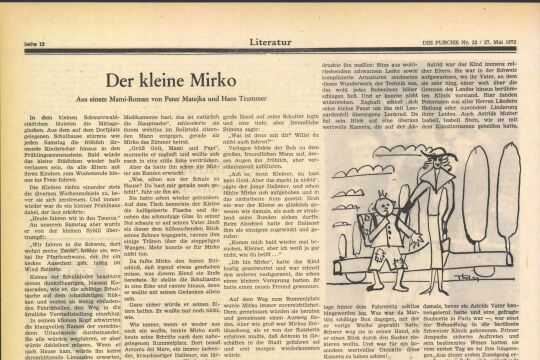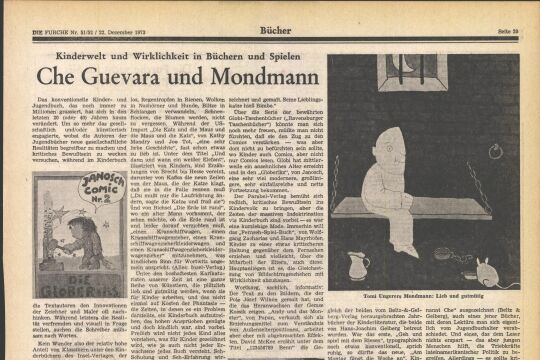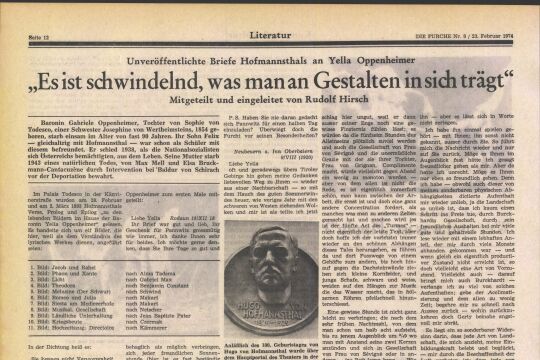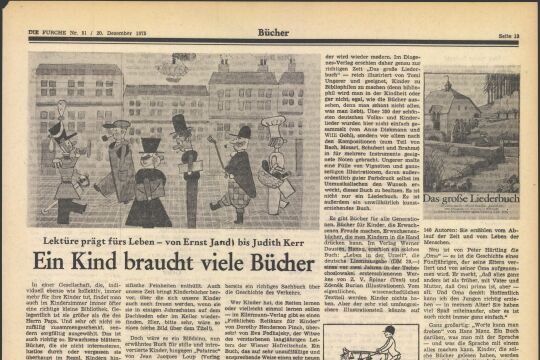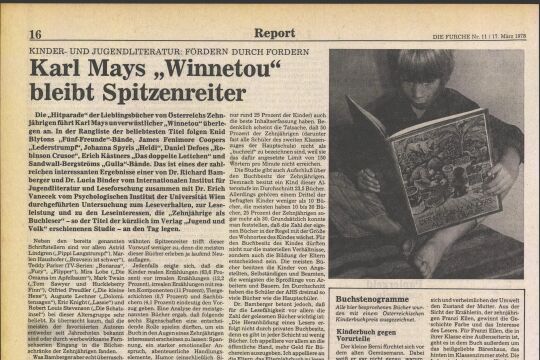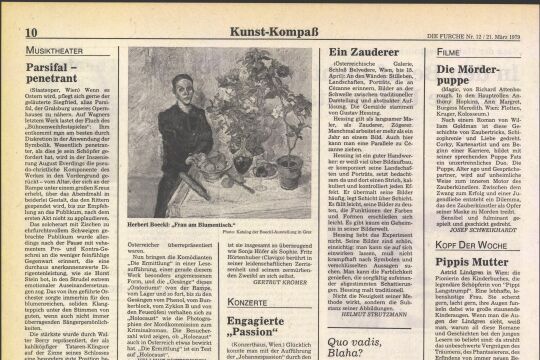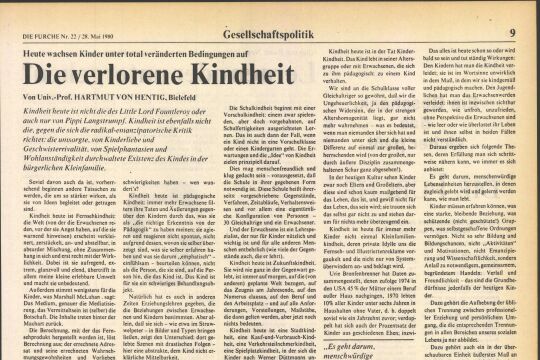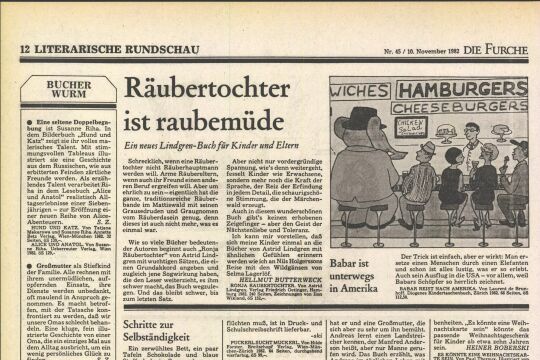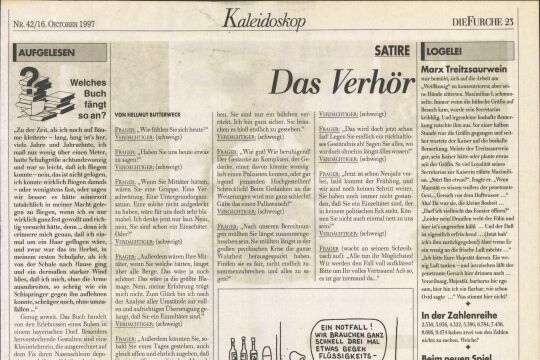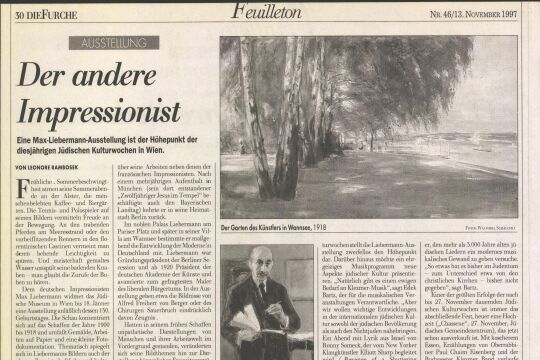Kind sein
DISKURS
Astrid Lindgren und die Kindheit: „Ihr Spiel würde niemals aufhören“
Entschwundenes Land oder lebenslanger Zufluchtsort: Wie kaum eine andere Autorin, ein anderer Autor hat Astrid Lindgren es verstanden, ihre eigene Kindheit als Ressource für ihr Schreiben fruchtbar zu machen.
Entschwundenes Land oder lebenslanger Zufluchtsort: Wie kaum eine andere Autorin, ein anderer Autor hat Astrid Lindgren es verstanden, ihre eigene Kindheit als Ressource für ihr Schreiben fruchtbar zu machen.
Unter dem poetischen Titel „Das entschwundene Land“ hat Astrid Lindgren die Liebesgeschichte ihrer Eltern literarisiert – und damit auch ein Stück weit ihre eigene Kindheit, erlebt in „Geborgenheit und Freiheit“.
Kindheit und Kinderliteratur haben naheliegenderweise immer viel miteinander zu tun, im Fall von Astrid Lindgren jedoch gibt es ein besonderes Naheverhältnis: Wie kaum eine andere Autorin, ein anderer Autor hat sie es verstanden, ihre eigene Kindheit als Ressource für ihr Schreiben fruchtbar zu machen. Nicht nur, dass viele ihrer Geschichten leicht entschlüsselbar oder sogar explizit formuliert an realen Orten ihrer Kindheit nahe der südschwedischen Kleinstadt Vimmerby spielen; vielmehr ist das literarische Re-Inszenieren der Kindheit, deren Ende sie als schmerzlichen Verlust erlebte, ein zentrales und oft variiertes Motiv ihrer Werke.
Wichtigste Quelle dafür (darauf hat sie immer wieder hingewiesen) waren nicht reale Kinder oder etwa ihre eigenen, sondern vielmehr ihr eigenes erinnertes – mit heutiger psychologischer Terminologie formuliert – inneres Kind: „[...] es gibt kein anderes Kind, das mich inspirieren kann, als das Kind, das ich selbst einmal gewesen bin. Es ist überhaupt nicht nötig, eigene Kinder zu haben, um Kinderbücher schreiben zu können. Man muss nur selbst einmal Kind gewesen sein – und sich daran erinnern, wie das war.“
Erste schmerzhafte Erfahrungen
Astrid Lindgrens Kindheitsbilder mögen auf einen ersten, oberflächlichen Blick ungebrochen idyllisch wirken, wenn man an die unbeschwerten Abenteuer der Kinder von Bullerbü, den waghalsigen Michel aus Lönneberga und natürlich die allen gesellschaftlichen Konventionen und pädagogischen Zugriffsversuchen trotzende Pippi Langstrumpf denkt. Bei genauerer Lektüre des Werkes zeigt sich Kindheit aber auch als eine Lebensphase, in der unvermeidbar eine jeweils erste Begegnung mit schmerzhaften Lebenserfahrungen zu durchleben ist.
Da gibt es Kinder mit unheilbaren Krankheiten wie Göran in „Im Land der Dämmerung“, der seit einem ganzen Jahr mit einem kranken Bein im Bett liegt. Die abendlichen Besuche von Herrn Lilienstengel, der fliegen kann, bringen zwar Trost und Ablenkung, aber keine wundersame Heilung. Da gibt es einen liebevoll aufgezogenen kleinen Drachen in „Der Drache mit den roten Augen“, der am Ende seiner Bestimmung folgt und glücklich in den Sonnenuntergang fliegt, während das erzählende Kind an diesem Abend kein Märchen liest, sondern unter der Decke um den Drachen trauert. Und da gibt es Väter wie den starken Räuberhauptmann Mattis in „Ronja Räubertochter“, der untröstlich über den Tod eines alten Freundes weint.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!