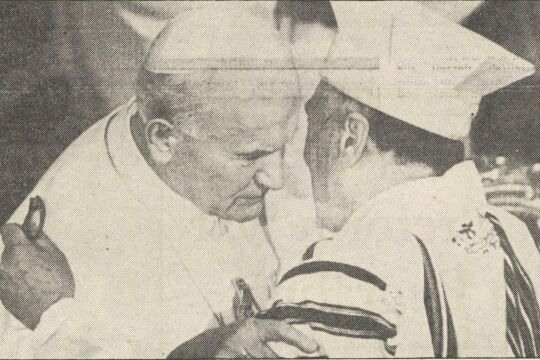Die Stadt an der Schelde ist das Symbol jüdischen Lebens in Belgien. Doch Perspektivlosigkeit und Antisemitismus lassen viele emigrieren.
Die Zeugnisse des Niedergangs stehen in einer Ecke. Massive Apparate zur Behandlung von Diamanten, teure Spezialgeräte, ausrangiert. Wolf Ollech hat dafür keine Verwendung mehr, denn „der Diamant“, wie er sagt, zieht weg aus Antwerpen. Man muss das relativieren: Zwar hat die Wirtschaftskrise 2008 und 2009 auch die Diamantenbranche schwer getroffen, doch im Bahnhofsviertel von Antwerpen reiht sich noch immer ein Juweliergeschäft ans nächste. Auch die Börse besteht selbstverständlich noch, und in der schwer bewachten Hoveniersstraat, wo das Herz der Szene schlägt, ist es hektisch wie eh und je. Rund 80 Prozent der rohen und die Hälfte aller geschliffenen Steine passieren die weltweite Diamanthauptstadt. Allein die Produktion hat sich verlagert: Seit Jahren drängen immer mehr Akteure aus Indien auf den Markt, die Steine in Niedriglohnländern bearbeiten lassen. Viele der Juden, die in Antwerpen einst 90 Prozent des Sektors ausmachten, sind nicht mehr konkurrenzfähig.
Schwindendes Geschäftsfeld
Nicht nur zahlreiche Arbeitsplätze, ganze Berufe sind dadurch verschwunden. „Die Spalter zum Beispiel“, erzählt Wolf Ollech, der selbst eine Schleiferei mitten im Diamantenviertel betreibt. „Vor 20 Jahren gab es hier Hunderte von ihnen. Jetzt werden Steine mit einem Laser durchgebrannt. Früher brauchte man dazu enormes Wissen über ihre Kristallisation. Damals war es ein Handwerk. Heute ist es eine Technologie.“ Wolf Ollech, 54, leidet auch unter dieser Entwicklung. Einst beschäftigte er 40 Mitarbeiter, heute sind es noch vier. Die meisten Schleifbänke in seiner Werkstatt stehen leer. 25 Jahre lang lief sein Geschäft hervorragend, seit fünf Jahren wird es immer schwieriger. Ollech sieht das dennoch nüchtern: Dass die Großen die Kleinen vom Markt verdrängen, ist schließlich ein weltweites Phänomen. Einst fraßen die Supermärkte die Lebensmittelhändler. Und nun verschwindet der Diamant aus Antwerpen.
Gleichzeitig weiß Wolf Ollech natürlich, dass dies einschneidende Folgen hat. „Oh ja“, seufzt er auf die Frage, ob sich die Veränderungen in seinem Umfeld bemerkbar machen. Viele ehemalige Kollegen hätten keine Arbeit mehr. Im jüdischen Antwerpen, über Generationen von einer Diamanten- Monokultur geprägt, geht man inzwischen Tätigkeiten nach, an die man vor 20 Jahren noch keinen Gedanken verschwendet hätte. Sagt Wolf Ollech, und der muss es wissen: Sein Bruder wechselte „vom Diamant“ in die Kältetechnik. Und sein Sohn hat sich als Bodenleger selbstständig gemacht. Ollech selbst wurde einst von seinem Vater in den Diamantsektor eingeführt. Von ihm lernte er sein Fach, so wie es früher üblich war.
Leben jenseits des Diamanten
Längst nicht alle passen sich den neuen Begebenheiten schnell an. Alexander Zanzer, Direktor des jüdischen Wohlfahrtswerks De Centrale, erzählt von enormen Schwierigkeiten in der jüdischen Gemeinschaft: „Sozial, finanziell und psychologisch.“ Die 110 Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, seit zu dem Altenheim, das 30 Menschen Platz bietet, Ferienzentrum und mobiler Haushaltshilfe zahlreiche Sozialfälle kamen. Die Verarmung vieler Familien spürt die Organisation, die in diesem Jahr 90 Jahre wird, auch in der eigenen Kasse: „Wenn wir früher ein Wohltätigkeitsdinner ausrichteten, hatten wir danach genug Geld für den Rest des Jahres. Heute reichen die Spenden nicht einmal für einen Monat.“
Zanzer, 65, fordert ein rasches Umdenken – weg von der Abhängigkeit von einem Sektor. „Der Diamant war ein bequemes Kissen. Die jüdische Gemeinschaft blühte, weil der Diamant blühte. Aber das ist vorbei und wird nicht mehr zurück kommen. Nur verstehen das noch nicht alle. Manche denken noch immer, dass die Zeiten wieder besser werden. Das Problem ist, dass es keine Alternativen gibt. Die Jungen müssen studieren, um andere Jobs zu finden. Wir müssen einen Weg finden, um jüdische Menschen jenseits des Diamanten auszubilden.“
Besonders drastisch ist das Problem in den Kreisen chassidischer Juden, die mit schwarzem Mantel, Hut, Bart und Schläfenlocken nicht allein das Straßenbild beiderseits der Bahntrasse bestimmen. Just die Chassiden, fromme Orthodoxe, die ihr Leben vor allem dem Studium von Tora und Talmud widmen und meist kinderreiche Familien haben, sind von deren Veränderungen betroffen. Weltliche Bildung spielt bei ihnen oft eine untergeordnete Rolle. In Zeiten, als der Broterwerb selbstverständlich mit dem Diamantengeschäft bestritten wurde, waren Abschlusszeugnisse wichtig, aber nicht notwendig. Die Arbeit konnte zu Hause erledigt oder zumindest in ein der Religion gewidmetes Leben intergriert werden. Heute sind viele Chassiden in Weiterbildungsprogrammen beschäftigt, um ihnen Zugang zum Arbeitsmarkt zu vermitteln.
Flüchtende Jugend
Auch die meisten Menschen, denen De Centrale hilft, sind Chassiden. Was Alexander Zanzer jedoch zusätzlich beunruhigt, sind die weniger Orthodoxen. Die nämlich, jung und gut ausgebildet, verlassen die Scheldestadt. „18-Jährige gehen zum Studieren nach Israel, England, die USA, und kommen nicht mehr zurück. Heiraten Antwerpener Juden jemanden aus einer anderen Stadt, ziehen sie meist dorthin. Früher war dies genau umgekehrt.“ Verantwortlich dafür ist auch ein verloren gegangenes Gefühl von Sicherheit. Antisemitismus ist unter den Muslimen der Stadt verbreitet. Während des Gaza-Kriegs erreichten Drohungen und Übergriffe einen traurigen Höhepunkt. Gerade die starke öffentliche Präsenz, die jüdische Infrastruktur mit Synagogen, Gemeindezentren, Vereinigungen und Läden bietet Fundamentalisten ein leichtes Ziel. Enttäuscht ist Zanzer von der fehlenden politischen Reaktion. „Es ist eben kein jüdisches Problem, wenn die Menschen sich hier nicht mehr sicher fühlen. Es betrifft die ganze Gesellschaft.“
Jacques Wenger kann ein Lied von diesem Exodus singen. Als Sekretär der orthodoxen Gemeinde Shomre Hadas stellt er Zertifikate aus, die die Auswanderungswilligen als Juden ausweisen. Emigranten nach Israel können damit die Staatsbürgerschaft beantragen. „Keine Woche vergeht, ohne dass ich jemanden verabschiede“, sagt Wenger. In ihm löst das zwiespältige Gefühle aus. „Ich freue mich für die jungen Menschen, denn ich glaube, dass die Zukunft für Juden in Europa nicht sonderlich gut ist. Andererseits bin ich traurig. Ich sehe, wie Antwerpen langsam untergeht wie ein Boot. Es ist ein schönes jüdisches Leben hier, gut organisiert. 15.000 Menschen, aber jeder kennt jeden.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!