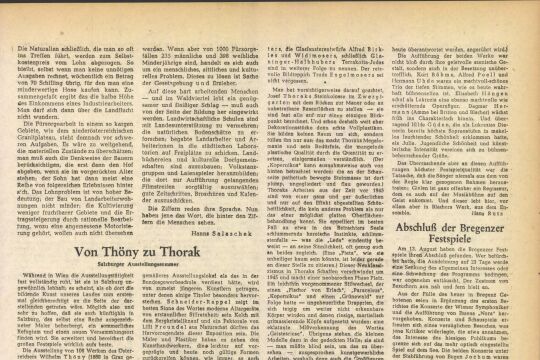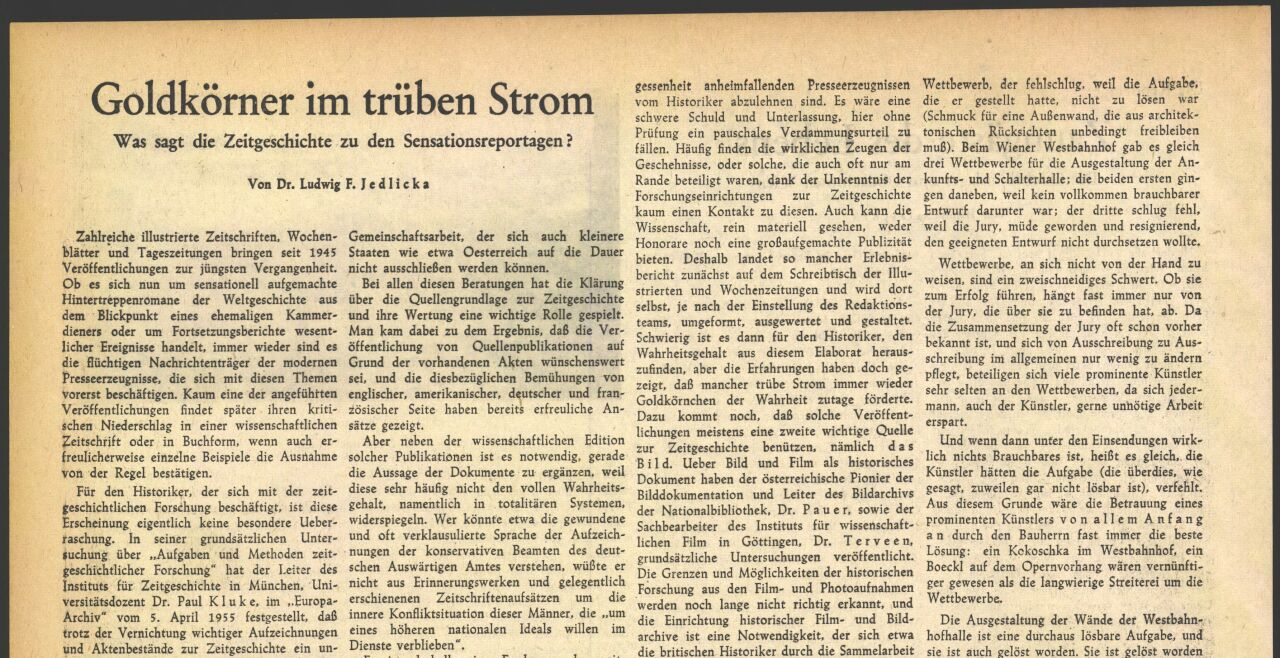
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Keine Kunst in der Bahnhofshalle ?
Die Säulen der griechischen Tempel wurden nicht erst Jahre nach ihrer Fertigstellung kan-nelliert, ihre Kapitelle nicht erst nachträglich verziert. Kein perikleisches Gesetz schrieb vor, daß nach Vollendung eines Bauwerkes zwei Prozent für die notleidenden hellenischen Künstler ausgeworfen werden müßten. So hatte die Kunst nur eine Chance: von Anfang an mit dabei zu sein, oder aber sich auf ihr eigenes Gebiet zu beschränken. Als spätere Zutat, als Zuckerüberguß über ein Bauwerk war sie nicht denkbar.
Auch die Figuren an den gotischen Domen wurden nicht an den Plätzen, die der Baumeister zufällig freigelassen hatte, angebracht, nachdem der Bau schon vollendet war; ihr Platz war ihnen von vornherein zugewiesen. In den Bauhütten, den zunftartigen Werkstattgemeinschaften des Mittelalters waren Baumeister, Steinmetze und alle Hilfskräfte beim Kathedralenbau zusammengefaßt; auch im Barock erwuchs die Arbeit aus den Werkstättengemeinschaften der Baumeister, Stukkateure und Freskenmaler. Keinem Freskenmaler wäre es eingefallen, sich im nachhinein ein freigebliebenes Plätzchen für seine Arbeit zu suchen.
In allen Zeiten, deren Bauwerke wir schätzen, waren Kunst und Architektur eines. Unserer Zeit blieb es vorbehalten, vorzuschreiben, daß bei jedem neuen Gebäude zwei Prozent der Bausumme (wenn es vom Lande, und ein Prozent, wenn es vom Bund errichtet wird) für die künstlerische Ausgestaltung ausgegeben werden sollen. Dieser Gedanke ist unglücklich. Im Grunde sollte die ganze Summe dafür ausgegeben werden, daß ein ordentliches, modernes Bauwerk entsteht, das seiner Funktion gerecht wird, das keine überflüssigen Ornamente bringt, das aber von sich aus, wenn es der Architekt in seinen wohlüberlegten Plänen vorsieht, auch Elemente der bildenden Kunst (im engeren Sinne) aufnimmt. Solche Elemente der bildenden Kunst sind nur sinnvoll, wenn sie einen organischen Teil des Gebäudes bilden, wenn sie selber eine Funktion haben. So werden Plastiken im Freien vor dem Wohnhause zu begrüßen sein, so lassen sich stilisierte „Haustiere“ an der Außenmauer vorstellen, so erfüllen Wandbilder in Bahnhofhallen, in den Wartesälen der Krankenkassen und Spitäler, in öffentlichen Verwaltungsgebäuden eine Aufgabe.
Die „Zwei-Prozent-Klausel“ wurde nicht geschaffen, um die an sich stillosen, wenig ausgeprägten Bauwerke, wie sie von Stadt und Land allgemein errichtet werden, nachträglich etwas lebendiger erscheinen zu lassen; der Gedanke wäre auch zu unsinnig. Nein, sie hat einen ganz anderen Grund: den notleidenden Künstlern auf diese Weise eine entsprechende Unterstützung zuzuwenden. Es wird heutzutage viel gebaut; für Bauunternehmungen stehen große Summen bereit. Es ist leichter, die Künstler, die nun einmal auf der Welt sind und nicht einfach aus ihr fortgeschafft werden können, von den Arbeiten, die ihnen im Rahmen großer Bauprojekte zugewiesen werden, zu erhalten, als ihnen ständig Subventionen zuzuweisen oder ihre Bilder zu kaufen. Der Gedanke der. „Zwei Prozent für die Kunst“ hatte also ursprünglich karitativ-soziale Motive. Was schon darin zum Ausdruck kommt, daß Staat und Land womöglich alle Künstler turnusmäßig zu solchen Aufträgen heranziehen. Zahl der Kinder und Krankheiten in der Familie spielen oft eine größere Rolle als die Begabung; vor allem ist die letztere für Behörden viel schwerer festzustellen.
Man darf sich also nicht wundern, wenn das meiste, das aus der „Zwei-Prozent-Klausel“ erwächst, Kompromißgeburten sind. Die Künstler machen ihre Vorschläge, so gut sie es können, die Auftraggeber reden ihnen drein, so gut sie es verstehen, die Künstler brauchen das Geld, sie müssen ja leben, die Künstler geben nach, die Bauherren bekommen ihre „Kunst“, und sind es zufrieden, wenn diese bei den Steuerzahlern keinen Anstoß erregt.
Zuweilen, bei größeren Projekten, insbesondere bei Bahnhöfen, gibt es öffentliche Wettbewerbe. Beim Wiener Südbahhhof gab es einen Wettbewerb, der fehlschlug, weil die Aufgabe, die er gestellt hatte, nicht zu lösen war (Schmuck für eine Außenwand, die aus architektonischen Rücksichten unbedingt freibleiben muß). Beim Wiener Westbahnhof gab es gleich drei Wettbewerbe für die Ausgestaltung der An-kunfts- und Schalterhalle; die beiden ersten gingen daneben, weil kein vollkommen brauchbarer Entwurf darunter war; der dritte schlug fehl, weil die Jury, müde geworden und resignierend, den geeigneten Entwurf nicht durchsetzen wollte.
Wettbewerbe, an sich nicht von der Hand zu weisen, sind ein zweischneidiges Schwert. Ob sie zum Erfolg führen, hängt fast immer nur von der Jury, die über sie zu befinden hat, ab. Da die Zusammensetzung der Jury oft schon vorher bekannt ist, und sich von Ausschreibung zu Ausschreibung im allgemeinen nur wenig zu ändern pflegt, beteiligen sich viele prominente Künstler sehr selten an den Wettbewerben, da sich jedermann, auch der Künstler, gerne unnötige Arbeit erspart.
Und wenn dann unter den Einsendungen wirklich nichts Brauchbares ist, heißt es gleich, die Künstler hätten die Aufgabe (die überdies, wie gesagt, zuweilen gar nicht lösbar ist), verfehlt. Aus diesem Grunde wäre die Betrauung eines prominenten Künstlers von allem Anfang a n durch den Bauherrn fast immer die beste Lösung: ein Kokoschka im Westbahnhof, ein Boeckl auf dem Opernvorhang wären vernünftiger gewesen als die langwierige Streiterei um die Wettbewerbe.
Die Ausgestaltung der Wände der Westbahnhofhalle ist eine durchaus lösbare Aufgabe, und sie ist auch gelöst worden. Sie ist gelöst worden durch einen Entwurf der Maler U n g e r und L e i n f e 11 n e r, der eine Gliederung der Wand durch schmale, verschiedentönige Platten- und Kachelbänder vorsieht, aus denen immer wieder einzelne Kacheln, rot oder blau, aufleuchten. In dieser Wandgliederung, die sich harmonisch in das Raumbild einfügen würde, können wir ein einfaches Sinnbild einer Bahn, einer Wegstrecke sehen; und wenn wir es nicht sehen wollen, so ergibt sie doch einen heiteren Eindruck — und das soll sie ja.
Das ist der eigentliche und einzige Zweck der Wandbilder in den öffentlichen Gebäuden, den Bahnhöfen, den Krankenkassen, in denen es so wenig zu lachen gibt: einen heiteren, gelösten, fröhlichen Eindruck zu vermitteln; solange man -auf den Zug, auf den Arzt oder auf den Kanzleibeamten wartet, die Zeit des Wartens ein wenig durch leuchtende, freundliche Farben, durch einfache unproblematische Formen zu erhellen. So scheinen die Arbeiten der „Fauves“ etwa, von Matisse zu Dufy, als ideale „Wandbilder“: mit ihren starken ungebrochenen Farbflächen, mit ihren einfachen, klar umrissenen, großzügigen Formen (die im Falle Dury noch von den Farbflächen durchdrungen werden), mit ihrer flächenhaften Betonung der Wandtektonik und dekorativen Wirkung und, nicht zuletzt, durch ihre Heiterkeit und Lebensfreude. Solche Wandbilder, ob sie nun al seeco, als Fresko oder als Mosaik (für das es, je nach Material, wieder verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt), geschaffen werden, haben eine Funktion zu erfüllen, sie sind sinnvoll. Auf sie ist von vornherein durch den Architekten — etwa durch die Führung des Lichtes, das auf die Wände fällt, auf denen sie sich dann befinden sollen — Rücksicht zu nehmen. Umgekehrt müssen sich die Bilder in ihrer Gliederung in den Raumcharakter einfügen. Erst aus dem Zusammenspiel der Arbeit von Architekt und Künstler wird ein Raum entstehen, in dem das Bild nicht Fremdkörper ist.
Nun hört man, daß der Plan, die Halle des Westbahnhofes mit einem Wandbild auszustatten, endgültig fallen gelassen wurde. Und daß, obwohl der Entwurf von Unger und Leinfellner ausdrücklich unter den anderen Einreichungen von der Jury hervorgehoben wurde, die aber leider nicht den Mut fand, sich für seine Verwirklichung einzusetzen.
Nun soll die Wand mit Marmor gekachelt werden — obwohl wir —, wie unlängst ein namhafter Kollege der beiden Künstler sarkastisch feststellte — ohnedies schon „soviel Marmor in Wien haben, daß er uns auf die Köpfe fällt“.
Trotz aller schlechten Erfahrung, die wir im Laufe der Jahre machen mußten, geben wir die Hoffnung nicht auf, das zu guter Letzt — Ende gut, alles gut, auch Endstation Westbahnhof gut — doch noch die Einsicht siegen wird, daß an ernste Wände weder billige Allegorien noch teurer Marmor gehört, sondern eine heitere Flächengestaltung.
Keine Sorge davor, daß der Entwurf vielleicht nicht „Ewigkeitswert“ besitzt. Auch Bahnhöfe werden von Zeit zu Zeit umgebaut und erneuert. In hundert Jahren werden die altmodischen Fahrgäste, die nicht mit dem Flugzeug reisen, sondern noch mit der Bahn fahren, sich über diesen Entwurf aus der „guten alten Zeit“ freuen, Feiern werden abgehalten werden und die Künstler, die jetzt um ihre Aufträge bangen, werden geehrt werden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!