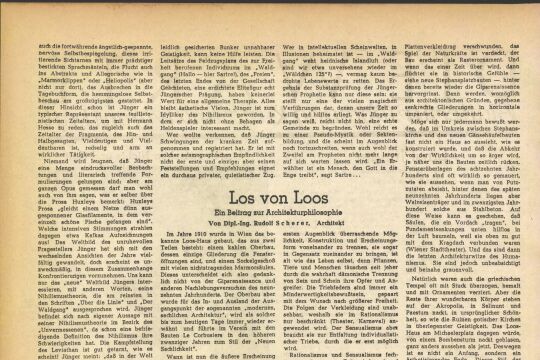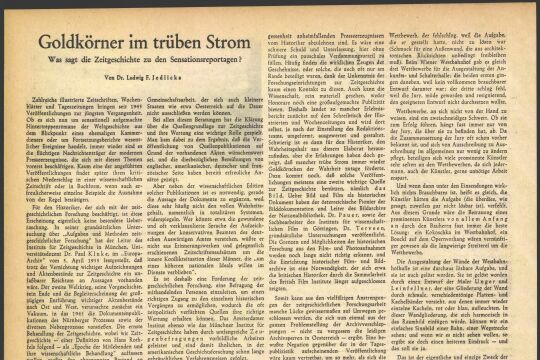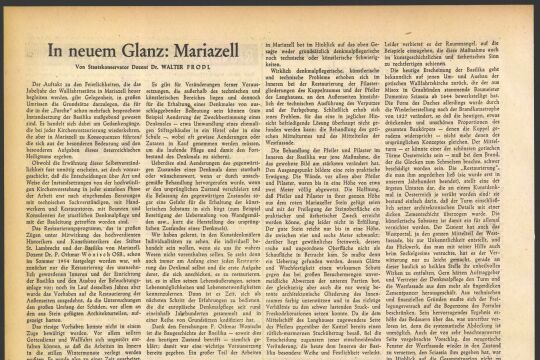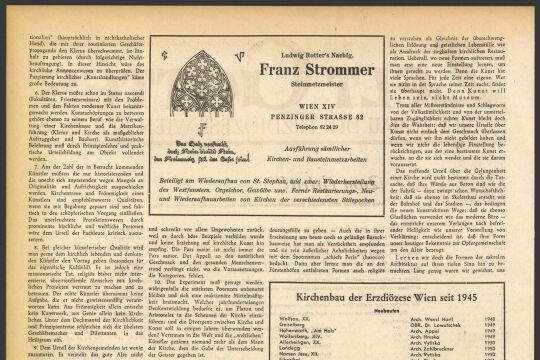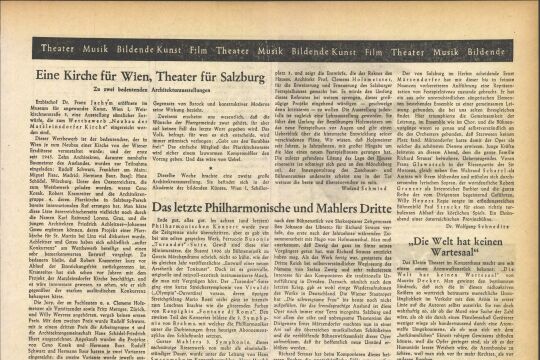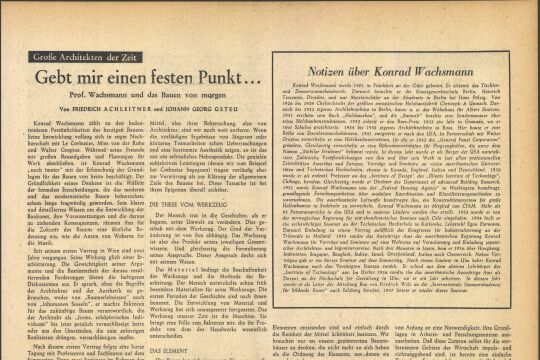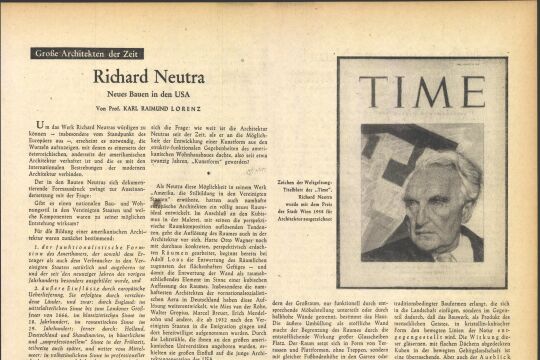Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kirchenbau als Symptom
Es ist keine Kleinigkeit, sich mehr als 100 Kirchen hintereinander anzusehen. Bei der Betrachtung so vieler Unikate — und von einer Kirche erwartet man schließlich, daß sie etwas Besonderes ist — könnte man zu dem Schluß kommen, hier gebe es keine Anhaltspunkte, hier sei alles möglich. Jede der in der „Internationalen Kirchenbauausstellung“ gezeigten Kirchen des 20. Jahrhunderts besitzt für sich Überzeugungskraft, aber nur deshalb, weil jede die Welt eines Architekten wirklich zum Ausdruck bringt— nicht für jeden ist alles möglich, wie viele Architekten glauben, die nichts zu sagen haben.
Neben den Unterschieden in den individuellen Architekturkonzepten ist noch ein anderer zu beachten: Man kann im Grunde nicht von einem „Kirchenbau des 20. Jahrhunderts“ wie von dem vergangener Jahrhunderte sprechen. Denn in der Begriffswelt der modernen Architektur hat die Kirche als Bauaufgabe sehr verschiedene Rollen gespielt.
Der größte Teil der historischen Architektur war Sakralbau schlechthin, oder doch Sakralbau in Polarität mit anderen bestimmenden Aufgaben. Daß dies nicht mehr der Fall ist, mußte spätestens in den wachsenden Großstädten der Gründerzeit offenbar werden, als die großen Kirchenbauten des Historismus, auf aus dem Straßenraster ausgesparten Blöcken errichtet, nicht einmal imstande waren, wirklich öffentliches Leben anzuziehen.
Folgerichtig war für die Theorie des neuen Bauens der Kirchenbau kein Thema. Aus der klassischen Zeit der modernen Architektur gibt es keine Kirchenbauten, zumindest keine solchen, die in ihrer Entwicklung irgendeine Rolle spielen. Es war damals schwer vorstellbar, daß das neue Zeitgefühl in einem Kultbau seinen Ausdruck finden könnte.
Anderseits ist die erste Jahrhunderthälfte jene Zeit gewesen, in der die Vorstellung vom „Kirchenbauer“ aufgetaucht ist, vom Architekten, dessen „Gebiet“ der Bau von Kirchen ist und der in dieser Bauaufgabe seine eigentliche Vollendung findet. Diese Vorstellung ist etwa mit den Namen Dominikus Böhm, Otto Bartning, Rudolf Schwarz verbunden. Charakteristisch für diese Architekten ist, daß sie eigentlich auch religiöse Denker waren, und daß sie als Einzelgänger zu den Problemen des neuen Bauens nichts beitrugen. Daß religiöse Versenkung mit technischen Höchstleistungen gepaart sein kann, zeigt das Werk
Antonio Gaudis, dessen experimentelle statische Methoden allerdings erst in jüngster Zeit wieder gewürdigt werden.
Eine „Entideologisierung“
Schließlich aber gibt es Bauten, die eigentlich nur zufällig Kirchen sind — und trotzdem zu den bedeutendsten gehören. Ein solcher Bau ist die Steinhofkirche Otto Wagners in Wien. Wagner war ungläubig, aber er sah in der Aufgabenstellung des Kirchenbaues eine Möglichkeit, seine Raumvorstellungen zu realisieren. Bekanntlich hat man der Steinhofkirche wiederholt nachgesagt, sie sei eigentlich heidnisch. Otto Wagner hat aber mit diesem Bau, den selbst
Rudolf Schwarz als „die erste moderne Kirche“ gerühmt hat, und mit seinen leider unausgeführten anderen Kirchenentwürfen einen Schritt getan, der auch auf den Frömmigkeitsstil nicht ohne Einfluß bleiben konnte. Adolf Loos’ einziges Kirchenprojekt ist verschollen; wir wissen nur, daß es bloß Anlaß für eine städtebauliche Idee war: für die Errichtung eines Turmes in der Achse der Reichsbrücke.
Eine ähnliche „Entideologisierung“ des Kirchenbaues hat erst wieder nach dem zweiten Weltkrieg stattgefunden: Mies van der Rohes Hochschulkapelle in Chikago und Le Corbusiers Wallfahrtskirche in Ron- champ sind gleichermaßen Mark steine auf dem „Gebiet“ des Kirchenbaues wie in der allgemeinen Architekturgeschichte. Hier haben zwei Exponenten des neuen Bauens keine Hemmungen mehr gehabt, sich dieser Aufgabe anzunehmen. Ähnlich erfrischend mutet die für Lourdes von Pierre Vago und anderen errichtete unterirdische Kirche an, bei der allein die Probleme des großen Fassungsraums (20.000 Personen) zu einer für einen Kirchenbau ungewöhnlichen Gestalt führten.
Eine solche Entideologisierung ist schon um der Einsicht willen angebracht, daß ja der theologische Gehalt des Gotteshauses in jedem Fall von der architektonischen Qualität unabhängig ist. Auch die Verantwortung der katholischen Kirche ist streng genommen zu teilen in jene für die Seelsorge und jene kulturelle Verantwortung, die einem so großen Bauträger wie die Kirchen für die Gestalt der Kubatur zukommt, die er dem Volke hinstellt; oder die er ihm Bauträger wie der Kirche für die Preisgabe der Wiener Florianikirche, daß ihre seelsorgliche Notwendigkeit nicht mehr gegeben sei, ist daher nicht ausreichend gewesen.
Der österreichische Grundriß
In der Kirchenbauausstellung ist die ungeheure Vielfalt des gesammelten Materials nach einem äußeren Prinzip gegliedert, nämlich nach Grundrißtypen (Rechteck-, L- und T-Form, Quadrat, Kreuz, Kreis, Trapez, Oval, unregelmäßige Formen), das sich gerade für Vergleiche jeder Art vorzüglich eignet. Es wird damit auch vermieden, eine bestimmte Tendenz als die modernste zu propagieren. Darum sei aber hier auf einen Zusammenhang hingewiesen, der bei der Betrachtung österreichischer Arbeiten aus den letzten zehn Jahren auf fällt.
Seit dem (unausgeführten) Entwurf der Arbeitsgruppe 4 für die neue Matzleinsdorfer Kirche (1957) oder schön seit dem Bau der Kirche in Salzburg-Parsch (1953 bis 1956) ist unter den jungen österreichischen Architekten eine Auseinandersetzung im Gange, die um das Thema einer quadratischen, kreuzförmigen,
zuweilen breitgelagerten, jedenfalls aber symmetrischen Kirchengrundrißform mit zentriertem Altar kreist. Etwa 20 Entwürfe und ausgeführte Bauten (wenige davon!) von der Arbeitsgruppe 4, Johann Georg Gsteu, Viktor Hufnagl, Josef Lack- ner, Ferdinand Schuster, Ottokar Uhl können unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden.
Der „geschlossene“ Raum dominiert
Der quadratische oder kreuzförmige, symmetrische Grundriß entspricht einer Gedankenwelt, die die Ordnung des rechten Winkels schätzt, die — unter dem Einfluß Konrad Wachsmanns — ihre Aufmerksamkeit der Konstruktion, der wiederholbaren Struktur (häufig an den Decken der Kirchenräume ablesbar) zugewendet hat; einer Gedankenwelt, die anderseits aber einer gewissen Konsolidierung des Raum gefühls zustrebt, das heißt dem „fließenden“, „transparenten“ Raum der Zwischenkriegszeit den geschlossenen, definierten vorzieht.
Daß dieses Raumideal neueren Forderungen der Liturgie — wie Anordnung der Gemeinde rund oder halbrund um den Altar, Trennung von Wortgottesdienst, Opfergottesdienst und Eucharistiefeier — entgegenkommt, ist eigentlich ein Widerspruch, weil eben diese Forde rungen ja das Ziel haben, die Liturgie aus Konventionen zu befreien. Herbert Muck SJ. zeigt in dem Abschnitt der Ausstellung, der sich mit Liturgie beschäftigt, bezeichnender-- weise vorwiegend asymmetrische Funktionsschemata. Ein unsymmetrischer Entwurf wie der Lois Welzenbachers für Plauen (1931) wäre für eine solche Befreiung ein direkterer Ausdruck. Man kann diesen Gegensatz aber auch so sehen, daß ein definierter Raum diese Befreiung erst richtig sichtbar machen könnte.
Von hier ausgehend sind zahlreiche Überlegungen allgemeiner Art möglich, die den Kirchenbau nicht mehr betreffen. Man kann aber sehen, daß der Kirchenbau zwar nicht Zentrum der Architekturentwicklung ist, aber keineswegs mehr an ihrem Rand stehen muß, sondern vielmehr daß allgemeine Tendenzen sich hier besonders deutlich ausdrücken können.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!