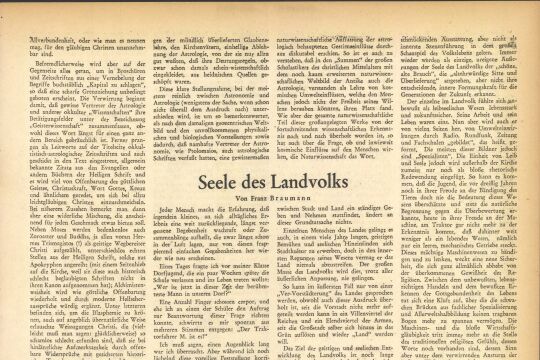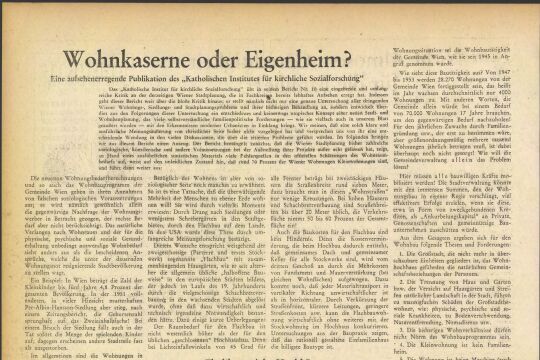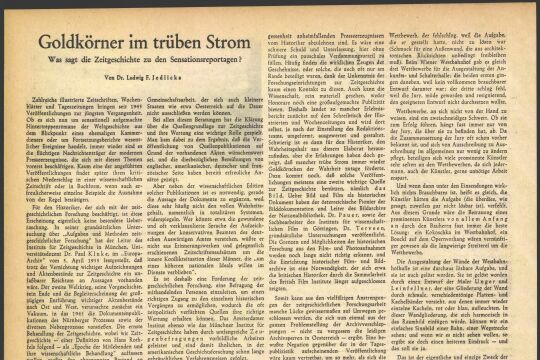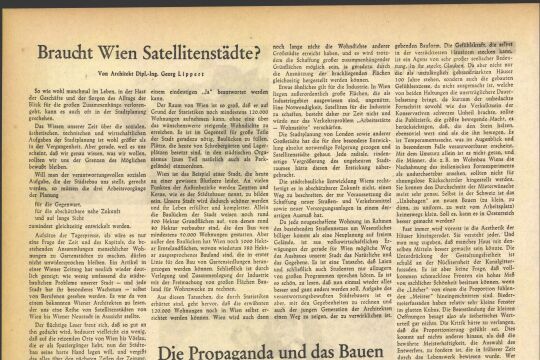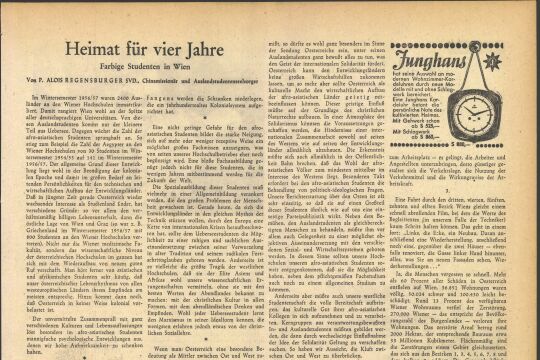Vorbemerkung: In diesem Aufsatz werden einige harte Worte gesagt. Es ist notwendig, daß sie einmal offen ausgesprochen werden.
Von zwei Punkten aus betrachtet, gefallen uns die Gemeindebauten xnicht: 1. von außen; 2. van innen.
Was an den Gemeindebauten von außen stört, ist, daß sie alle, ob sie nun in Meidling oder in Floridsdorf, inmitten einer Häuserzeile oder in einer in sich geschlossenen größeren Anlage stehen, immer nahezu gleich ausschauen — so, als wären sie alle nach den Plänen eines einzigen Architekten erbaut, der auf eine einzige Form des Gemeindewohnhauses eingeschworen ist, von der er um keinen Preis abrücken will. Diese Form ist ziemlich einfallslos. Immer wiederholt, wirkt sie eintönig. Sie weiter zu wiederholen, ist der sicherste Weg, Wien nie zur Weltstadt werden zu lassen.
Was an den Gemeindebauten von außen weiter stört, sind die meist ziemlich unpassend „aufgeklebten“ künstlerischen Wandschmuckversuche, die sich oft in billigen Allegorien verlieren oder mit einem abstrakten Bandmuster begnügen. Erst zwei in jüngster Zeit eingereichte Entwürfe — der eine sieht Schmetterlinge, der andere Raben als „Haustiere“ vor — konnten restlos befriedigen.
Was an den Gemeindebauten von innen stört, ist ihre billige, allzu billige Installation — die in den meisten Fällen lieblos „zusammengeschustert“ wurde. Es beginnt damit, daß an Stelle der elektrischen Glocke eine primitive mechanische Klingel angebracht ist. Der Briefkasten besteht aus einem Schlitz in der Wohnungstür; der Kasten fehlt, die Briefe fallen auf den Boden. (Luxus, so ein Briefkasten, was?) Die Türschnallen sind mitunter so seltsam konstruiert, daß man sie um mehr als 90 Grad drehen muß, ehe sich die Tür öffnen läßt. Schlösser fehlen oft überhaupt, was bei kinderreichen Familien ein Jammer ist. An Stelle eines Badezimmers findet sich, auch bei größeren Wohnungen mit etwa vier Zimmern, oft nur eine Brausegelegenheit; die Wohnpartei kann sich, wenn sie will, auf eigene Kosten eine Sitzbadewanne anschaffen; eine richtige Badewanne hätte ja keinen Platz. Die elektrischen Installationen sind auch billig; oft liegen die Kabel direkt unter Verputz; ein Elektriker sagte einmal: „In höchstens neun, zehn Jahren ist das alles kaputt.“
Was an den Gemeindehäusern über die genannten Mängel hinaus aber am meisten stört, sind die dünnen Wände, durch die man beinahe jedes Wort von den Nachbarn herüberhören kann. Drei und mehr Radioapparate vereinigen ihre Stimmen zu einem jämmerlichen Katzenkonzert; „Zimmerlautstärke“ gibt es ja nicht, Zimmerlautstärke bedeutet immer auch schon: „Stockwerklautstärke“; die Fenster kann man nie offen lassen, weil dann die Katzenmusik und der Lärm von Stimmen ununterbrochen hereindringt.
Wer ist an diesen Zuständen schuld?
1. Die Gemeinde Wien.
2. Die Architekten.
Die „Schuldfrage“ kann am leichtesten geklärt werden, wenn wir einmal die Entstehungsgeschichte eines Gemeindebaues von seiner Planung bis zu seiner Vollendung verfolgen.
Es beginnt damit, daß Wien keine Stadtplanung besitzt. Zwar hat Wien nach dem Abgang des Stadtplaners Prof. Karl H. Brunner — mit dessen Projekten wir keineswegs einverstanden waren — Ing. Schimka auf diesen Posten berufen — aber dem Stadtplaner sind die Hände gebunden. Von großzügigen Neuplanungen hört man kein Wort. Es wird immer nur auf kurze Sicht, auf wenige Jahre (wenn überhaupt so lange!) geplant.
Dies ist das erste Manko. Gäbe es eine Planung auf längere Sicht, so könnte festgelegt werden, wo, wie und wodurch der Wohnraumnot auf befriedigende Weise abzuhelfen ist. Ein solcher Plan müßte natürlich vielerlei Elemente berücksichtigen, von denen hier nur einige wenige angedeutet werden können. So wäre einmal an die Zahl der vorgemerkten Wohnungssuchenden, an den zu erwartenden Anfall neuer Wohnungssuchender (junger Ehepaare usw.) in den nächsten zehn Jahrn etwa zu denken; dann an die freien Bauflächen innerhalb der Stadt (die Landnot in der Stadt ist groß!) und am Rande der Stadt; dann an den Ausbau der Verbindungslinien zu größeren Siedlungen am Stadtrand: an die Budgetfrage, wieviel in einem Jahr für den Wohnungsbau, und was indirekt mit ihm zusammenhängt, ausgegeben werden kann; wobei die Ueberlegung, was mit diesem Betrag maximal erreicht werden kann, eine Rolle spielen sollte; dann müßte man sich darüber klarwerden, welche Hausform die günstigste ist und am ehesten ein familiengerechtes Wohnen ermöglicht; ob nicht in vielen Fällen das ebenerdige Einfamilienwohnhaus dem Stockbau vorzuziehen ist (man denke nur an die interessanten Statistiken, mit denen Prof. Roland Rainer die Vorzüge solcher ebenerdiger Wohnhäuser nachgewiesen hat). Das alles sind Punkte, über die nachgedacht werden sollte, die zueinander in ein System gebracht werden müßten, das Kompromisse zwischen entgegengesetzten Interessen, zwischen den Möglichkeiten eines beschränkten Budgets und den Forderungen an Wohnkultur, zwischen Wohnraumnot und Stadt- und Landschaftsgestaltung herbeiführt.
Gewiß gibt es ein städtisches Bauamt, eine Forschungsstelle, die sich mit dem Bau- und Wohnungswesen befaßt (diese hat zur Normung der Installationen, Fenster - usw. beigetragen), eine Arbeitsgemeinschaft für Raumplanung, die alle nicht untätig sind; und ihre Tätigkeit läßt sich gewiß auch mit „Stadtplanung“ bezeichnen; denken wir da nur an die vortreffliche Studie über die Sanierung des Weidlingtales, eine Kollektivarbeit junger Stadtplaner des städtischen Bauamtes, die sich mit der Sanierung des Stadtrandes, mit den wilden Siedlungen an den Hängen des Wienerwaldes befaßte.
Aber all das sind Einzelaktionen; es geht nicht bloß um das Weidlingtal, es geht tim Wien; und es geht nicht bloß um Studien, die einige vernünftige Vorschläge entwickeln, sondern darum, daß diese Vorschläge verwirklicht werden.
Daß eine Stadtplanung auf längere Sicht heute unmöglich ist — und nur auf sie käme es an —, beweist eine Feststellung Stadtrat Thallers, des Baureferenten der Gemeinde Wien, der vor einiger Zeit sagte, daß es jährlich der allergrößten Anstrengungen bedürfe, um nur einigermaßen zeitgerecht den notwendigen Baugrund für das Wohnbauprogramm sicherzustellen. Ein vernünftiges Landbeschaffungsgesetz, wie es in der deutschen Bundesrepublik schon beschlossen wurde, sei eine Forderung der Zeit.
Man sieht also: einer großzügigen Stadtplanung sind beide Hände gebunden; es kann nur von beute auf morgen improvisiert werden; es macht bereits Schwierigkeiten, den jährlichen Bedarf an Baugrund zeitgerecht zu beschaffen.
Nach dieser kleinen Abschweifung, die nötig war, um unsere Behauptung, es gäbe heute keine großzügige Stadtplanung, die auf weite Sicht arbeitet, wenigstens andeutungsweise zu erhärten, zurück zum Bau eines Gemeindehauses!
Der Architekt, der sich um einen Gemeindeauftrag bewirbt und ihn bekommt, erhält einen „Bebauungsplan“. Dieser Bebauungsplan ist so ziemlich unumstößlich; es wäre für den Architekten eine müßige Angelegenheit, über ihn streiten zu wollen.
Dieser Bebauungsplan schreibt die Struktur des ganzen Hauses vor. Also:
1. Die genaue Lage des Hauses (detaillierter Flächenwidmungsplan), bei Hauskomplexen die genaue Lage jedes einzelnen Hauses.
2. Die Zahl der Stockwerke und die Höhe des Hauses.
3. Die Zahl der Wohnungen.
4. Die verschiedenen Wohnungstypen.
Es gibt etwa sieben verschiedene genormte Wohnungstypen (Typenbezeichnung: A, B usw.), von der Garconniere bis zur Vier-Zimmer-Wohnung, die sich durch Zahl der Zimmer und ihre Quadratmetergröße linterscheiden.
Aber nicht nur die Wohnungstypen, auch die Installationstypen, Größe, Zahl und Typen der Fenster, der Türen usw. sind genormt. Gegen eine solche Normung wäre nichts einzuwenden, wenn sie vernünftig wäre, wenn sie nicht nach dem Prinzip „alles so billig wie möglich“ geschaffen worden wäre. Nun sind die Handwerker auf die genormten Typen „eingefuchst“, und es ist schwer, von ihnen abzugehen, da der Architekt ja an die Arbeit der Handwerker gebunden ist.
Es gibt keine Variabilität der Haustypen, die auf den Bebauungsplänen vorgesehen sind. Und doch wird es jedermann einleuchten, daß die Wohnungen in einem Hause anders gegliedert sein müssen, wenn es sich in der Nord-SüdRichtung erstreckt, als wenn es in der Ost-West-Richtung liegt. Hier sollte es also mindestens Ost-West- und Nord-Süd-Typen geben.
In einem Stockwerk liegen fast immer drei Wohnungen (an einer Stiege); das führt zwangsläufig dazu, daß eine der drei Wohnungen benachteiligt sein wird, weniger Sonne haben wird usw.
Dazu kommt noch, daß, da ja in einem Hause mehr als drei Wohnungstypen untergebracht werden müssen, die Installationen nicht übereinstimmen; in den oberen Stockwerken sind etwa vier, fünf Wohnungen (Garconnieren usw.) untergebracht, die natürlich dieselben Installationseinheiten benötigen wie die unter ihnen liegenden „Dreispänner“. Uns schiene die Schaffung eigener Junggesellenhäuser, in denen sich nur Garconnieren befinden, sinnvoller.
Die Arbeit, die dem Architekten nunmehr obliegt, ist also reine Linierarbeit, ..Märklin-Arbeit“, wie sie in Fachkreisen genannt wird: denn wie der Bub aus den vorgegebenen Teilen des Märklin-Kastens seine Werke zusammensetzt, so hat der Architekt jetzt die vorceseheuen Wohnungen so zusammenzustöppeln, daß es sich gerade mit der vorgegebenen Zahl der Stockwerke ausgeht ->■ wahrlich keine schöpferische Tätigkeit mehr.
So erscheint uns die Tatsache, daß die Gemeinde Wien überhaupt noch Architekten heranzieht, reines Mäzenatentum gegenüber einem nicht gerade unbegüterten Berufsstande. Die Entwicklung wird zweifellos einmal dahin führen, daß angestellte Architekten diese Linierarbeit, die jetzt als „Heimarbeit“ vergeben wird, selber machen werden.
Das Architektenhonorar beträgt ungefähr 100.000 Schilling für etwa 80 Wohneinheiten. Schon aus diesem Grunde liegt es im Interesse des Architekten, nicht am Bebauungsplan zu rütteln und die Zahl der vorgesehenen Wohnungen nicht herabzusetzen; eher, so er das vermag, noch mehr unterzubringen ...
Mit der Uebergabe der detaillierten „Ausführungspläne“ — eines eigenen Ausführungsplanes für jedes Stockwerk — ist die eigentliche Ar“.hitektentätigkeit beendet. Bauherr ist die Gemeinde Wien, die auch als Eigentümerin von Ziegelwerken die Ziegel bereitstellt.
Die. Gemeinde vergibt die Aufträge für die Ausführung der Gemeindebauten vorwiegend an die „Bestbieter“ (recte: Billigstbieter). Das verführt viele Baufirmen dazu, möglichst billig zu kalkulieren, um „konkurrenzfähig“ zu bleiben und die Chance zu haben, den Auftrag zu erhalten. Was in diesem Sommer dann dazu führte, daß viele Gemeindehäuser halbfertig im Bau steckenblieben; die Materialkosten waren gestiegen, die Arbeitslöhne um etwa 15 Prozent höher geworden. Alle Versuche, eine nachträgliche Erhöhung der Beträge zu erhalten, scheiterten. So mußten viele Firmen die Aufträge niederlegen — teilweise auch dann, als sie schon begonnen hatten, weil der Schaden, der ihnen durch eine Fortführung der Arbeiten entstanden wäre, größer zu werden drohte, als die Einbuße, die sie durch die vorzeitige Niederlegung erlitten.
Die Baufirmen, die diese angefangenen Bauten dann von der Gemeinde zur Fertigstellung über nahmen, verlangten ungefähr um 20 Prozent mehr, als die ursprünglich kalkulierte Bausumme betrug. ,
Die Bauwirtschaft hat bis jetzt vergeblich bei der Gemeinde Wien für ein Auftragssystem nach Schweizer Muster plädiert. Dort werden bei Ausschreibungen das höchste und das niederste eingereichte Offert von vorneherein gestrichen, aus den übrigen wird ein mittlerer-Durchschnitt errechnet. Wer diesem Durchschnitt am nächsten kommt, erhält dann den Auftrag.
Das ist, in wenigen Zügen, die Entstehung eines Gemeindebaues.
Es beginnt mit der fehlenden Stadtplanung.
Es setzt sich fort bei den Architekten, die die ihnen vorgeschriebenen unzureichenden Bebauungspläne nicht einfach generell zurückweisen.
Es endet bei der Durchführung der. Bauten nach dem „Bestbietsystem“. Der Ring schließt sich.
(Ein zweiter Aufsatz folgt)