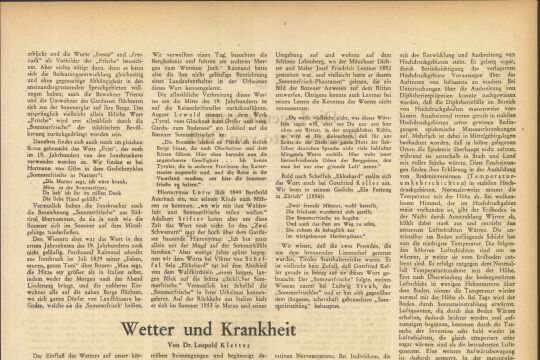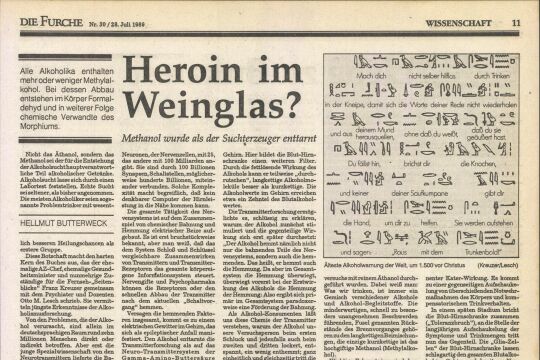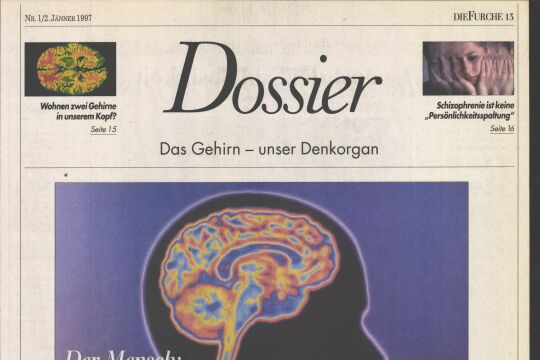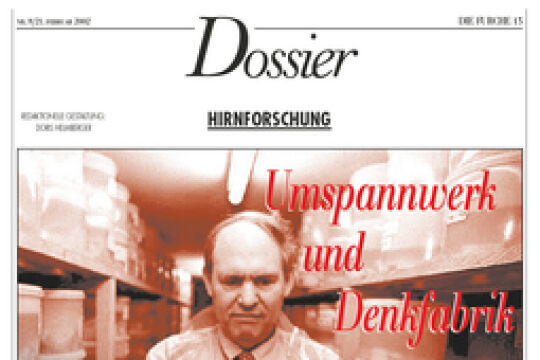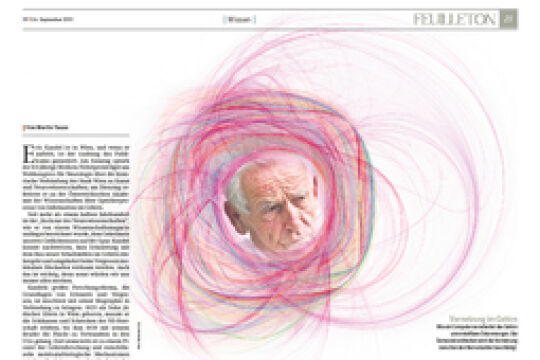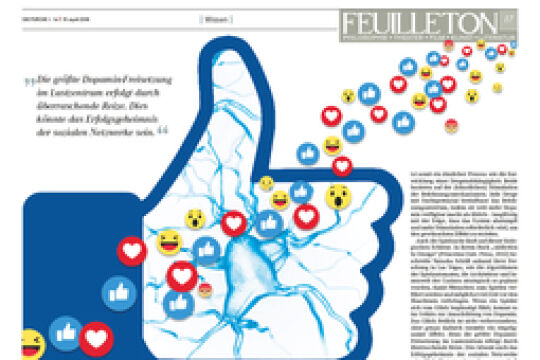Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Parkinson: Spät erkennbar, schwer zu behandeln
Internationaler Parkinson-Tag am 11. April: Anlaß für eine Bestandsaufnahme des Wissens über die nach Parkinson benannte Schüttellähmung.
Internationaler Parkinson-Tag am 11. April: Anlaß für eine Bestandsaufnahme des Wissens über die nach Parkinson benannte Schüttellähmung.
Die Krankheit war schon in der Antike bekannt, ihren Namen erhielt sie von James Parkinson, der sie in dem „Essay on the Sha-king Palsy”, (Abhandlung über die Schüttellähmung, London 1981), erstmals beschrieb. Es ist eine Krankheit der zweiten Lebenshälfte, von der einer von hundert Menschen betroffen ist.
Drei Symptome charakterisieren das klinische Erscheinungsbild der Erkrankung: Unbeweglichkeit (Akine-se), Starre (Rigor) und Zittern (Tremor). „Neben diesen drei Kardinalsymptomen dürfen aber die vegetativen Begleiterscheinungen, die psychischen Symptome und die äußerst belastende gestörte Kommunikation mit der Umwelt nicht außer acht gelassen werden”, beschreibt Primarius Dieter Volc, Prosenex Ambulatorium Schottenfeld für Neurogeriatrie in. Wien, den Ieidensdruck der Patienten. „Der Koordinationszerfall, die Schwere der Bewegungen, die fehlende Mimik und Gestik zeigen die Vielfältigkeit unserer nichtsprachlichen Kommunikation an und führen oft zu Mißverständnissen im zwischenmenschlichen Bereich.”
Ausgelöst wird die Schüttellähmung durch eine gestörte Signalübertragung in bestimmten Gehirnregionen, den Basalganglienzellen. Sie sind für die Ausübung erlernter Bewegungen und die Planung von motorischen Programmen verantwortlich. Einem Parkinson-Patienten ist es oft nicht möglich, von einem Sessel aufzustehen oder normale Schritte zu setzen.
„Unter dieser Bewegungshemmung leiden die Patienten am meisten”, weiß Volc aus langjähriger Erfahrung. Diese Funktionen werden durch den Neurotransmitter Dopamin gewährleistet, der die Signalübertragung im Gehirn durchführt. Ohne dot pamin können die Basalganglienzellen ihre Signale nicht weitergeben.
Beim Parkinsonpatienten tritt ein Mangel an Dopamin auf, der wieder die Folge des Absterbens von Nervenzellen in, der Substantia nigra, einer Begion des Gehirns, ist. Dort befinden sich große Mengen an Dopamin, die über eine Nervenbahn den Ganglienzellen zugeführt werden. „Wenn die ersten Symptome auftreten, sind bereits etwa 60 Prozent der Zellen abgestorben”, spricht Volc von dem bereits sehr fortgeschrittenen Prozeß. Derzeit gäbe es keine Möglichkeit einer Vorbeugung, die Früherkennung durch neueste bildgebende Verfahren, der Positronen-Emissions-Tomographie, sei daher sehr wichtig.
Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit leidet, weil ein mit der Krankheit verbundener Speichelfluß nicht nur in der Gesellschaft zu erheblichen Problemen sondern auch zu Schluckstörungen führt. Zusätzlich werden die Augen trocken. Etwa zehnmal pro Minute tauchen die Oberlider in den Tränensee, um das Auge zu befeuchten. Durch die Akinese wird diese Automatik stark vermindert und es kommt zur Austrocknung und Reizung.
Ebenso stört die starre Mimik die emotionelle Beziehung zur Umwelt, „das führt so weit, daß Enkelkinder ihre Oma für grantig oder gar böse halten”, weiß Volc. Es sei daher für den Umgang mit diesen Patienten ungeheuer wichtig, daß die Familienmit-glider über diese Probleme Bescheid wissen und mit dem Patienten darüber reden. Die intellektuelle Leistungsfähigkeit sei nicht betroffen, der Patient sei nur in der Bückäußerung auf Antworten langsamer, wordurch es zu
Mißverständnissen komme.
Der Leidensdruck ist enorm. Der Betroffene weiß, daß er richtig denkt, der Beobachter hält ihn aber für beschränkt. Letztlich zieht sich der Patient zurück. Die Depression - ohnehin ein wesentliches Symptom der Krankheit - wird dadurch noch verstärkt. Hier kommt dem Betreuungspersonal und der gesamten Umgebung des Patienten eine wichtige Aufgabe zu, „es darf zu keiner gesellschaftlichen Ausgrenzung kommen”, ist ein Anliegen, dem auf dem Welt-Parkinsontag größte Aufmerksamkeit gewidmet ist.
Nach wie vor ist die Dopamin-Er-satztherapie mit L-Dopa das stärkste Antiparkinson-Mittel, das es derzeit gibt. Volc tritt allerdings dafür ein, die L-Dopa Substitution vor allem bei jüngeren Menschen möglichst spät zu beginnen, um die nach sieben bis zehn Jahren auftretenden Dopa-Langzeit-syndrome, wie Krämpfe und Psychosen hinauszuschieben. Die umsichtige Verordnung geht nach dem Prinzip vor, „sowenigwiemöglich-soviel wie notwendig”
Eine besonders unangenehme Nebenwirkung der Medikation ist die Bewegungsunruhe, die man jetzt durch kleine neurochirurgische Eingriffe oder durch Neurostimulation über I lochfrequenz behandeln kann.
Die Gen-Therapie zeigt auch hinsichtlich der Parkinsonschen Erkrankung neue Wege auf. Oleg Hornykie-wicz, Professor am Institut für Biopharmakologie der Universität Wien, sieht grundsätzlich eine Möglichkeit darin, „daß im Prinzip jede Zelle so programmiert ist, daß sie Dopamin er-' zeugen kann. Im Tierversuch ist es bereits gelungen, derart genmanipulierte Zellen zu züchten und in das Gehirn zu implantieren.”
Ein weiterer Tierversuch ziele darauf ab, mit Hilfe von Nervenwachs-tumsfaktoren, sogenannten neurotro-phen Faktoren, Nervenzellen vor der
Degeneration zu schützen. Bei Batten konnten künstlich ausgelöste Parkinsonschäden an den Nervenzellen mit dieser Methode zu nahezu 80 Prozent verhindert werden. Hornykiewicz hält dieses nervenschützende Verfahren für die Therapie der Zukunft.
Er hat schon in den frühen 60er Jah ren mit der Dopamin-Forschung begonnen, zu einer Zeit, als man diesem Neurotransmitter noch kaum Bedeutung zuschrieb. Ihm gelang auch der Nachweis, daß im Gehirn von Parkinson-Patienten das Dopamin fehlt. Und obwohl er seit über 35 Jahren Schnitte aus dem Gehirn entnimmt, „ist mir immer bewußt, daß es sich um ein höchstes Kunstwerk, den wesentlichen Teil der menschlichen Persönlichkeit handelt”.
Dementsprechend zurückhaltend ist Horykiewicz daher auch hinsichtlich der sogenannten Hirntransplantationen. Der Hirnforscher: „Es handelt sich dabei natürlich nicht um eine Gehrintransplantation, sondern darum, in die erkrankten Basalganglienzellen embryonale, dopaminproduzie-rende Zellen zu implantieren. Falls diese Dopamin-Therapie eine Zukunft hat, wird man sowohl aus ethischen als auch aus rein technischen Gründen nicht embryonales Gewebe, sondern gentechnisch veränderte Körperzellen verwenden. Zur Zeit sind aber noch keine akzeptablen Therapien vorhanden.”
Die Forschung am menschlichen Gehirn habe ihm die Grenzen der Vernunft gezeigt und ihn wissenschaftliche Verantwortung gelehrt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!