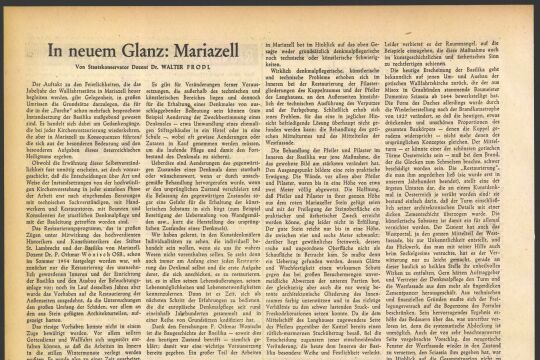Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Untergang und Aufgang von Aguntum
Wenige hundert Meter ostwärts der Brücke, welche die Straße von Lienz nach Kärnten über den wilden, heimtückischen Debantbach geleitet, liegt unmittelbar neben dem Nordrand dieser Straße ein Stück schwerer, in doppeltem Zuge verlaufender Mauer; zwei große Gevierte noch an die 2V2 Meter hoch aufragender Turmfundamente unterbrechen den Zug dieser Mauer. Zwischen den Türmen in gleichmäßigem Abstand liegende Pfeiler lassen erkennen, daß einst sich von den Turmmauern über diese Mittelpfeiler doppelte Bogen wölbten, welche hier die zweifache Fahrbahn einer rund zehn Meter breiten Straße überspannten. Westlich der großen Mauer zeichnen verschiedene schwächere Mauern die Grundrisse einer Reihe von unmittelbar an die schirmende Stadtmauer herangerückten Anlagen. Nach Osten hin dehnen sich, von der Stadtmauer selbst durch einen an die 50 Meter breiten Streifen unverbauten Geländes gesondert, eine Anzahl von Hausruinen, welchen die niedrigen Gewölbe und Pfeilerchen der einstigen Heizanlagen ihr Gepräge geben und diesem Ruinenfeld den Namen der „Zwergenstadt“ eingetragen haben. Denn die erklärungsbereite Bevölkerung der Umgegend meinte, diese nach allen Richtungen innerhalb der umschließenden Grundmauern sich spannenden Bogen und Gewölbe als die Decke von Gemächern verstehen zu sollen, in denen sie sich nach den gegebenen Höhen nur Wesen von gar kleinem Wüchse denken konnte.
Die Wissenschaft freilich weiß, durch erhärtende und erläuternde Inschriftenfunde unterstützt, seit etwa zwei Menschenaltern schon, daß an dieser Stätte nicht Gnomen ihr geheimnisumwobenes Leben lebten, sondern hier Reste der römerzeitlichen Stadt Aguntum ausgegraben wurden, und daß hier eines der Tore dieser Stadt vor uns liegt, die in der Zeit des Kaisers Claudius, also in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts nach Christus, erbaut worden war und bis in den Ausgang der Antike in ununterbrochenem Strom des Lebens bewohnt blieb. Sie weiß aber auch, teils durch Zufallsfunde, teils durch planmäßige Einzeluntersuchungen, freilich sehr geringen Umfanges belehrt, daß weit umfangreichere und zugleich weit interessantere Reste in allgemein sehr günstiger Erhaltung noch unter der bergenden Erde liegen. Dabei ist es von Bedeutung, daß hier nicht allein die Reste der römerzeitlichen Siedlung gesucht werden dürfen, sondern der Stadtname Aguntum lehrt, daß in diesem Bereich noch ältere Schichten zu erwarten sind. Denn in dem Namen Aguntum steckt unzweifelhaft die indogermanische Wurzel für Wasser, die in dem lateinischen aqua ebenso bekannt ist wie in dem deutschen Ache und in Aguntum illyrische Sprachformung weitergibt. So darf füglich in dem Bereich der römerzeitlichen Stadt auch die Siedlung erwartet werden, welche vor Zeiten die bodenständige einheimische Bevölkerung angelegt hatte.
Wenn trotz solcher Aussichten eine umfassendere Grabung noch nicht eingeleitet wurde, so ist hiefür die Art der Verschüttung bestimmend gewesen. Denn über diese Stadt, die sich in ihrem Namen als festen Platz am Wasser bezeichnet, brach einst mit seinen wilden Wassern der Debantbach herein und begrub die blühende Siedlung unter einer gewaltigen, an ihrer Stirn bis über drei Meter hohen Mure. Uber Forum und Straßen breitete sich das Sand und Kiesel mengende Geschiebe, warf drük-kend starkes Gemäuer nieder, die Häuser der vornehmen Bürger und die Werkstätten der emsigen Gewerbetreibenden bedeckend, und schob sich, von den schmutzigen Wogen des alle Bande sprengenden Baches immer höher geschichtet, über Tempel und Anlagen öffentlicher Vergnügung. Aguntum, die stolze Stadt am Wasser, die den Mittelpunkt des gesamten Osttiroler Raumes vom Pustertal bis zur Nikolsdorfer Klause und somit den südwestlichen
Grenzbezirk Noricums bildete, sie war das unwiderrufliche Opfer der Wasser der Debant geworden, die wie ein böses Ungeheuer aus ihrer tief in die Sonnleiten eingeschnittenen Schlucht wie aus einer urweltlichen Höhle, nach blühendem Leben gierend, hervorgebrochen war. Ein weites schottriges Gerolle deckte die Stätte jahrhundertelangen Lebens.
Darf aber die Wissenschaft aus diesem Wissen um die in der Erde hier geborgenen Kenntnisgrundlagen und Erkenntnismöglichkeiten das Verlangen nach Ausgrabung dieser Ruinenstätte stellen? Und darf diese Forderung in dem heutigen Österreich gestellt werden? Hat Österreich, unter der Last vieler unheilvoller Jahre mühsam nur seinen Weg des alltäglichen Lebens gehend, wirklich Mittel, die es vor anderen Aufgaben für solches Tun verwenden darf?
Ob Österreich für wissenschaftliche Zwecke Mittel in dem hier erforderlichen Umfang bereitstellen kann und darf, hängt begreiflicherweise von dem Maße ab, mit welchem man in unserem Vaterland kulturelle Arbeit zu messen und zu werten bereit ist. Hierüber viele Worte zu verlieren, ist jenen gegenüber, die kulturelle Arbeit anzuerkennen bereit sind, überflüssig; sie wissen, daß hier eine ertragreiche Aufgabe, die durch fünf Jahrhunderte hindurch lebendige Stadt in ihrem Werden und Wachsen und Vergehen zu untersuchen, der Lösung harrt. Daß eine stattliche Menge wertvollster Ergebnisse an Einzelfunden ebenso wie an geschichtlichem Wissen gewonnen werden würde, liegt auf der Hand und würde in glücklicher Ergänzung zu den wertvollen Funden sich fügen, die die Ausgrabungen auf dem Kärntner Magdalensberg gerade in der letzten Zeit erbracht haben, wofür in vorbildlicher Weise die Kärntner Landesregierung mit entscheidendem Erfolg ihre Kraft eingesetzt hat, so daß auch von Betreuern des Tiroler Landes ähnliches erwartet werden könnte.
Doch dürfte es in der unbestreitbar schwierigen Lage unserer Heimat angezeigt sein, die vorliegende Frage nicht von der ideellen Seite her allein einer Klärung und Entscheidung zuführen zu wollen, sondern die in ihr gegebenen realen und damit auch materiellen Möglichkeiten zu überprüfen. Ein auf solcher Abwägung aufgebauter Entscheid darf vielleicht auch größere Unabhängigkeit von unwägbaren Werten für sich in Anspruch nehmen und mag im Auge vieler dann sicherere Gültigkeit besitzen.
Was bisher ausgegraben war, drohte in den harten Jahren des Krieges mangels der erforderlichen Pflege der Vernichtung anheimzufallen. Im vergangenen und heurigen Sommer hat das Bundesdenkmalamt hier rettend und helfend eingegriffen; Stadttor und die anschließenden Abschnitte der Stadtmauer sind ebenso wie die unmittelbar daneben liegenden Baureste vor weiterem Verfall geschützt und bieten sich dem Besucher als eindrucksvolle Denkmale vergangener Zeiten dar. Die sogenannte „Zwerglstadt“ wird im kommenden Sommer die erforderliche Konservierung und Restaurierung erfahren. Hand in Hand mit diesen Sicherungsarbeiten konnten vor allem dank der verständnisvollen Unterstützung durch die Stadt Lienz zwar bloß beschränkte, aber nicht unwichtige Untersuchungen innerhalb des Ruinengeländes durchgeführt werden. Aufklärung über die Bodengestaltung zur Zeit der Römerherrschaft und zugleich über den Erhaltungszustand der Stadtmauer konnte dabei in befriedigendem Ausmaße gewonnen werden.
Danach ist es sicher, daß die Stadtmauer auf rund 300 Meter hier in ungestörtem Zuge zwischen zwei bis drei Meter hoch noch erhalten ist; in manchem Abschnitt steigt sie bis unter die jetzige Grasnarbe an. Es ist nicht nur der
Grabungshunger des Forschers bestimmend, wenn ein derartiges Mauerstück in diesem Erhaltungszustand als eine Sehenswürdigkeit besonderer Art bezeichnet wird. In Österreich selbst haben wir dem, trotz aller glanzvollen Erfolge, die den Ausgräbern des Magdalens-berges in Kärnten gerade in der letzten Zeit beschieden waren, nichts Ähnliches zur Seite zu stellen; und um ein solches Denkmal würde uns selbst manches an Ruinen des römischen Altertums reichere Nachbarland beneiden. Hinzu kommt, daß zumindest an der Westseite dieses Mauerstücks in der ganzen Ausdehnung zahlreiche Gebäude unmittelbar vorgelagert sind, in denen nach den bisherigen Untersuchungen nicht bloß zahlreiche Kleinfunde, sondern vor allem auch nicht unbedeutende Reste von Wandmalerei und sonstiger Innenausstattung erwartet werden dürfen.
Es ist hier der nicht häufige Fall gegeben, daß die Wissenschaft, für sich selbst aus dem rund 6000 Quadratmeter umfassenden Bezirk der Grabung reiche Ergebnisse gewinnend, mit Sicherheit ein auch für die Allgemeinheit sehenswertes und eindrucksvolles Denkmal dem bergenden Schoß der Erde zu entreißen vermag. Daß hiebei im allgemeinen kein Kulturboden in Mitleidenschaft gezogen werden würde, sondern nur ein mit Erlengestrüpp und Dornengesträuch bestandenes Gelände der Ausgrabung anheimfiele, ist gerade heute nicht ohne Belang.
Daß aber dieses Denkmal, kaum eine Wegstunde vor den letzten Häusern der betriebsamen Stadt Lienz gelegen, unmittelbar neben den beiden großen Auf-, fahrtsrampen der Glocknerstraße einen bedeutsamen zusätzlichen Anziehungspunkt für den Fremdenverkehr bilden würde, lehrt schon das Interesse, das die derzeit freiliegenden Reste allseits finden. .•
Wenn in solcher Weise materielle Wichtigkeiten sich mit wissenschaftlichen Forderungen in ergänzenden Einklang bringen lassen, dann darf Österreich nicht nur den erforderlichen Aufwand auch heute bestreiten, sondern muß ihn auf sich nehmen, da es in dieser Form sich selbst in zweifacher Weise förderlich zu dienen mag: seiner Wissenschaft und seinem Fremdenverkehr, seiner kulturellen Geltung und seinen materiellen; Einkünften. Der Entscheid erscheint damit jedes wägenden Zweifels entkleidet.
Vor dem Bunkerkreuz auf dem Buhlen staut sich eine holländische Reisegesellschaft, die vom Unkraut umwucherte Inschrift zu entziffern: „O, du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden der Welt, schenk uns den Frieden!“
Schweigend treten die Neugierigen zurück1. Es hat sie wohl eine Ahnung angeweht, daß der Tod keine Sensation ist. In uns klingt das Wort des alten Dorfpfarrers wieder, der bis zum Ende in seiner zerschossenen Pfarrei aushielt: „Hier kann man nicht besichtigen, hier kann man nur beten!“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!