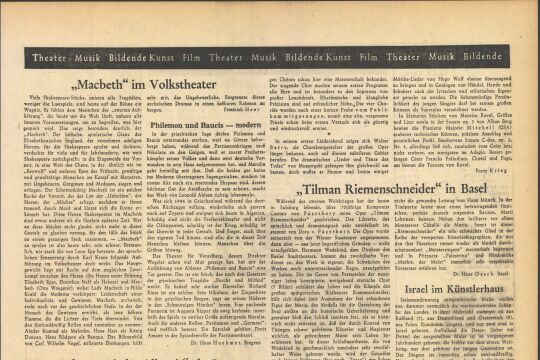Am Grazer Schauspielhaus hat Anna Badora Shakespeares „Macbeth“ zum Saisonauftakt inszeniert. Eine Mischung aus biederem Schlachttheater und hübschem Märchentheater. Die Regisseurin misstraut offenbar der Sprachgewalt des Dramatikers – und zollt der Langeweile der Laufkundschaft des heutigen Theaters Tribut.
Shakespeares Dramen prägen unsere Welt so sehr, dass wir kaum in der Lage sind, sie aufzuführen. Wir versuchen es dennoch und lernen dabei zu scheitern. An allen Ecken und Enden muss gleichzeitig gedreht werden, um seine wuchtige Sprachmaschinerie in Bewegung zu setzen, um Distanz zu gewinnen, aus der heraus man wenigstens mit dem Gedanken an Gnade und Milde spielen kann. Also werden seine Stücke gerne als „Untersuchungen über das Böse“ oder „Einblicke in menschliche Abgründe“ serviert. Doch Shakespeare urteilt nicht, er sieht. Am Ende ist es immer ein Nullsummenspiel, das einen beklommen zurücklässt. „Macbeth“ indessen, der schottische Königsmörder und König, den seine Tat in den Wahnsinn führt, hat es von Anfang an auf unsere Beklommenheit abgesehen.
In Graz jedoch gibt man ihm dazu keine Chance. Zu sehr ist der junge, begabte Claudius Körber als Macbeth damit beschäftigt, auf sich aufmerksam zu machen. Nicht anders ergeht es Verena Lercher als Lady Macbeth. Hier stehen zwei großartige Jungschauspieler auf der Bühne und jagen sich die Seelen aus dem Leib und reden sich die Köpfe blutig, als meinten sie, wir könnten sie übersehen, zwischen all den aneinandergereihten Regiedirektiven. Immer spielt ihre Angst schlecht davonzukommen mit. Badora hätte sie ihnen nehmen müssen, wäre sie mutig genug gewesen ihnen wirklich ins Herz zu schauen.
Sprache ist Zeit – und Zeit haben wir nicht
Natürlich kann man Shakespeare auch ohne Innensicht inszenieren – wenn man sich der Leere aussetzt, die Einsamkeit der Figuren erträgt und erforscht. Aber Badora spart nur aus, um es alsbald wieder aufzufüllen: mit biederem Schlachttheater einerseits und hübschem Märchentheater andererseits. Gleich zu Beginn stürmen die Krieger herein. Der Vorhang hebt sich einen Spalt breit. Wie Pfeile springen sie auf die Bühne. Die Männer wirken gierig, als steigerten und löschten sie ihren Durst aneinander. Sie trampeln einander nieder, treten und stampfen sich in den Boden, aber sie kommen immer wieder auf die Beine. Noch sind nur kleine Ausschnitte zu sehen. Mehr gibt der Vorhang nicht frei. Später öffnet sich der Raum (Bühnenbild: Raimund Orfeo Voigt) für Schrecken, Wahn und Mord. Die sagenhaften Hexen ersetzt Badora durch Mädchen in weißen Kleidern und roten Strümpfen. Ein wunderschönes Bild, welches bald wieder verblasst. Denn Badora misstraut Shakespeares skizzierender Sprachgewalt. Klar und deutlich (Übersetzung Angela Schanelec) muss sie sein, denn Sprache ist Zeit. Und Zeit haben wir nicht.
Ganz offensichtlich hat man einen Höllenrespekt vor der Langeweile der Laufkundschaft im heutigen Theater. Denn hier sitzen Datenfresser und Dauerstimulierte, und es scheint, dass sie viel Text eher behindert. Viel Zeit hat an diesem Abend also keiner. Auch nicht der kräftige Banquo (Florian Köhler) und der tapfere Macduff (Jan Thümer), der das Leben seiner lieblichen Frau (Sophie Hottinger) aufs Spiel setzt. Nur Otto David als König Duncan widersteht dem Tempo in dieser reißenden Inszenierung, bei der auch der Wahnsinn noch wie am Schnürchen funktioniert.