Für Kinder und Jugendliche in Afrika ist eine Schulausbildung der erfolgsversprechendste Weg, der Armut und Perspektivenlosigkeit zu entfliehen, weiß Bildungsexpertin Margaret Nkrumah.
Margaret Nkrumah wurde 2008 zur Vizepräsidentin der SOS-Kinderdörfer International gewählt. Die gebürtige Ghanaerin hat über Jahrzehnte nicht nur für SOS-Kinderdörfer, sondern auch innerhalb verschiedener afrikanischer und internationaler Bildungswerke viel bewegt.
Die Furche: Frau Nkrumah, sie tragen den Titel „Ubuntu-Visionärin“, verliehen von der „Ubuntu – Kulturinitiative“ der SOS-Kinder-dörfer. Was darf man sich unter diesem für europäische Ohren ungewöhnlichen Begriff eigentlich vorstellen?
Margaret Nkrumah: Der Begriff Ubuntu kommt aus Südafrika und hat dort viele Bedeutungen. Ubuntu beschreibt beispielsweise das Gefühl, dass eine Gemeinschaft einem einzelnen Kind gibt. Das Gefühl von Akzeptanz, von Annahme, von Mitgefühl, aber auch die Liebe und Nächstenliebe, die Menschen einander schenken, besonders Kindern, wenn sie Sorge für ihr Leben, ihre Ausbildung und ihre Entwicklung tragen. Anders gesagt: Ubuntu beschreibt eine für Afrika typische Lebensphilosophie, in der Menschlichkeit und Gemeinschaftssinn im Mittelpunkt stehen.
Die Furche: Sie sind ja in beiden Kulturen zu Hause gewesen. Sie lebten lange im sogenannten Westen, haben in Großbritannien studiert. Danach zog es sie wieder nach Afrika, wo sie unter anderem als Lehrerin gearbeitet haben. Haben sie den Geist von Ubuntu auch in Europa gefunden oder sehen sie große Unterschiede zwischen der afrikanischen und der westlichen Kultur?
Nkrumah: Ich habe schon einen Unterschied bemerkt zwischen Afrika und Europa. Während in Europa der Individualismus sehr ausgeprägt ist, steht in Afrika das Gemeinschaftsbewusstsein hoch im Kurs. Die Menschen in Afrika erleben sich als Teil einer großen Gemeinschaft, in der man füreinander sorgt, Verantwortung für den Nächsten übernimmt, wo Mitgefühl für den anderen eine wichtige Rolle spielt. Ich will ihnen ein Beispiel nennen: Als mein Mann und ich kürzlich in Afrika eine Panne hatten, dauerte es nur wenige Minuten, bis Hilfe da war. Menschen, die in der Nähe wohnten, kamen, um uns beim Reifenwechseln zu helfen und um uns etwas zu essen und zu trinken zu geben. Genau das ist der Geist von Afrika, den ich in Europa nur sehr selten gefunden habe.
Die Furche: Ist das etwas, was Europa und der gesamte Westen von Afrika lernen kann?
Nkrumah: Ich denke schon, ja. Die Leute im Westen meinen immer, sie müssten uns Afrikanern etwas beibringen. Das liegt daran, dass ihr Blick immer auf die Armut und Konflikte beschränkt ist. Doch niemand schaut darauf, wie die Menschen in Afrika wirklich leben und welche geistigen Reserven sie haben. Dabei gebe es so vieles, was man von uns Afrikanern lernen könnte. Schauen sie beispielsweise nach Ghana: Die Leute sind furchtbar arm und besitzen kaum etwas, aber sie lachen trotzdem! Das liegt eben an diesem Geist von Afrika.
Die Furche: Sie arbeiten seit vielen Jahrzehnten mit afrikanischen Kindern, zuerst als Lehrerin, später als Direktorin des SOS Hermann Gmeiner International College in Tema. Woran mangelt es den Kindern speziell in Afrika besonders?
Nkrumah: Ich glaube, Kinder brauchen immer dasselbe, egal wo sie wohnen. Sie brauchen Liebe, sie brauchen etwas zu essen und zu trinken und sie brauchen jemanden, der ihnen Selbstvertrauen geben kann – das ist es, was Ubuntu meint und was wir in den SOS-Kinderdörfern auch versuchen. Wenn wir uns eines Kindes annehmen, das seine Eltern, sein Zuhause, sein gewohntes Umfeld verloren hat, dann wollen wir ihm genau das wieder geben. Die SOS-Kinderdörfer wollen ein Ort des Friedens und der Ruhe sein inmitten des Chaos. Ein sicherer, friedvoller Platz. Einem Kind das zu geben waren immer meine größten Erfolge als Lehrerin. Denn jedes Kind, so taff und erwachsen es auch erscheinen und sich verhalten mag, bleibt doch ein Kind.
Die Furche: Sie setzen sich sehr intensiv für die Bildung der Kinder und Jugendlichen ein. Sollte man nicht eher alle Ressourcen dafür verwenden, um Dinge wie Essen zur Verfügung zu stellen?
Nkrumah: Essen ist natürlich wichtig, aber in Afrika ist Bildung alles. Ohne Bildung gelingt einem der Ausstieg aus den Verhältnissen nicht. In Europa ist es illegal, ein Kind nicht zur Schule zu schicken, in Afrika hingegen ist es ein Privileg, wenn ein Sohn oder eine Tochter die Schule besuchen darf. Viele Politiker in Afrika sprechen sich zwar für eine freie primäre Schulbildung aus, jedoch haben wir nicht genug Schulen. Es fehlen Lehrer, das Schulsystem strauchelt und es ist für die Eltern schwierig, eine gute Schule zu finden. Dafür wissen die Schüler umso mehr, ihre Schulausbildung zu schätzen: Betritt man ein afrikanisches Klassenzimmer, sieht man Kinder, die sich still und leise auf den Lehrer konzentrieren, weil sie so viel wie möglich lernen wollen. Es ist für sie eben nicht selbstverständlich, dass sie in der Schule sitzen.
Die Furche: Eine primäre Schulbildung alleine ist sicher zu wenig. Welche Möglichkeiten haben Kinder nach diesen ersten paar Schuljahren?
Nkrumah: Das Internationale Hermann Gmeiner College ist gemacht, um Kindern eine Möglichkeit zu geben, eine höhere schulische Ausbildung zu erwerben. Von Anfang an haben wir in unserer Schule Kinder aus ganz Afrika begleitet. Wir kontrollierten ihre Leistungen und förderten sie, damit sie immer höhere Klassen besuchen konnten. Mittlerweile haben viele von ihnen einen Uniabschluss, manche studierten in Südafrika, andere beispielsweise in Europa oder Kanada.
Die Furche: Sie haben als Frau in Afrika Karriere gemacht. Wie sieht das in der Schule aus: Sitzen in den Klassenzimmern nur Burschen oder finden auch Mädchen den Weg zur Bildung?
Nkrumah: Bildung ist für Burschen und für Mädchen wichtig, für diese ist sie fast noch wichtiger. Wenn eine Familie nur wenig Geld hat, schicken sie fast immer die Burschen in die Schule. Doch die Mädchen werden immer mehr und immer erfolgreicher. Wenn am letzten Schultag in der Schule die Zeugnisse verliehen und die Namen aufgerufen werden, dann kommt mittlerweile immer mehr Mädchen nach vorne.
Die Furche: Doch noch gehen nicht alle Kinder in Afrika in die Schule. Woran liegt das?
Nkrumah: Das Hauptproblem ist, dass sich viele Eltern die Schule einfach nicht leisten können. Auf der einen Seite brauchen sie die Kinder als Arbeitskräfte auf ihren Bauernhöfen. Dabei ist es nicht so, dass die Eltern aus Böswilligkeit den Kindern den Schulbesuch verbieten oder weil sie sie nicht lieben, es fehlt schlicht das Geld. Und auch wenn die Kinder nicht für die Arbeit daheim gebraucht werden: Vielen Eltern fehlt es an Mitteln, um die Schuluniformen oder Schulmaterial zu kaufen. Da fehlen dann so einfache Dinge wie Papier oder Stifte. Gerade da setzt unsere Arbeit an, wir wollen die Leute vor Ort unterstützen, ihnen Stipendien geben oder medizinische Unterstützung.
Die Furche: Letztlich dreht sich dadurch doch wieder alles ums Geld?
Nkrumah: Ja und nein. Natürlich brauchen wir Geld, um eben Materialen für die Schule kaufen zu können, um die Gemeinden und Gemeinschaften unterstützen zu können, um an Medikamente ranzukommen. Aber Afrika braucht auch Gerechtigkeit. Wir können nicht für immer auf finanzielle Unterstützung angewiesen bleiben. Das Problem ist: Afrika ist reich, aber niemand profitiert davon. Nur ein Beispiel von vielen: Die Küste vor Senegal ist reich an Fischbeständen, aber Koreaner, Chinesen und Norweger fischen mit ihren modernen Kuttern die Meere leer. Für die Fischer vor Ort mit ihren kleinen Booten bleibt nichts mehr übrig. Und so durchqueren sie die Sahara, um in Nordafrika in ein Schiff nach Italien zu steigen. Ich wünschte, man könnte die Menschen in Europa in ein Boot stecken und mit ihnen nach Afrika fahren, damit sie sehen, wie wir leben und was wir denken.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




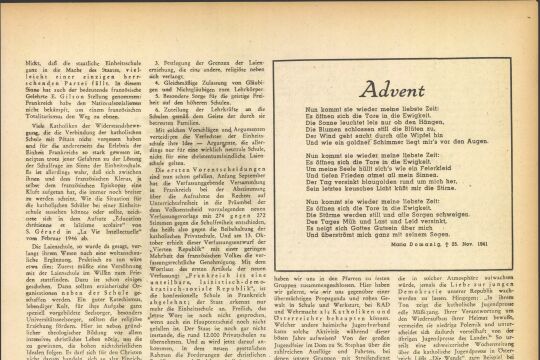









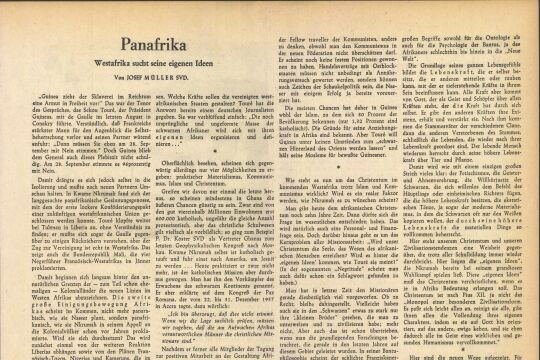
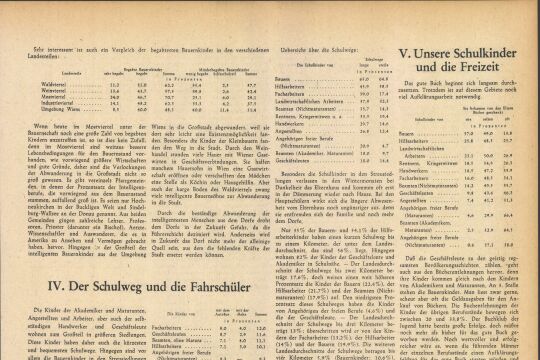












































.jpg)


































