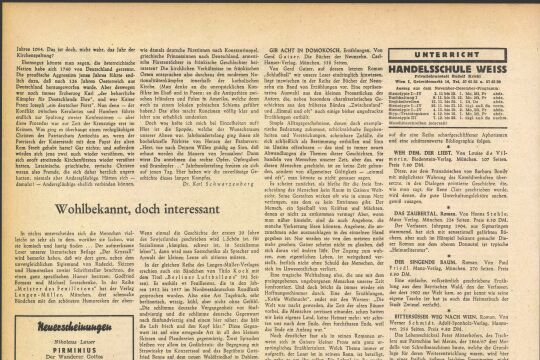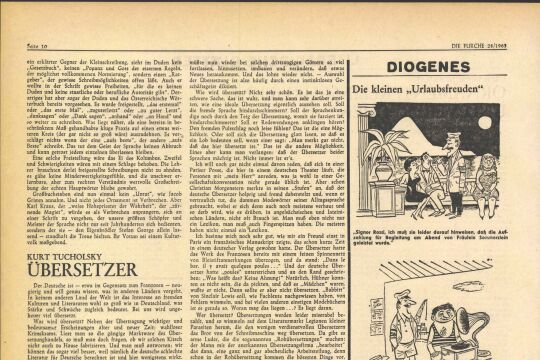Zeit in der Literatur: „Bewegung erfolgt in jeder Richtung“
Wenn es eine funktionierende Zeitmaschine gibt, dann ist das die Literatur. Aber wie macht sie das und in welche Zeit entführt sie?
Wenn es eine funktionierende Zeitmaschine gibt, dann ist das die Literatur. Aber wie macht sie das und in welche Zeit entführt sie?
"Kurz, er versenkte sich so tief in die Bücher, dass er über ihnen die Nächte vom letzten bis zum ersten Licht und die Tage vom ersten bis zum letzten Dämmer verlas, und der knappe Schlaf und das reichliche Lesen trockneten ihm das Gehirn ein, so dass er den Verstand verlor.“ Auch wenn nicht jeder dabei gleich den Verstand verliert: Alonso Quijano alias Don Quijote wird nicht der Einzige sein, dem es passiert, lesend Nächte und Tage zu verlieren. Lesen, so eine Zeitverschwendung!

Navigator Liebe Leserin, lieber Leser,
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
diesen Text stellen wir Ihnen kostenlos zur Verfügung. Im FURCHE‐Navigator finden Sie tausende Artikel zu mehreren Jahrzehnten Zeitgeschichte. Neugierig? Am schnellsten kommen Sie hier zu Ihrem Abo – gratis oder gerne auch bezahlt.
Herzlichen Dank, Ihre Doris Helmberger‐Fleckl (Chefredakteurin)
Besonders im 18. Jahrhundert warnte man davor und dass Leser „in den höchsten Träumen der Einbildung ihren Mitmenschen entrissen“ werden, wie es Johann Georg Heinzmann 1795 formulierte. Das erinnert an aktuelle Unkenrufe. Nur beziehen sich diese auf andere Medien, und retten soll nun das Buch. So ändern sich die Zeiten.
Literatur macht offensichtlich etwas (Beunruhigendes) mit unserer Zeit: Sie entrückt die Leser in die Gegenwart der Lektüre – und diese erscheint dann auch wie ein anderer Raum. Oder wie Kurt Tucholsky es einmal sagte: „Nichts weißt du von der Welt um dich herum. Du hörst nichts, du siehst nichts, du liest.“ Dieser Zustand wurde oft mit dem des Traums verglichen, allerdings einem, in den man sich freiwillig begibt: „In jedem Augenblick kann ich aufwachen, und ich weiß es; aber ich will es nicht: Lektüre ist ein freier Traum“, beschrieb Jean-Paul Sartre das Phänomen. Ein sonderbarer Zustand ist der Traum, er hebt die Gewissheiten des Wachseins auf, setzt die Gesetze der Logik außer Kraft. Und in welche Zeit entführt er? Und wohin entführt die Literatur?
Wenn es eine funktionierende Zeitmaschine gibt, dann ist das die Literatur. Das weiß jeder, der schon einmal in einen Roman gefallen und in anderen Zeiten – und damit meist auch in anderen Räumen - gelandet ist: im Lübeck der „Buddenbrooks“ (ist das Lübeck?), im Dublin des „Ulysses“, im U-Boot von Jules Verne, auf dem Mond von Cyrano de Bergerac.
Es gibt historische Romane, die leuchten das Leben der Figuren der jeweiligen Zeit bis ins Detail aus, sie wissen und kennen alles. Die Farbe des Kleides der Königin, die Bauchschmerzen von Napoleon, das Muster der Teetasse von Maria Stuart, das Rülpsen des Ritters. Als literarische Reenactments stellen sie Geschichte nach. Freilich immer aus der Sicht der Gegenwart. Denn man kann über Historisches (oder Zukünftiges) nur „vor dem Hintergrund der Tatsache nachdenken, dass wir bereits in das verstrickt sind, worüber wir nachdenken“, so der Historiker Achim Landwehr in „Die anwesende Abwesenheit der Vergangenheit“.
Warum diese Verstrickung und Beziehung also nicht mit zum Thema machen, fragt Felicitas Hoppe und zieht es vor, „die Lebenden nicht bei den Toten zu suchen. Denn so lange wir ihren Geist nicht aufgeben, sind die Toten keine Geister.“ Hoppes Frage „Wie verbinden wir das, was war, mit dem, was ist, und, nach vorne gedacht, mit dem, was sein könnte?“ führt mitten in den Möglichkeitssinn der Literatur. Und so kann Pigafetta, der historische Chronist der ersten Erdumsegelung unter Ferdinand Magellan, auf einem Containerschiff des ausgehenden 20. Jahrhunderts sitzen und die Ich-Erzählerin kann sich mit ihm unterhalten.
Wenn der russische Schriftsteller Vladimir Sorokin die Handlung seines Romans „Der Tag des Opritschniks“ um zwanzig Jahre in die Zukunft verlegt, in der Russland seine Abschottung von Europa durch eine Große Mauer zementiert hat und den Europäern ab und zu den Gashahn zudreht, und wenn er als Vorlage für dieses Russland das System Iwan des Schrecklichen aus dem 16. Jahrhundert wählt: Über welche Zeit erzählt er da? Von gestern, von morgen oder nicht doch auch von heute? In welche Zeit also führt die Lektüre wirklich? Und was macht die Literatur mit der Zeit?
Sie strafft sie. „Es regnete vier Jahre, elf Monate und zwei Tage.“ Wie sonst könnte man „Hundert Jahre Einsamkeit“ erzählen. Sie dehnt sie. Acht Kapitel lang lauscht Tristram Shandys Mutter an der Tür, und erst nach drei Bänden ist der zu Beginn gezeugte Ich-Erzähler auf der Welt. „Ist’s nicht schändlich, zwei Kapitel aus dem Geschehen beim Hinabsteigen einer Treppe zu machen?“, lässt der Autor Laurence Sterne rhetorisch fragen und illustriert seine Erzählweise mit zackigen Fieberkurven. Der Roman, „der nie aufhört, Anfang zu sein“ (Uwe Timm), endet in einer Zeit vor seinem Beginn.
Absurdes Unterfangen
„Das Geschichtenerzählen ist ein absurdes Unterfangen. Es stellt einen Versuch dar, die Realität als Abfolge von Ereignissen darzustellen, obwohl es diese klare Abfolge nicht gibt. So verhält es sich auch mit der Sprache. Sage ich etwas, bedeutet das zugleich, dass ich etwas anderes auslasse, selbst bei Finnegans Wake. Genau das Medium, mit dem Tristram versucht, der Wahrheit seiner Identität habhaft zu werden, – Worte – trägt dazu bei, jene Wahrheit zu verdunkeln“, beschreibt Terry Eagleton die Absurdität, die für Schriftstellerinnen eine Einladung ist.
Anfang, Mitte, Ende. Dass es diese klare Abfolge nicht gibt, beschäftigte auch Gertrude Stein, die dies in ihre unverkennbare Sprache bringt: „Bewegung erfolgt in jeder Richtung Anfang und Ende ist nicht wirklich erregend, alles ist alles, alles geschieht und jeder kann jederzeit wenn etwas geschieht alles erfahren“. Wir haben es in unseren Leben mit vielen Anfängen, Mitten und Enden zu tun. Kausalketten von Ursache und Wirkung, Niederlage und Erfolg sind oft literarische Konstrukte, über Jahrhunderte durch Narrationen und Literaturen vermittelt. Henry Fielding hat sich bereits 1749 in seinem Roman „Tom Jones“ geweigert, so Milan Kundera, „den Roman auf jene kausale Verkettung von Handlungen, Taten und Worten zu beschränken, die von den Engländern ‚Story‘ genannt wird und die Sinn und Essenz eines Romans sein soll; gegen die absolutistische Macht der ‚Story‘ nimmt er sich insbesondere das Recht heraus, die Erzählung ‚wo und wann er will‘ mit seinen eigenen Kommentaren und Überlegungen, anders gesagt mit Abschweifungen, zu unterbrechen.“
Das Unterbrechen, das Innehalten als Poesie. Und die Bewegung. Der Roman „Unrast“ der Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk setzt sich aus vielen Geschichten zusammen: Sie fangen an, brechen ab, werden dann fortgesetzt oder auch nicht. Sie erzählen vom Schmerz, Geheimnisse nicht ergründen zu können – und sie ergründen sie auch nicht. „In meinem Schreiben wurde das Leben zu unvollständigen Erzählungen, traumgleichen kleinen Geschichten mit ausfransenden Erzählfäden, von weitem erschien es in ungewöhnlich verschobenen Perspektiven oder wie ein Querschnitt – und es ließen sich kaum Schlussfolgerungen auf das Ganze ziehen.“
Tyrannei der Zeit
„Im Roman tickt ständig eine Uhr“, schrieb E. M. Forster 1927 in seinen „Ansichten des Romans“. Und wirklich: „immer hat es ein Gefühl gegeben daß etwas einer anderen Sache folgte daß es im Geschehen eine Abfolge gab“, wusste Gertrude Stein im Jahr 1935. Anfang, Mitte, Ende eben. „Aber jetzt haben wir all das geändert das haben wir tatsächlich getan“, frohlockte Stein und tatsächlich revolutionierte sich zu ihrer Zeit die Literatur. „Sie hat ihre Uhr zerschmettert und zerstampft und die Teilchen wie die Gebeine der Osiris über die ganze Welt verstreut“, schrieb Forster über die Grande Dame der Moderne, „das war keine Unart von ihr, sondern geschah in bester Absicht. Sie hoffte, die Erzählung von der Tyrannei der Zeit zu befreien …“
Für die gesamte Literatur ist Gertrude Stein auf Dauer die Revolution nicht gelungen. Der konventionelle Takt, die übersichtlichen Sequenzen haben sich durchgesetzt. Ordnung hilft verstehen. Unterbrechung aber auch. Und der Blick auf das, woraus Literatur besteht. „riverrun, past Eve and Adam’s, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs“. Man muss den ersten Satz von „Finnegans Wake“ von James Joyce nur laut lesen, schon hört man den Fluss fließen, an Adam und Eva vorbei. Bald darauf wird Donner grollen. Willkommen in der Zeit der Sprache.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf mehr als 175.000 Artikel seit 1945 – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!