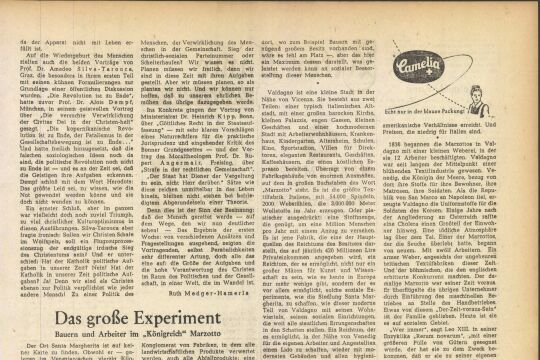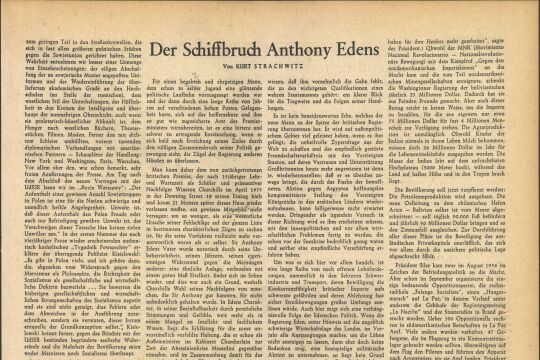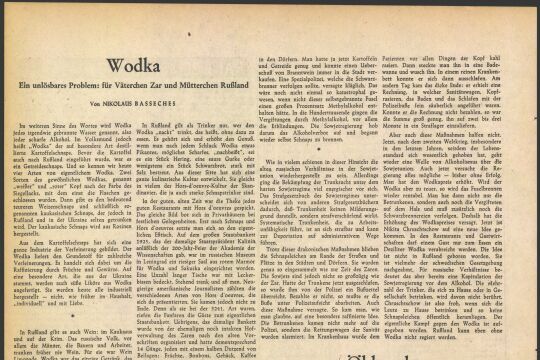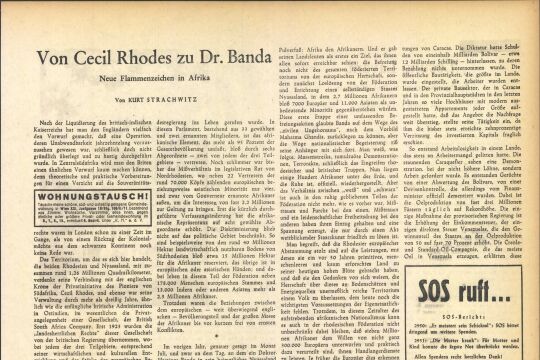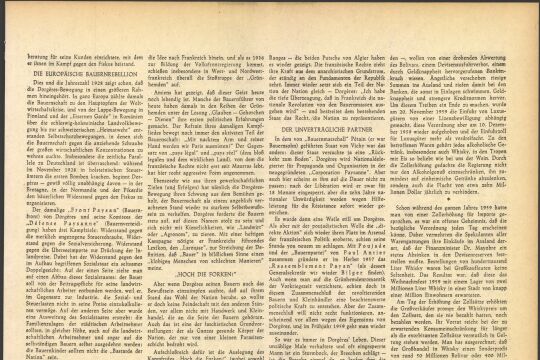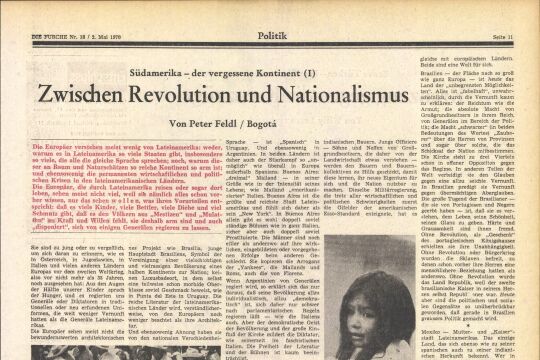Kakaofabrik in Venezuela: Kooperative oder Verstaatlichung.
In einer Fabrikhalle wiegen junge Männer und Frauen Jutesäcke voll Kakaobohnen und schütten die kieselsteingroßen Bohnen durch ein großes Sieb. Nach dem Rösten und Mahlen teilt sich in dem bolivarianischen Betrieb sozialistischer Produktion Cacao Oderí der Produktionsprozess: In blitzenden Bottichen brodeln flüssige Kakaobutter und Kakaomasse. Das feine, bittere Pulver füllen die Arbeiter in 50-Kilo-Säcke mit dem Aufdruck Barlovento-Kakao mit feinem Aroma, 100 Prozent organisch ab.
Der Barlovento, wörtlich "über dem Wind", ist die warme, üppig bewaldete Karibikregion, zwei Autostunden nordöstlich von Venezuelas Hauptstadt Caracas. Schon während der Kolonialzeit bauten hier afrikanische Sklaven Kakao an. In Europa wurde daraus Trinkschokolade und bereits im 17. Jahrhundert trat Kakao seinen Siegeszug in der Alten Welt an. Um 1800 war Venezuela der größte Kakaoexporteur der Welt. Parallel zum Erdölboom im 20. Jahrhundert erlebte jedoch die gesamte Landwirtschaft einen dramatischen Niedergang. In den letzten Jahren hat sich der Kakaosektor allmählich erholt: Von 2000 bis 2006 stieg die Jahresproduktion von 16.000 auf 17.000 Tonnen, wobei Venezuela noch immer für besonders edle Sorten bekannt ist. Für den organisch angebauten und im Werk Oderí verarbeiteten Kakao interessieren sich bereits Kunden aus dem Ausland.
Kakao: Profit für den Norden
Kakao ist ein begehrter Rohstoff des Südens - aber wie seit Kolonialzeiten verdienen daran hauptsächlich Unternehmen des Nordens. In Venezuela etwa kauft Marktführer Nestlé rund ein Drittel der Kakaoproduktion auf. Die Nachkommen der Sklaven wollen das ebenso ändern wie die Regierung von Präsident Hugo Chávez. Um den bisherigen Wirtschaftskreislauf zu durchbrechen, müssen die Bewohner des Barlovento ihren kostbaren Rohstoff jedoch zu wertvoller Schokolade weiterverarbeiten. Deshalb erhebt sich nun mitten im tropischen Grün die neue Kakaofabrik, die Chávez im Oktober 2006 eingeweiht hat.
In ein paar Jahren soll dort nicht nur Kakao verarbeitet, sondern sollen auch Tafelschokolade, Bonbons und Likör hergestellt werden. Doch das ist Zukunftsmusik. Denn im Barlovento wurde am Freitag letzter Woche ein zäher Machtkampf um den richtigen Weg zum "Sozialismus des 21. Jahrhunderts" entschieden, wie Präsident Chávez ihn proklamiert hat. Chávez, dessen überlebensgroßes Konterfei neben einer Kakaobäuerin die Fassade ziert, hatte vor sechs Monaten per Dekret die Gründung der sozialistischen Aktiengesellschaft Cacao Oderí angeordnet. Die organisierten Bauern sollten 49 und der Staat 51 Prozent der Anteile bekommen. Seitdem rangen die genossenschaftlich organisierten Kakaobauern mit den Funktionären des Staatsapparats um die Kontrolle der Fabrik. Doch am Freitag wurde ein zweites Dekret veröffentlicht: Der bolivarianische Betrieb sozialistischer Produktion Cacao Oderí wird verstaatlicht.
Von Chávez verstaatlicht
Genossenschaft und Staatsvertreter sprechen bereitwillig über den Konflikt. "Wir haben das alles hier sieben Jahre lang unter großen Entbehrungen aufgebaut", sagt Germán Huise, ein Afrovenezolaner, der vor Jahrzehnten als Tagelöhner für Großgrundbesitzer gearbeitet hat, wie zuvor schon seine Eltern. Heute ist er mit 56 Jahren einer der Veteranen des Kooperativendachverbands, dem 18.000 Bauern angehören. "Seit 15 Jahren beschäftigen wir uns mit organischem Landbau und haben Kooperativen gebildet", erzählt Huise. "2004 hat der Präsident unser Projekt der Kakaofabrik gutgeheißen. Wir haben das ganze Personal gründlich angelernt, das sind Leute wie wir. Doch dann haben uns die anderen überrumpelt und 51 Prozent an sich gerissen." Empört fügt er hinzu: "So behandelt man die Bauern nicht. Wir wollen respektiert werden. Manche fürchten wohl, dass wir Schwarze ihnen zu mächtig werden."
Die Seite des Präsidenten Hugo Chávez in der gerade verstaatlichten Kooperative vertritt Javier Abreu, Verwaltungsexperte und studierter Ingenieur. "Euer Kampf war hart", beschwört er seine skeptischen Gegenüber. "aber Präsident Chávez ist ein Instrument Gottes, das es uns ermöglicht hat, das hier zu schaffen. Ohne ihn wären wir aufgeschmissen." Deutlicher wird der weiße Technokrat erst im Büro des Fabrikdirektors: "Um entscheiden zu können, musst du ausgebildet sein. Vater Staat begleitet die Bauern und gibt ihnen das Werkzeug, damit sie vorankommen. Das ist wie bei einem Baby, das laufen lernt." Auch Edgar Rivas, den die Regierung als Direktor eingesetzt hat, spricht von Empowerment, davon, dass das Management schrittweise an die Produzenten übergehen soll. "Doch gerade in der jetzigen Phase brauchen wir auch qualifiziertes Personal von außen", sagt Rivas. Vor einem roten Che-Guevara-Plakat verweist er darauf, dass gerade in jüngster Zeit viele genossenschaftlich geführten Betriebe gescheitert seien. Sein wichtigstes Credo: "Die Fabrik gehört dem Staat, also allen Venezolanern."
"Unser Streit ist technisch und politisch zugleich", fasst Rivas, ein schlanker Mann Ende 30 mit grau melierten Dreitagebart, zusammen. Er streitet sich über das effektivste Managementmodell, darüber, ob über die technischen Fragen des täglichen Betriebs immer die Vollversammlung der Kooperativisten entscheiden soll oder ob das auch das fünfköpfige Führungsgremium entscheiden kann.
Die Fabrik selbst läuft bislang auf Sparflamme. "Erst vor kurzem haben wir die Einarbeitung des Personals abgeschlossen", sagt Juan Martínez, den die Kooperativisten als Geschäftsführer eingesetzt haben. Gut zwei Drittel der angelieferten 180 Tonnen Kakaobohnen seien bisher zu Kakaomasse,-butter und-pulver verarbeitet worden. Die Tagesproduktion beläuft sich auf zwei bis vier Tonnen, möglich wären acht Tonnen der lukrativen Ware.
Kooperative leitete Fabrik
Eine schwierige Situation, denn: "Bis jetzt haben wir die Fabrik allein verwaltet", stellt Martínez, ein drahtiger 47-Jähriger, fest. Auf einem Sieben-Hektar-Grundstück in der Nähe des Werkes baut er selbst Kakao und Gemüse an. "Die Staatsfunktionäre, die seit November hier sind, agierten wie eine Besatzungsmacht, doch solange die Anlagen auf unseren Namen liefen, konnten sie nichts machen." Doch am Dienstag vor einer Woche wurde die Verstaatlichung umgesetzt: Während ein Agrarrichter eine Inspektion und eine Inventur anordnete, genehmigte das Kabinett in der Hauptstadt Caracas das Dekret, wonach dem staatlichen Agrarverband sämtliche Aktien zugesprochen werden.
Bereits zuvor sei Agrarminister Elías Jaua von seiner Zusage abgerückt, die Fabrik nach einer Übergangsphase der Mitbestimmung von vier Jahren wieder den Kooperativen zu übergeben, sagt Martínez. "Er will uns zu Lohnempfängern degradieren. Das ist überholter Staatskapitalismus. Für uns heißt Sozialismus Selbstverwaltung. Doch solange die Blockade durch den Minister anhielt, konnten wir die Firma nicht registrieren lassen und deswegen nichts verkaufen."
Weil es den Kooperativisten nicht gelungen war, direkt zu Chávez vorzudringen, hatten sie den Konflikt bereits Anfang März in der Tageszeitung Últimas Noticias und im Internet öffentlich gemacht. "Wir wollen auch weiterhin eine breitere Debatte über den Sozialismus und sozialistische Betriebe anstoßen", sagt der Ökonom José Bonilla, neben Martínez der wichtigste Stratege der Kooperativisten. "Viele Basisgruppen wehren sich gegen die übermäßige Einmischung des Staates und der neuen bolivarianischen Bourgeoisie."
Ebenso wie die Gegenseite wollten Martínez und Bonilla die "Kommunalen Räte" vor Ort für ihr Modell gewinnen. Hugo Chávez hat sie Anfang dieses Jahres zum "fünften Motor der Revolution" ausgerufen, um Korruption und Bürokratie in den Gemeindeverwaltungen auszuhebeln. Doch wie genau das funktionieren soll, ist unklar - Kritiker sehen darin einen weiteren Machthebel des Staatschefs.
Landwirtschaft, nicht nur Öl
Die Kakaofabrik war darin nur ein Baustein, eingebettet in "umfassende kommunale Bauernhöfe", mit denen Großgrundbesitz und Kakaomonokulturen überwunden werden sollen. All das passte gut zur "endogenen Entwicklung" in der Landwirtschaft, mit der Chávez versucht, die einseitige Ausrichtung Venezuelas auf das Erdöl abzubauen. Doch Bonilla und Martínez, die ihr historisches Vorbild in der Pariser Kommune und bei den frühen Sowjets sehen, wollten mehr: "Sämtliche Produktionsmittel muss das Volk direkt verwalten, ebenso die sozialen Dienste wie Bildung und Gesundheit. Das ist unvereinbar mit der staatsfixierten Sichtweise der Bürokraten."
Nach der Entscheidung für die Verstaatlichung ist Fabrikdirektor Edgar Rivas erleichtert. "Die Sprecher der Kommunalen Räte sind künftig die oberste Entscheidungsinstanz", versichert er. Vor Tagen habe er zusammen mit anderen Direktoren von Staatsbetrieben von Chávez höchstpersönlich die Instruktion erhalten, einer einheitlichen Orientierung zu folgen und dabei "nichts zu überstürzen". Und es bleibe dabei: "Die Überschüsse der Produktion werden im Barlovento investiert."
Das hofft auch Kooperativensprecher Juan Martínez. "Wir haben eine Schlacht verloren, aber noch nicht den Krieg", sagt er trotzig. Für ihn vertritt Präsident Chávez einen Sozialismus von oben, der schon im 20. Jahrhundert gescheitert ist. Die Staatsbetriebe in der Landwirtschaft seien bereits ein Musterbeispiel für Verschwendung und Ineffizienz. Irgendwann, da ist er sicher, wird sich die Erkenntnis durchsetzen: "In Venezuela muss die Zivilgesellschaft als Wirtschaftsakteur gestärkt werden, nicht der übermächtige und korrupte Ölstaat."
Der Autor ist Korrespondent der Berliner taz.