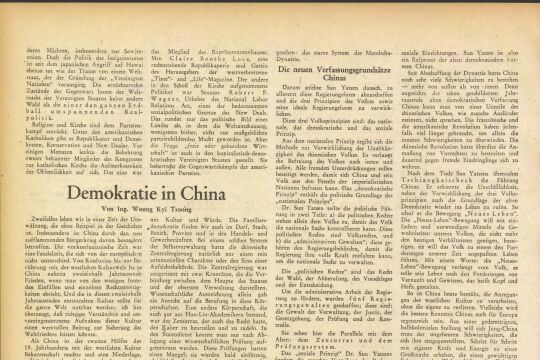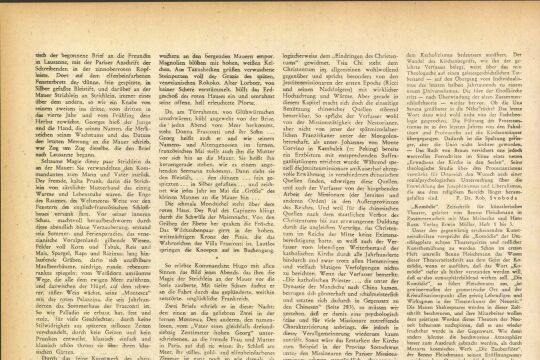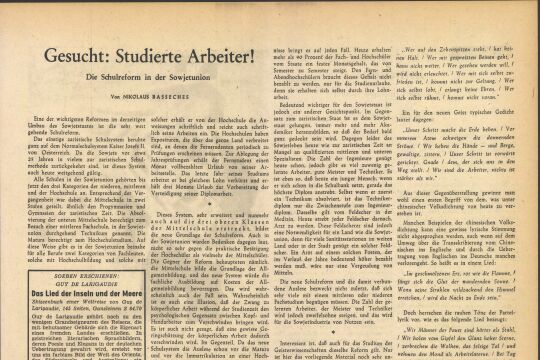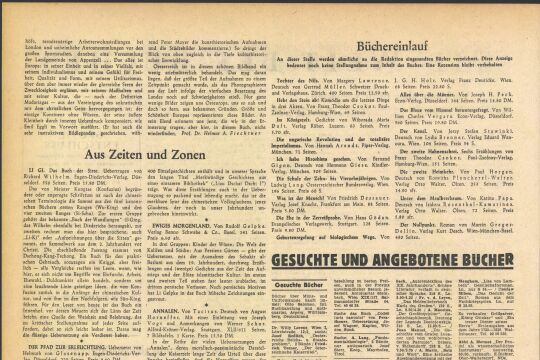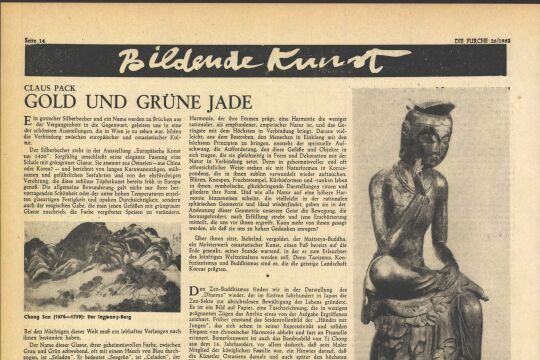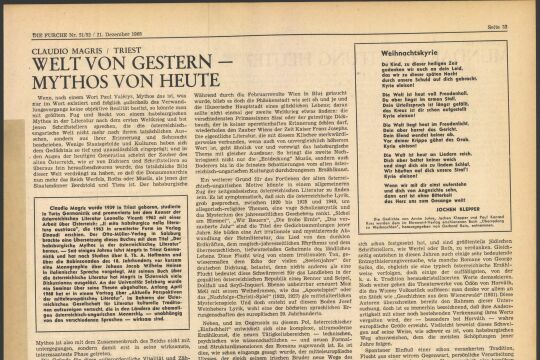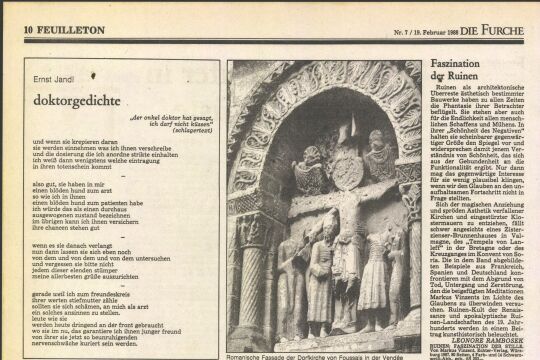Kulturrevolutionäres Hinwegraffen aller traditionellen Werte und Neuorientierungen zwischen westlichen Einflüssen hinterlassen ihre spuren.
„Die Literatur auf der Suche nach den Wurzeln – „Xungen wenxue“ – bezeichnet eine Strömung der Literatur am chinesischen Festland, die in der Zeit nach dem realen und ideellen Tod Mao Zedongs versuchte, mit den literarischen Mitteln eines Magischen Realismus lateinamerikanischer Provenienz ein China wiederzuentdecken, das durch die politischen und sozialen Ambitionen und Experimente, durch die Katastrophen und die enttäuschten Hoffnungen des 20. Jahrhunderts verschüttet schien. Ein China aufzuspüren und zu literarischem Leben erstehen zu lassen, das jenseits der urbanen Gegenwartsbesessenheit, jenseits der konfuzianisch geprägten Biederkeit, jenseits der politisch opportunen Gefälligkeit authentischer sein sollte, als es die Nachwehen eines „sozialistischen Realismus“ zutage treten haben lassen. Nach jener „Kulturrevolution“, mit der das Experiment kultureller Selbstzerstörung zwischen 1966 und 1976 von der volksrepublikanischen Geschichtsschreibung terminologisch festgemacht wird.
Zu den Ethnien
Die „Literatur auf der Suche nach den Wurzeln“ führt in die Tiefen der Provinz, zu Ethnien, deren Exotik sich das Han-Chinesentum zaghaft zu erschließen begann – ein Prozess, dessen Bruchlinien gerade heute in Tibet und Xinjiang mehr und mehr evident werden. Diese „Suche nach den Wurzeln“ ist auch eine Suche nach dem „Ich“, das sich in der chinesischen Literatur, vor allem in der Lyrik, über Jahrhunderte, im Wortlosen, in der Natur etwa, zu verbergen hatte, einem „Ich“, das mit dem Dichter und Gelehrten Guo Moruo (1892–1978) in den 1920er Jahren eruptiv zu „bersten“ begann, einem „Ich“, das mit Bei Dao (geb. 1949), dem in den 1980er Jahren das Epitethon des „Obskuren“ („menglong“) verordnet worden war, im Diktum des „ich glaube nicht“ („Wo bu xiangxin“) den Vorwurf des Nihilismus generierte. In einem China, das sich der Modernisierung verschrieben hatte. Nach der Vernichtung des alten konfuzianischen Imperiums, nach der Vernichtung jedweden antirevolutionären Widerstandes nach 1949, nach der Vernichtung der ultralinken „Viererbande“ nach 1976.
Literatur, jene Suche nach Wahrheit, die auch die Abgründe und Schrecknisse, die Hoffnungen und Sehnsüchte, die Entwürfe von Vergangenheit und Zukunft des Einzelnen wie der Zeitgemeinschaft eines Volkes, aus den Tiefen sprachlichen und kulturellen Gedächtnisses in einen innovativen Akt der Kommunikation einzubringen sich anschickt: solche Literatur mag im China des 20. Jahrhunderts lange, bisweilen zu lange auf der Suche nach sich selbst gewesen sein. Übermächtig mag das Erbe von Jahrtausenden gewesen sein, das nur in der totalen Negation überwindbar schien. Selbst Mao Zedong verfasste noch Gedichte im klassischen Stil.
Die antagonistischen Kräfte, die Chinas Gesellschaft und geistige Landschaft im 20. Jahrhundert erschütterten – kulturrevolutionäres Hinwegraffen aller traditionellen Werte und Erkenntnisse und Neuorientierungen zwischen westlichen Einflüssen und der Suche nach einer eigenständigen „Moderne“ – spiegeln sich in der Literatur wider. Die Literatur des „Neuen China“ ersetzt die klassische Schriftsprache durch die „vox populi“, durch die Sprache der „Proletarier“, denen oben zitierter Guo Moruo ein Denkmal setzen wollte. Die literarischen Stoffe sollten die Anliegen des gemeinen Volkes thematisieren, nicht mehr die idyllischen Vorstellungswelten von Kaisern und Konkubinen, von romantischen Anwandlungen angesichts einer Mondnacht, sollten frei von alter Rhetorik sein, erfüllt von der Syntax gesprochener Volkssprache. Lu Xun (1881–1936), der „Vater der modernen chinesischen Literatur“, hatte mit in den Negativhelden eines „A Q“ und „Kong Yiji“ einem sterbenden Kulturkreis ein unsterbliches Denkmal gesetzt. Quasi ein „Arzt“ für die Psyche eines ganzen Volkes zu werden, dessen Instrument Literatur wenigstens „die Kinder“ in eine Zukunft hineinretten helfen sollte: Diese Ambitionen wurden ab 1942 mit der totalen Unterwerfung künstlerischen und literarischen Schaffens unter die Direktiven „Der Partei“, jenes Visionsdogmas Maos, auf Jahrzehnte verbannt.
Dunkle Augen
Es bedurfte einer neuen Generation, die den Gründer in ein Mausoleum verwies, die die Theorie in Pragmatismus zu verwandeln verstand, ehe sich „Literatur“ am Festland wieder des Literarischen zu erfreuen wagte. Gu Cheng (1956–1993), Lyriker von Talent und Verzweiflung, versuchte, in den 1980er Jahren jenes „Licht“ aufzuspüren, das seiner Generation im adoleszenten Suchen versagt geblieben war, jenes Licht, das die Nacht der „Kulturrevolution“ durch das Rot von Blut ersetzt hatte. Gu Cheng ging mit seinen „dunklen Augen“ das Licht suchen. „Die Nacht hat mir dunkle Augen gegeben.“ Er scheiterte, riss sich und die Seine in den Abgrund und hinterließ eine Lyrik, die sich nicht im Un-Glaubbaren verliert, vielmehr eine Dimension andeutet, dass es abseits des Vordergründigen noch etwas zu ergründen gibt, an das zu glauben dem Volk zu lange versagt worden war.
Literatur im China der Nach-Mao-Ära erschöpft sich aber nicht im lyrischen Zeichnen menschlich-unmenschlicher Abgründe. Sie mag sich auch durchaus von einer ironischen, ja sogar selbstironischen Seite präsentieren. Es war ausgerechnet ein Bürokrat, ein Kulturminister, der sich als einer der authentischsten Satiriker entpuppte: Wang Meng (geb. 1934), der in einer seiner „Kürzest-Geschichten“ mit dem Titel „Gegenseitige Hilfe“ die Win-win-Situation zwischen aufmüpfigem Autor und parteitreuem Literaturkritiker auf den Punkt brachte: „Ich möchte Sie lediglich darum ersuchen, einen aufrechten, gestrengen Artikel zu schreiben und mich darin mit Ihrer Kritik völlig zu verreißen! Nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte weiß ich genau, sobald jemand von Ihnen kritisiert worden ist, wird er beliebt im ganzen Land, sein Name erschüttert den Erdball!“
Kein freies Fabulieren
Das Schicksalsjahr 1989 behaftete das Bild des Platzes vom Himmlischen Frieden für künftige Generationen mit jenen „Geschichtsrätseln“, von denen die Lyrikerin Shu Ting (geb. 1952) dichtete, „dass die unverformten Kinder in hundert Jahren … keine Not haben“ mögen. Das Jahr 1989 brachte nicht nur eine epochale Wende in die Szenerie der großen Welt – zunächst war es China, dessen Wertsystem einer realpolitischen Analyse unterworfen worden war. Für die Literatur bedeutete dies zunächst ein Ende allzu freigeistigen Fabulierens, doch bald eine Annäherung, vielleicht Vereinnahmung durch das Paradigma des „freien Marktes“, dessen sich die Systemsicherung nunmehr zu bedienen wusste. Der aufmüpfige Satiriker trat als Kulturminister zurück.
Der erste und bislang einzige Literaturnobelpreisträger chinesischer Abstammung, Gao Xingjian (geb. 1940), sollte seinem Nährboden – wie so manche andere Literaten auch – den Rücken kehren. „Exil“ ist das Wort, das bemüht, zugleich vermieden und in Abrede gestellt wird. Nicht nur für den einen oder anderen, der die Zuflucht im Ausland aus Sicherheit, Notwendigkeit oder Kompromisslosigkeit wählte, vielmehr für Angehörige einer Generation, die auch mit einer „inneren Emigration“ auf Zeitumstände reagierten, mit Selbstzensur, mit Ausbrüchen aus der Literatur in den „Markt“ und in die Vermarktbarkeit.
Gaos Sprechstück „Busstation“, konnte sich der literarischen Beurteilung, bloß ein chinesisches „Warten auf Godot“ zu sein, nicht mehr entledigen. Signifikant für die chinesische Gegenwartsliteratur, die Suche nach dem Selbst, nach Abstand zu westlichen Vorbildern, noch weiter vorantreiben zu müssen. Es war das Medium des Films, von Regisseuren wie Zhang Yimou, das so manchen Roman weltbekannt machte, allen voran Yu Huas (geb. 1960) Schilderungen der Misslichkeiten des armen, am Rand einer sich zunächst langsam, später rasant entwickelnden Gesellschaft vegetierenden Menschen.
Die erste Phase literarischer Selbstfindung nach der Kulturrevolution nahm sich der „Wunden und Narben“ an, schrieb, beschrieb das schwer Beschreibbare individueller und kollektiver Tragödien, verfehlte wohl noch literarische Geltung, war aber jene Brücke, die von verordneter Glorifizierung „sozialistischer Helden“ zur genaueren Zeichnung individuellerer Charaktere führte, die in den 1980 Jahren zu einer pluralistischeren Literatur überleitete, so wie sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einmal existiert hatte.
Das Unausgesprochene
Die Literatur des Neuen China, von den Ambitionen der geistigen Erneuerungsbewegung 1919 beflügelt, von Maos „Aussprache über Literatur und Kunst“ im revolutionären Hauptquartier Yan’an“ 1942 geknebelt, in den Massendienst der Kulturrevolution beordert, trat mit einer Art Selbst-Befreiung, die Grenzen immer wieder auslotend, aus Rückschlägen neuen Elan schöpfend, seit Ende der 1970er Jahre ihren Weg in die Welt an. Der Dichter Gu Cheng, der „mit dunklen Augen“ das Licht suchen ging, ersehnte und erspähte in seinem Gedicht „Gefühle“ in allem Grau zwei Kinder: „das eine hellrot, das andere leicht grün“. Seinem eigenen Kind entzog er sich als Vater, den Kindern Chinas hinterließ er ein Testament, Zeugnis einer Zeit, in der die „Repräsentanten entfliehender Historie“ noch immer „wortlos ihre Aufzeichnungen machen“. In einer Kultur, die sich über Tausende Zeichen vermittelt, in einer Kultur, in der das zwischen den Zeichen und zwischen den Zeilen Unausgesprochene seine Signifikanz bewahrt hat.
Richard Trappl, geb. 1951, ao. Prof. am Institut für Ostasienwissenschaften der Universität Wien, Bereich Sinologie. Herausgeber der neuen Reihe CHINA ERLESEN im Wieser Verlag, die in diesem Herbst mit vier Bänden gestartet wird.
Eine Sammlung chinesischer Klassiker
Das alte China; Von Kaiser zu Kaiser; Die Goldene Truhe; Der Aufstand der Zauberer. Hg. von Eva Schestag und Olga Barrio Jiménez. S. Fischer 2009
4 Bd. im Schuber + Drei Zeichen Klassiker; Subskriptionspreis bis 31.3.2010: e 91,50
Die Sandelholzstrafe
Von Mo Yan. Übersetzung: Karin Betz
Insel 2009. 650 S., geb., e 30,70
Brüder
Roman von Yu Hua. Aus dem Chines. von Ulrich Kautz. S. Fischer 2009
764 S., geb., e 25,70
Aufzeichnungen eines glückseligen Dämons
Gedichte und Reflexionen von Yang Lian. Nachw. von Uwe Kolbe. Übers: Wolfgang Kubin und Karin Betz
Suhrkamp 2009
270 S., geb., e 30,70
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!