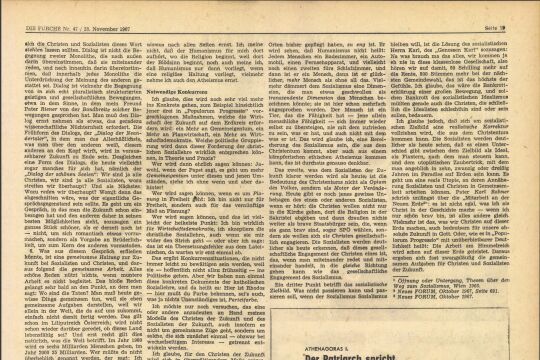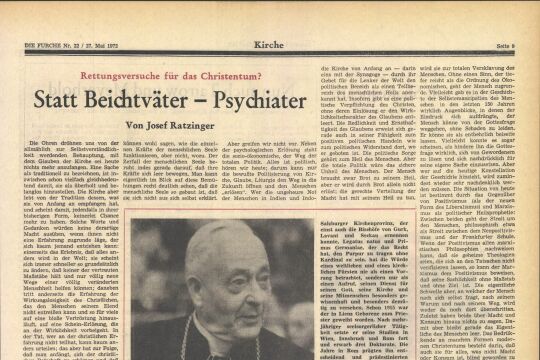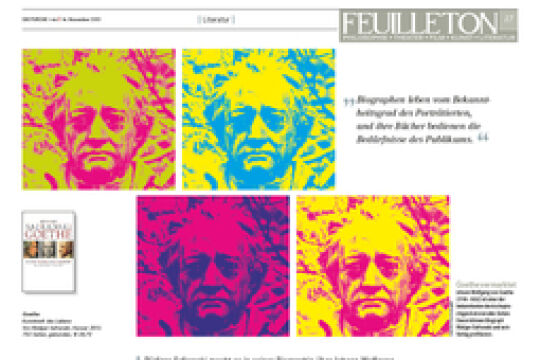Der Philosoph Rüdiger Safranski im Gespräch über Sinnsuche im Zeitalter des "religiösen Hobbykellers", die schwierige Auseinandersetzung mit der islamischen Welt, die Angst vor der Globalisierung und die notwendige Balance zwischen Abgrenzung und Öffnung.
Die Furche: In Ihrem Essay "Gott ist doch nicht tot" haben Sie über die neue religiöse Sinnsuche geschrieben. Warum vollzieht sich diese überwiegend außerhalb der kirchlichen Institutionen?
Rüdiger Safranski: Vielleicht ist dies so, weil sich in den religiösen Institutionen ein nichtreligiöser Geist verbreitet hat. Dann wären diese Einrichtungen die falschen Adressen. Diese neu erwachende religiöse Sehnsucht ist ja auch eine, die sich gerade nicht an Dogmen, Institutionen oder rituellen Formen festhalten möchte. Es ist eine Sehnsucht, die etwas sehr Subjektives und Ungeordnetes hat und die eine feste Form noch vermeidet. Was wir jetzt "religiöse Sehnsucht" nennen oder "Sehnsucht nach Transzendenz", gibt es als anthropologisches Faktum. Wenn wir in die Geschichte blicken, sehen wir einen ständigen Wandel. Wir sind jetzt nicht in einer Phase, in der dieses Potenzial vollkommen verschwindet, sondern in einer Zeit, in der sich die Dinge neu gruppieren und auch dieses religiöse Bedürfnis neu zum Vorschein kommt.
Die Furche: Was sind die Gründe für diese Entwicklungen?
Safranski: Zwei Motive spielen eine Rolle: In einer Gesellschaft, in welcher der Konsum sehr große Bedeutung hat und in der materielle Bedürfnisse befriedigt werden, entsteht das religiöse Bedürfnis gewissermaßen aus dem Erlebnis des Defizits im Überfluss. So nach dem Motto: Das kann es doch nicht gewesen sein. Zum anderen ist jetzt noch eine neue Form hinzugekommen: Wir erleben eine Renaissance des religiösen Fundamentalismus. Der Westen scheint bedroht zu sein, und daraus entsteht ein religiöses Bedürfnis, was aber eigentlich mehr mit Politik zu tun hat als mit Religion. Die Leute meinen, sie müssten sich jetzt wieder ihrer christlichen Wurzeln vergewissern. Eines ist natürlich ganz wichtig: Religionen kann man nicht einfach erfinden. Auch einen Gott nicht, denn dann könnte man auch nicht an ihn glauben. Es muss irgendetwas in unserer Seele geschehen, damit wir auf authentische Weise zu religiösen Menschen werden. Das Religiöse ist, obwohl es zu unseren Bedürfnissen gehört, zugleich etwas, über das man nicht einfach verfügen kann. Wenn man Sinn stiften will, geht der Sinn stiften.
Die Furche: Besteht dann nicht die Gefahr, dass wir selbsternannten Sinnstiftern aufsitzen?
Safranski: Ja, natürlich. Jedes Defizit in einer Gesellschaft lässt sich zugleich auf dem Markt nutzen. Indem man ein Defizit als Nachfrage formuliert, kann man auch Angebote machen. Man muss sich ja nur ansehen, welche Sinnstiftungsseminare jedes Wochenende in den Zeitungen angeboten werden; man kann sogar über Glut gehen. Wir sind eingetreten in das Zeitalter des religiösen Hobbykellers: Jeder macht sich sein Angebot selbst oder sucht es im Internet und auf anderen Wegen. Dies erzeugt eine etwas schaumige Atmosphäre. Ab und zu kommen Politiker, wie unlängst etwa Peer Steinbrück (Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, SPD; Anm.), die sagen: Die Gesellschaft braucht Sinn. Als ob damit etwas Originelles gesagt wäre. Okay, jetzt kümmert man sich um Sinn. Vielleicht gibt es irgendwann ein Ministerium für Sinnbeschaffung. Dort wird man sagen: Die Sinnressourcen sind knapp; und die Gewerkschaften sagen dann: Wir müssen sie gerecht verteilen. Man könnte sich darüber leicht eine Komödie ausdenken.
Die Furche: Was halten Sie von Samuel Huntingtons Theorie des "Clash of Civilizations". Hat diese durch den 11. September an Plausibilität gewonnen?
Safranski: Sagen wir einmal so: Wir sehen uns schon einer Front gegenüber. In der islamischen Welt gibt es nicht nur Islamisten, aber wir wissen, dass in diesen Kulturen Religion in der Politik eine viel größere Rolle spielt als im alten Europa. Das heißt, wir sind konfrontiert mit Kulturkreisen, die ganz bestimmte Prozesse der Säkularisierung, wie wir sie in Europa kennen, noch nicht hinter sich gebracht haben. Es ist nicht nur so, dass hier zwei Zivilisationen aufeinander prallen, sondern es liegt auch eine Ungleichzeitigkeit vor: Ein bisschen begegnen sich hier das 16. und das 21. Jahrhundert. Seit dem 16. Jahrhundert hat Europa in blutigen Bürgerkriegen gelernt, Politik und Religion voneinander zu trennen. Davor hatten wir religiöse Bürgerkriege. Darüber hinaus erleben wir aber auch eine Konfrontation zwischen dem starken Glauben in diesen Kulturen und unserer Dekadenz. Unsere Bedrohung ist ja auch eine gewisse Entleerung und ein nihilistischer Horizont. "Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod": Dieser starke Spruch bringt ein Gefühl der Überlegenheit gegenüber den etwas hohlen Konsumenten und dekadenten Nihilisten, die wir hier im Westen sind, zum Ausdruck.
Die Furche: Sie haben ein Buch mit dem Titel "Wie viel Globalisierung verträgt der Mensch?" veröffentlicht. Einmal anders gefragt: Wie viel Globalisierung braucht der Mensch?
Safranski: Ich würde sagen, Globalisierung ist nicht etwas, das wir gemacht haben, sondern etwas, das geschieht, ein Prozess. Die Frage ist nun, wie wir uns diesem gegenüber verhalten. In letzter Zeit hat es einen Paradigmenwechsel gegeben. Nach 1989 war Globalisierung synonym mit dem Ende der Spaltung der Welt. Gedacht als die friedliche Ausdehnung des liberal-demokratischen Kapitalismusmodells, war sie, wie auch von Francis Fukuyama beschrieben, eine positive Vision. Dann verdüsterte sich das Bild und verkehrte sich in sein Gegenteil. Globalisierung erscheint uns jetzt wie ein Dämon, als das große Böse. In einer solchen Lage neigt der Mensch zu Verschwörungstheorien. Sie sind das beste Mittel, Komplexität zu reduzieren.
Die Furche: Halten Sie es für möglich, dass die Globalisierung in Folge von Krisen wieder zurückgefahren wird?
Safranski: Es ist abzusehen, dass freie Märkte in Zukunft wieder reduziert werden. Das ist ganz klar, vor allem wenn die Großmacht USA dies wünscht. Die Ideologie des offenen Marktes wird als Ideologie deutlich, und es werden wieder die eigenen Interessen in den Vordergrund treten. Die Balance zwischen Abgrenzung und Öffnung muss neu gefunden werden. Unser Immunsystem funktioniert ja auch nach diesem Prinzip: Es lebt vom Öffnen und Schließen. Beides muss sein.
Das Gespräch führte Armin Pongs.
Kulturkritiker, Biograf großer Denker
Rüdiger Safranski, 1945 in Rottweil geboren, studierte in Frankfurt am Main und Berlin Philosophie, Germanistik und Geschichte. Später war er wissenschaftlicher Assistent an der Freien Universität Berlin, Dozent in der Erwachsenenbildung und bis 1981 Mitherausgeber und Redakteur der "Berliner Hefte". Das Leben großer Denker hat er als Biograf für die Leserwelt neu entdeckt. 1984 veröffentlichte er ein Buch über den "skeptischen Phantasten" E.T.A Hoffmann, beschrieb 1987 "Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie", erzählte 1994 in dem Band "Ein Meister aus Deutschland" über "Heidegger und seine Zeit" und publizierte 2000 ein Buch über das Leben von Friedrich Nietzsche. "Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus" heißt seine neue Biografie, die im September erschienen ist. Rüdiger Safranski lebt seit 1985 als freier Autor in Berlin. Zusammen mit Peter Sloterdijk ist er Gastgeber des "Philosophischen Quartetts" im ZDF.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!