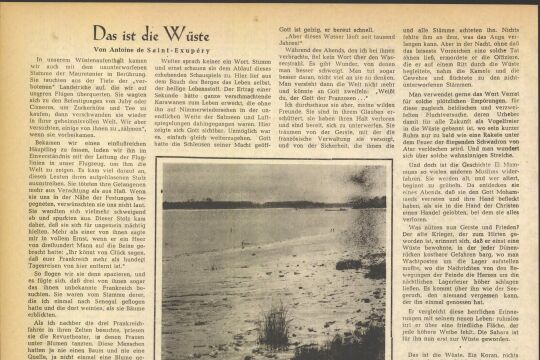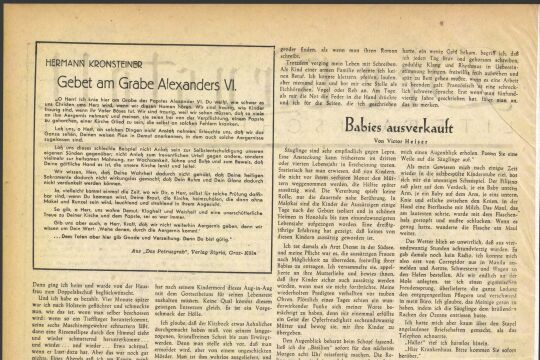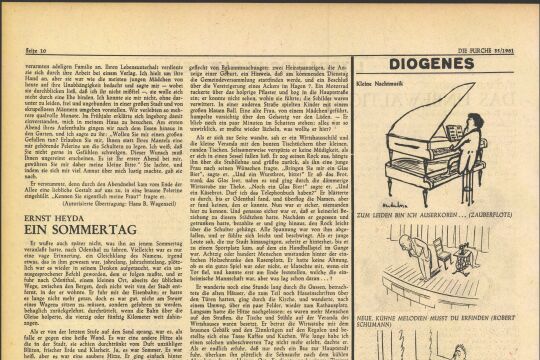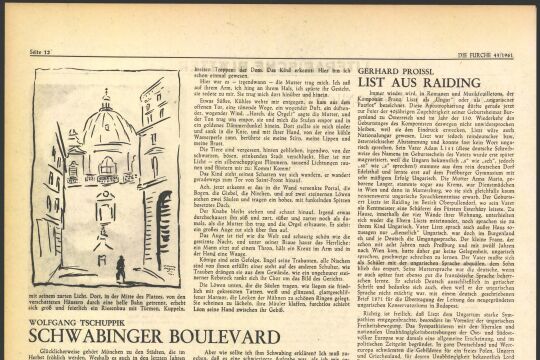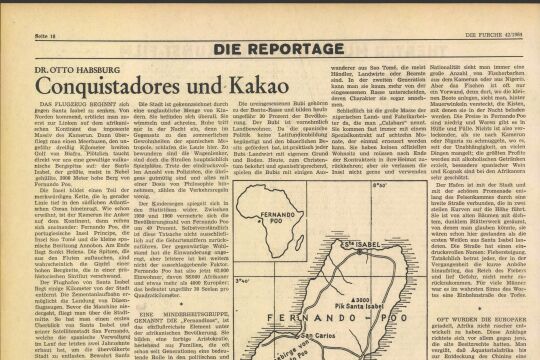Die Wirtschaftskrise holt die Spanier zurück auf die Felder. Für die illegalen Einwanderer, die sich bislang als Erntehelfer ihren Traum von Europa erfüllten, bleibt da kein Platz mehr.
Den Ort, an dem sein Leben besser werden sollte, hatte sich Moussa S. aus dem Senegal anders vorgestellt. Die Straßenkreuzung in La Mojonera bei Almería ist grau und staubig, drum herum ducken sich ein paar farblose Hausklötze vor dem ständig blasenden Wind, der um sieben Uhr morgens noch kalt und feucht ist. Seit rund hundert Tagen sieht Moussa jeden Tag von hier die Sonne aufgehen. Er wartet auf einen „Chef“, der ihm ein paar Stunden Arbeit gibt. Die Augen des 31-Jährigen sind starr geradeaus gerichtet. Nur wenn ein Lastwagen an der Kreuzung hält, schnellt sein Blick hoch. So wie die flehenden Augenpaare der anderen, die mit ihm an der Kreuzung auf einen Heilsbringer warten.
„Die Gewächshäuser an der Küste von Almería sind der Wartesaal Europas für illegale Einwanderer“, sagt Spitu Mendy von der Landarbeitergewerkschaft SOC. „Mit einer Arbeitsgenehmigung braucht man hier gar nicht nach einem Job zu fragen. Die Landwirte vergeben die Arbeit fast ausschließlich ohne Vertrag.“ Auf den Tomaten-, Melanzani-, Zucchiniplantagen sind die Löhne so schlecht wie nirgends sonst am spanischen Acker; 30 Euro für einen Acht-Stunden-Tag gelten hier schon als gutes Geld. Seit Beginn der Wirtschaftskrise bezahlen die Landwirte noch weniger. Wenn überhaupt.
Seit das spanische Wirtschaftswunder vorbei ist, seit in Spanien keine Arbeit mehr auf dem Bau zu finden ist, seit die Zeitungen jeden Tag neue Rekordarbeitslosenzahlen melden, finden illegale Einwanderer wie Moussa keinen Job mehr. Die Einheimischen, die Spanier, kehren zurück auf die Felder und konkurrieren mit den Arbeitsmigranten. Rund ein Viertel der viereinhalb Millionen in Spanien gemeldeten Einwanderer ist zur Zeit arbeitslos, Tendenz steigend. Die spanische Regierung schätzt, dass es dazu noch gut eine Million illegaler Einwanderer gibt. Der Anteil an Arbeitslosen ist unter ihnen noch einmal deutlich höher. Der Konkurrenzkampf an der Kreuzung von La Mojonera nimmt zu.
„Mit dem Lohn für die Arbeiter ist es wie mit dem Preis für die Tomaten: Je mehr Angebote es gibt, desto weniger wird bezahlt.“ Manuel Sabio Perez wischt sich den Schweiß von der Stirn und grinst. Der kleine Mann ist Landwirt in Almería und einer der möglichen Arbeitgeber von Moussa. Sabio steht in seinem Gewächshaus, die Sonne scheint und die Temperaturen liegen unter dem Plastikdach weit über 30 Grad. Neben ihm reihen sich Zehntausende von Tomatenpflanzen aneinander. 26.000 Hektar Anbaufläche sind allein in der Provinz Almería voller Tomaten – rund zweimal die Fläche von Graz.
Schulden über Schulden im Gepäck
Im Jänner war Moussa an einem senegalesischen Strand in ein Holzboot gestiegen. Tausend Euro zahlte er den Schleppern für die Fahrt nach Marokko. Geld, das er sich von Freunden geliehen hatte. Geld, das er zurückzahlen wollte, sobald er in Europa war. 400 Euro hatte er dann noch für die Überfahrt nach Spanien, die Schlepper verlangten 500 Euro mehr. Auch die muss er noch zurückzahlen – die Bande weiß, wo seine Familie lebt.
Die Überfahrt dauerte fast drei Tage. Eine Nacht war geplant gewesen, Nahrung und Getränke waren rationiert. Er war glücklich, als er endlich die spanische Küste sah. Doch als die Polizei das Holzboot vor Cádiz aufgriff, dachte er, er sei gescheitert. Die Beamten brachten ihn in das Internierungslager von Algeciras, wo er 40 Tage lang fürchtete, er müsse zurück. Doch am 41. Tag setzten ihn die Polizisten vor die Tür und drückten ihm einen Zettel in die Hand. Dort stand, er müsse Spanien verlassen und dürfe in den nächsten fünf Jahren nicht wieder einreisen. Rot-Kreuz-Mitarbeiter erklärten Moussa, dass er mit dem Abschiebebescheid kaum Chancen auf eine Arbeitserlaubnis hätte. Dann gaben sie ihm ein Busticket nach Almería.
Laut dem aktuellen spanischen Ausländergesetz dürfen illegale Immigranten nicht länger als 40 Tage festgehalten werden. Wenn kein Rückführungsvertrag mit dem Herkunftsland besteht oder wenn in diesem Zeitraum keine Abschiebung erfolgt, müssen sie wieder freigelassen werden. Oft reicht die Zeit nicht aus, um die Rückführung zu organisieren oder um das Herkunftsland des Immigranten festzustellen – fast keiner hat einen Ausweis dabei.
Seither ist Moussa in Almería; seiner Familie hat er noch keinen Cent geschickt, nicht einmal anrufen kann er. Nur dann, wenn die anderen ihm etwas Geld geben. Mit zehn anderen Senegalesen wohnt er in einem heruntergekommen Haus am Ortsausgang von La Mojonera, mit Blick auf die schmutzigen Plastikplanen der Gewächshäuser. Ein zehn Quadratmeter-Zimmer teilen sie sich zu dritt. Bezahlen kann er nicht einmal die Matratze, auf der er die Nächte verbringt. Auch das Essen bekommt er von seinen Mitbewohnern. „Meine Frau versteht nicht, wieso ich nicht arbeite“, sagt Moussa traurig. Er vergräbt sein Gesicht in seinen Händen. Es gibt kein Zurück. Nach Hause kann er erst, wenn er Geld verdient hat. „Ich bin gekommen, um unser Leben in Afrika zu verbessern.“
Vergebliches Warten auf den „Jefe“
Zweihundert Kilometer nördlich von La Mojonera steht Mamadou D. in einer Ecke des Busbahnhofs von Úbeda. Auch er ist aus dem Senegal. Auch er wartet nicht auf einen Bus, sondern auf einen „Jefe“, einen Landbesitzer, der ihm in einem Olivenhain Arbeit gibt. Seit zwei Wochen steht er jeden Morgen hier, Oliven hat er keine gesehen. In der Nacht schläft er auf dem Bürgersteig. Geduscht hat er das letzte Mal vor einer Woche. Die Menschen, die auf einen Bus warten, halten sich Taschentücher vor den Mund, wenn sie an ihm vorbeigehen. Der 21-Jährige bohrt seinen Blick in den Boden.
Mamadou ist nicht allein, mit ihm suchen rund 5000 Immigranten in der Provinz Jaén Arbeit bei der Olivenernte. Nur wenige von ihnen finden Platz in den Obdachlosenherbergen, noch weniger Arbeit.
Vor zweieinhalb Jahren setzte Mamadou vom Senegal auf die Kanarischen Inseln über. Die Küstenwache griff ihn auf und brachte ihn in ein Internierungszentrum. Am 41. Tag brachten ihn Polizisten zum Flughafen. Während des Flugs dachte er, sie würden ihn zurück in den Senegal bringen. Doch als das Flugzeug landete, war er in Barcelona und ein Sozialarbeiter des Roten Kreuzes wartete auf ihn. Er gab ihm zwei Wochen lang ein Zimmer, klärte ihn darüber auf, dass es schwierig werden würde, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, brachte ihm ein paar Wörter Spanisch bei. Dann musste er raus, die nächsten Neuankömmlinge von den Kanaren kamen.
Mamadou fand ein Bett in einem Zimmer mit zwei anderen Senegalesen und Arbeit auf dem Bau. „Ich verdiente gut“, sagt er, etwas mehr als tausend Euro für 48 Stunden die Woche. Jeden Monat konnte er mindestens 200 Euro nach Hause zu seinen Eltern und Geschwistern schicken. Doch Anfang des vergangenen Jahres war es vorbei. Seitdem ist Mamadou ein Nomade, zieht von Ernte zu Ernte.
In einer Bar, gleich gegenüber von der Bushaltestelle in Úbeda, klebt auf einem Schwarzen Brett ein handgeschriebener Zettel: „Spanier, erfahren, zuverlässig, bietet sich für die Olivenernte an, José.“ Darunter eine Telefonnummer. José ist ein großer, breiter Mann, ein Familienvater, Mitte 40 mit viel Erfahrung bei der Olivenernte. Er hat vor Kurzem seine Arbeit auf dem Bau verloren, deshalb sucht er jetzt wieder nach einer Beschäftigung auf dem Feld. „Die Immigranten nehmen uns die Arbeit weg“, sagt er verbittert. „Sie arbeiten mehr Stunden für weniger Geld, deswegen stellen sie die Bauern lieber an.”
Weit unter dem Agrartarifvertrag
Rund 30 Euro bekommen die Afrikaner für einen Arbeitstag, schwarz, ohne Zusatzkosten. Bis die Sonne untergeht, ernten sie Oliven. In Úbeda wartet nur der Bordstein auf sie, zuhause, in ihrem echten Leben, die Familie auf eine bessere Zukunft. Der Agrartarifvertrag in Jaén sieht 50 Euro für sechseinhalb Stunden vor. „Bisher hat mich noch kein Bauer angerufen, dabei hängt das Schild schon seit Tagen dort“, sagt José. „Doch ich brauche dringend Arbeit. Wir wissen nicht, wie wir unsere Rechnungen bezahlen sollen.“
Die Liste von Manuel Sabio aus Almería ist lang, über hundert Namen stehen dort. Und es werden immer mehr: „Jeden Tag fragen mich Leute nach einem Job, ich schreibe ihren Namen und ihre Nummer auf, aber Arbeit habe ich keine.“
Als Moussa um acht Uhr abends zurück in sein armes Zuhause kommt, setzt er sich in eine Ecke des abgesessenen Sofas und starrt auf den Bildschirm des Fernsehers. Es läuft ein Musikvideo aus dem Senegal: „Le chemin de l’espoir“ heißt das Lied, Weg der Hoffnung. Es geht um einen jungen Mann, der nach Europa aufbricht, um dort sein Glück zu suchen. Im Senegal hätte er jetzt getanzt.
* Die Autorin, Journalistin in Málaga, hat diesen Artikel im Rahmen eines Recherchestipendiums der Otto-Brenner-Stiftung verfasst.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!