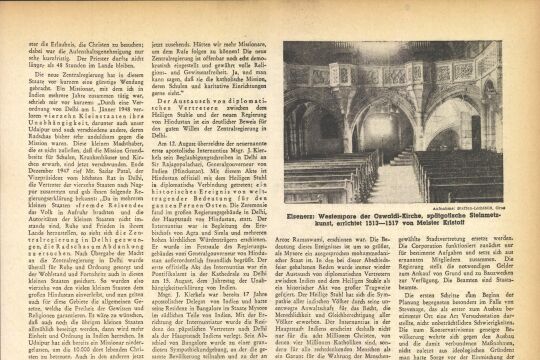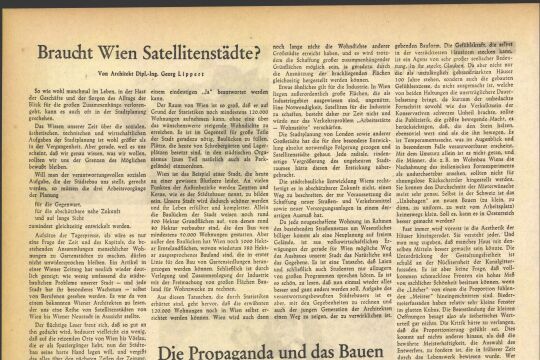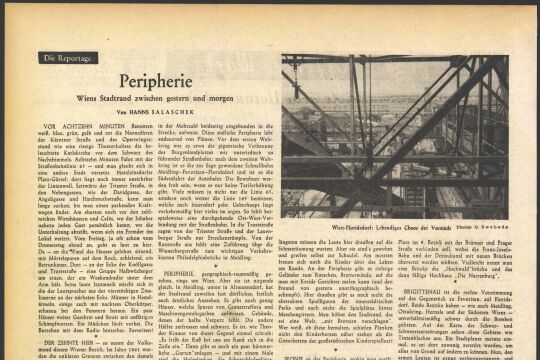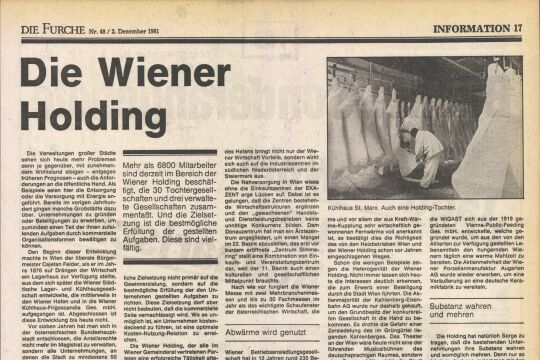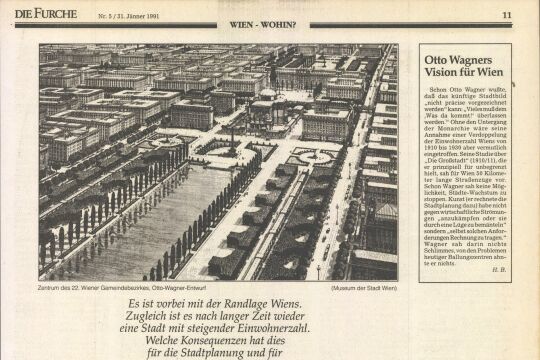Heinz Fassmann, Professor für Geografie und Regionalforschung an der Universität Wien, über die amerikanische Stadtflucht, den österreichischen Kampf gegen die Verödung der Stadtkerne und die unterschiedlichen Wohn-Philosophien von Frank Stronach und Harry Glück.
Die Furche: Sie schreiben im Buch "Wien verstehen" (Bohmann 2004), dass die Suburbanisierung hierzulande viel später Einzug gehalten habe als etwa in us-amerikanischen Städten - und auch viel weniger dynamisch verlaufen sei. Aus welchen Gründen?
Fassmann: Das hat ganz rationale Gründe. Wir hatten eine verspätete Motorisierung: Suburbanisierung ohne Auto ist nicht denkbar. Wir hatten auch einen verspäteten Wohlstand, wir hatten Nachkriegsschäden zu beseitigen, das hat alles dazu geführt, dass wir noch in der Stadt geblieben und nicht hinausgezogen sind. Und das hat auch mit der europäischen Idee von Stadt zu tun: Wir achten die Stadt als interessant und abwechslungsreich. In Amerika erscheint gerade der weißen Bevölkerung die Stadt eher als problematisch: Hier gibt es mehr Kriminalität, mehr ethnischen Mix. Deshalb geht sie hinaus. Es gibt dort keine städtische Bevölkerung die sagt: Wir müssen an der Kernstadt arbeiten. Sondern sie verlassen sie einfach und bauen außerhalb ihr eigenes Heim.
Die Furche: In Europa ist es scheinbar noch umgekehrt: Hier orten Sie einen "absinkenden Sozialgradienten" Richtung Stadtrand ...
Fassmann: Wir haben in allen europäischen Städten das Phänomen, dass die Bevölkerung mit dem höchsten Einkommen und Sozialprestige noch immer im Zentrum lebt. Auch in Wien sind ja die Preise in der Innenstadt am höchsten. In den us-amerikanischen Städten ist es umgekehrt: Hier hat man in der Kernstadt den geringsten Sozialgradienten, dort wohnt die zugewanderte, arme Bevölkerung. Je weiter man hinausgeht, desto größer werden die Häuser und Grundstücke.
Die Furche: Welche Folge hat dieses Absiedeln an den Rand für die Stadtkerne?
Fassmann: Das ist ein sich selbst verstärkender Prozess: Wenn die wohlhabende Mittel- oder Oberschichtsbevölkerung die Kernstadt verlässt, dann nimmt sie ihr Einkommen mit und investiert es am Stadtrand. Damit geht aber den Kernstädten wieder Attraktivität verloren: Manche Geschäfte müssen vielleicht schließen und sich auch an den Rand verlagern. Andererseits können sich etwa in Wien auf Grund einer historisch interessanten Baustruktur einige Einkaufsstraßen halten. Aber daneben gibt es natürlich auch ein breites Spektrum an Einkaufsstraßen, die vollkommen veröden - etwa die Margaretenstraße in Wien. Da ist auch nichts zu machen, weil die dort wohnhafte Bevölkerung wenig Kaufkraft hat.
Die Furche: Ein ziemlich fatalistisches Szenario ...
Fassmann: Natürlich darf die Politik diesen Fatalismus nie zeigen und muss immer dagegen ankämpfen, so wie Sisyphos den Stein immer wieder hinaufrollt. Man muss attraktivieren, man muss wie in Wien die Hauptbibliothek auf den Gürtel setzen als Zeichen dafür, dass die Stadt bereit ist, wichtige Infrastruktur zu verlagern. Man müsste also auch den fünften Bezirk und die Margaretenstraße so attraktiv wie möglich gestalten und den Verkehr beruhigen. Man kann versuchen, die Geschäftsleute zusammenzuschließen und gemeinsame Aktionen zu initiieren. Aber es ist eben wie bei Sisyphos: Der Stein fällt immer wieder runter.
Die Furche: Wie beurteilen Sie - im Gegenzug zu Wien - die Situation in kleineren und mittleren Städten?
Fassmann: Städte unter 10.000 Einwohnern sind sicher in einer schwierigen Situation. Städte mit 20.000 oder 30.000 Einwohnern, also Bezirkshauptorte, halten sich ganz gut, weil sie Kaufkraft vom umliegenden ländlichen Raum absaugen. Hier muss man wohl akzeptieren, dass wir einen gewissen Verlust von Infrastruktureinrichtungen in den dünner besiedelten Gebieten haben werden - und auf der anderen Seite eine Stabilisierung der kleinen und mittleren Städte.
Die Furche: Sehen Sie irgend eine Möglichkeit, die zunehmende Abwanderung der Geschäfte an den Stadtrand zu bremsen?
Fassmann: Zunächst ist es eine betriebswirtschaftliche Frage der Unternehmen, die tatsächlich sagen: Wir müssen hin zum Prinzip "Stop and Shop". Die Menschen kommen mit dem Auto, bleiben stehen und kaufen ein. Sie sind nicht mehr bereit, lange Suchwege zu akzeptieren - außerdem müssen sie ja dann die Sachen vom Baumarkt ins Auto bringen; die können sie ja nicht im Handtascherl mitführen. Der eigentliche Motor ist also das Interesse der Betriebe, neue Vermarktungsformen zu entwickeln. Dazu kommt das Interesse der Gemeinden, diese Betriebe an sich zu binden, weil sie damit höhere Steuereinnahmen haben, Arbeitsplätze bekommen und attraktiv werden. Damit entsteht ein Wettbewerb der Gemeinden: Wer als erster den Hofer hat, gewinnt! Das bekommt man nur mit überregionalen Konzepten in den Griff.
Die Furche: Genau das hat die "Planungsgemeinschaft Ost" für Wien, Niederösterreich und das Burgenland geplant ...
Fassmann: Das ist eine honorige Institution, die seit 25 Jahren vor sich hinarbeitet und Vorschläge erarbeitet. Doch sie hat kein politisches Gewicht. Denn das haben die Kommunen und die Länder. Leider hat man auch im Rahmen des Verfassungskonvents die Chance vergeben, solche überregionalen Konzepte mit Kompetenzen auszustatten.
Die Furche: Mitschuld an der Misere wird von vielen auch die Pendlerpauschale gemacht ...
Fassmann: Dieses Pauschale war durchaus nicht sinnlos, um etwa die Bevölkerung der weit entfernten Gebiete oder Grenzgebiete dort zu halten und ihnen zu ermöglichen, in der Stadt zu arbeiten. Wenn jemand täglich aus dem Südburgenland nach Wien pendelt, dann wird die Situation im Südburgenland stabilisiert. Wenn man also die so genannten "Problempendler" damit unterstützt, dann hat es Sinn. Aber man muss es sicher kritisch überprüfen, ob man damit nicht die Suburbanisierung subventioniert.
Die Furche: Eine Stadtumlandsiedlung, die sich dezidiert an die Bestverdienenden richtet, ist der "Wohnpark Fontana" von Frank Stronachs Magna-Konzern in Oberwaltersdorf. Sie haben ein Forschungsprojekt dazu begonnen. Gibt es schon Erkenntnisse?
Fassmann: Diese Siedlung ist insofern interessant, als Suburbanisierung ja normalerweise "chaotisch" abläuft: Jeder baut sein eigenes Häuschen mit Hilfe der Nachbarn oder sonstiger Schwarzarbeiter und jeder versucht, seine Idealvorstellung vom Wohnen zu realisieren. "Fontana" ist ein Gegenmodell dazu: Hier baut nicht der Einzelne, sondern es gibt einen zentralen Investor, der auch die Richtlinien vorgibt - in diesem Fall die Magna, die auch bestimmte architektonische Richtlinien vorgibt. Magna hat hier eine us-amerikanische suburbane Siedlung fast 1:1 nach Österreich transportiert. Im Herzen dieser Siedlung sind ein Golfplatz, ein Tennisplatz und ein künstlich angelegter See. Rundherum gruppieren sich die Häuser und Villen. Alles ist durchkonzipiert - auch die Straßen- und Gartenräume. Das Ziel war, dass die Bewohner nicht länger als 20 Minuten nach Wien fahren - und nur 20 Minuten zum Flughafen brauchen.
Die Furche: Eine Siedlung für internationale Manager und die Upperclass-Community also ...
Fassmann: Die Bewohner haben zumindest eine soziale Selektion hinter sich: Schließlich haben sie einen nicht ganz billigen Kaufpreis leisten müssen. Gleichzeitig haben sie auch ähnliche Interessen: Golfspielen, Freizeitorientierung. Mittlerweile gibt es hier 75 Villen und 108 Wohnungen.
Die Furche: Gibt es hier auch Einkaufsmöglichkeiten?
Fassmann: Nein, die gibt es außerhalb - was auch sehr amerikanisch ist: In diesen kleineren, suburbanen Siedlungen gibt es keine Geschäfte, denn die könnten auch Kriminalität anziehen. Und das will man draußen haben.
Die Furche: Wird "Fontana" bewacht?
Fassmann: Noch nicht, aber auch das wird es bald geben. Es gibt eine Einfahrt und einen Berg. Und der Magna-Konzern beginnt diese Idee jetzt auch nach Bratislava und Prag zu exportieren. Das sind eben suburbane Trends. Aber sicherlich gilt es, die Auswüchse solcher Trends zu stoppen.
Die Furche: Was könnten die Städte selber dafür tun?
Fassmann: Sie müssten sich überlegen: Wie können wir selbst suburban sein? Inwieweit können wir zukünftigen Mietern und Eigentumswohnungsbesitzern die Freiräume offerieren, die sie sonst irgendwo in Wolkersdorf oder Mistelbach suchen? Wie können wir so etwas wie dörflichen Charakter in Neubausiedlungen hineinbringen? Denn das ist es, was die Menschen in der Suburbia suchen: Nachbarschaft, Gespräche, gemeinsame Events.
Die Furche: Gibt es etwa in Wien ein Beispiel, bei dem eine solche "Suburbanisierung" innerhalb der Kernstadt gelungen ist?
Fassmann: Ein interessantes Beispiel ist der Wohnpark Alterlaa von Harry Glück. Er hat es geschafft, dort dörfliche Atmosphäre zu erzeugen - obwohl es sich um einen großvolumigen Geschoßwohnbau handelt. Um sein Konzept des "vollwertigen Wohnens" zu erreichen, hat er bestimmte Freizeiteinrichtungen zur Verfügung stellt und Orte der Begegnung geschaffen, wo sich Leute treffen können. Auch ein eigenes Hausradio gibt es. Harry Glücks Idee war es, die Einfamilienhäuser nicht auf einer Fläche zu verteilen, sondern übereinander zu "stapeln" - und den Menschen mit großzügigen Grünflächen die gleiche Qualität wie in einem Einfamilienhaus zu offerieren. Und das ist in Alterlaa ganz gut gelungen. In diesen sechs Wohntürmen leben 10.000 Menschen - mehr als in Eisenstadt. Aber fragen Sie die Bewohner: Die leben gern dort. Hier herrscht die höchste Wohnzufriedenheit. Solche Projekte müssen die Städte experimentell, aber auch ernsthaft durchsetzen. Erst dann nehmen sie den Menschen den Appetit auf das Wohnen in der Suburbia.
Das Gespräch führte
Doris Helmberger.