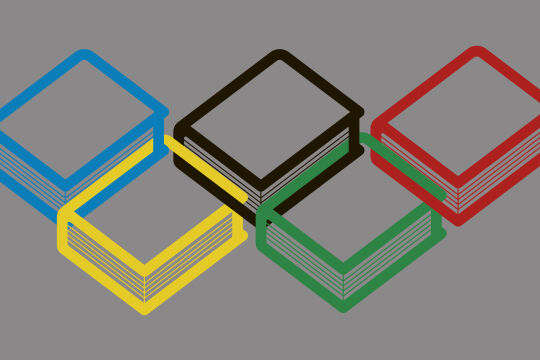Der Skizirkus braucht Helden. Der Österreichische Skiverband ist ihre Kaderschmiede. Der Weg an die Spitze ist hart und eine Gratwanderung, die Opfer fordert.
Ich habe es geschafft, denkt der junge Läufer. Jetzt gehöre ich auch dazu. Er reißt die Ski in die Höhe und schreit seine Freude hinaus in die kalte Winterluft von Val d'Isère. Es ist der 15. Dezember 1996. Fritz Strobl, 24 Jahre alt, hat seine erste Abfahrt gewonnen. "Der schönste Sieg", sagt Strobl heute. Der Mann, der in den zehn Jahren darauf neun Weltcupsiege feiert, Olympiasieger und Weltmeister wird. Der Mann, der trotzdem weiß, wie eng Sieg und Niederlage beisammenliegen können, wie hart der Weg zum Skistar ist und wie wenige es bis an die Spitze schaffen. "Der Weg zum Erfolg ist ein Mosaik aus vielen Steinen. Natürlich hatte ich Glück, aber ich habe auch hart dafür gearbeitet."
Als er am Podium steht, dort, wo in Kürze die WM über die Bühne geht, liegen fünf holprige Lehrjahre hinter ihm, seit er mit 19 Jahren, spät aber doch, den Sprung ins ÖSV-Team schaffte. Schon früh beginnt in Österreich eine harte Auslese. Die Zehn- bis 14-Jährigen werden auf ihr Talent abgeklopft. Die Konkurrenz ist groß, und der Platz in den Skigymnasien begrenzt. Wer am Anfang nicht genug Unterstützung von Eltern oder Skiclub hat, wird es kaum in einen Kader schaffen. Talent ist Voraussetzung, aber Talent haben viele.
Sturz, Schmerz - und dann die Sinnfrage
Auch Strobl hat zu kämpfen. Er ist ein Spätstarter und als Jugendlicher seinen Kollegen immer einen Schritt hinterher. Sein erster Weltcupeinsatz in Garmisch 1991 verläuft zufriedenstellend. Nach einer Knieluxation geht aber nicht mehr viel. Er kann die Trainingsleistung nicht umsetzten und stellt bereits die Sinnfrage. Nach den ersten Abfahrtspunkten in Kitzbühel 1994 wechselt Hans Knauss zu den Abfahrern und Strobl verliert jede Qualifikation gegen ihn. Die goldene Zeit des ÖSV mit einer Handvoll Siegläufer in jeder Disziplin beginnt. Und Strobl entscheidet sich loszulassen. Er lehnt Starts mit hohen Nummern im Weltcup ab und fährt nur noch Europacup. Dort sichert er sich einen Fixplatz für die nächste Weltcupsaison, wo ihm 1996 der Knopf aufgeht. Er bleibt von Verletzungen verschont. Die Gewissheit, zu den Besten zu gehören, beflügelt ihn. Und, gibt er zu, dass es sich im ÖSV natürlich leichter lebt, "wenn man zu den drei, vier besten gehört".
Das straff organisierten System des ÖSV mit 38 Millionen Euro Jahresbudget bezeichnet der Schweizer Skipräsident als das Nonplusultra. Auf 450 Sportler kommen 100 Betreuer, was besser ist als bei jedem Fußballverein. "Wenn man zu den Besten gehört, dann tun sie dir alles", sagt der 35-jährige Vorarlberger Kilian Albrecht, der mittlerweile für Bulgarien fährt. "Aber sonst bist du halt der Mitläufer" - und als solcher bei Großereignissen, wenn zwei, drei Fahrer um einen Startplatz kämpfen, auch auf die Entscheidung der Trainer angewiesen. In seiner Karriere fuhr Albrecht zwanzigmal unter die Top Ten. In anderen Ländern wäre man damit ein Megastar, sagt er. "In Österreich interessiert das aber niemanden. Da bist du ein Looser."
Oft entscheiden Momente über den Verlauf einer Karriere. Albrecht erlebte einen solchen vor der Ski-WM in St. Anton 2001. Wegen einer Bänderverletzung kann er kaum trainieren. In den Rennen wird er aber Fünfter und Sechster, in Schladming Vierter. Nach Weltcuppunkten klar Viertbester, muss er trotzdem zu Hause bleiben. "Das wäre meine große Chance gewesen. Bitter." Aber gut, seufzt er, der Erfolg gebe dem ÖSV ja recht. Richtig wohl gefühlt habe er sich dort aber nie. Wenn das Umfeld nicht hundertprozentig passt, wird es doppelt schwer. Albrecht sagt, er selbst sei immer irgendwie anders gewesen, habe nebenbei studiert. Das sei nicht immer gut angekommen. Viele Skiprofis haben, wenn es mit dem Sport einmal aus ist, nicht mehr als einen Schulabschluss.
Manche Karriere endet früh im OP-Saal
Wer es schaffen will, muss aber vor allem eines können: Den Körper schinden und Verletzungen wegstecken. Diese fallen auf den vereisten Pisten, bei dem aggressiven Material, das benutzt wird, immer gravierender aus. Viele Karrieren enden auf dem Operationstisch, bevor sie richtig angefangen haben. Christine Sponring ist eines jener Riesentalente, dessen Körper nicht mithalten konnte. Mit 16 Jahren belegt sie bei der Junioren-WM Rang drei. Ein Jahr später, 2001, geht bei der Heim-WM in St. Anton, an der Albrecht verzweifelte, ihr Stern auf. Sie wird zweite in der Kombination.
Im Dezember 2003, bei der Abfahrt in St. Moritz, nimmt sie den Zielhang zu direkt, muss korrigieren, und die Ski verkanten. Als sie im Fangnetz liegt, ist das Kreuzband gerissen und die Schulter ausgekegelt. Das Rennen gewinnt Renate Götschl, ihr Vorbild: "Eine coole Socke, die sich nichts pfeift und immer erfolgreich war." Für Sponring ist es nur die erste in einer ganzen Reihe schwerer Verletzungen. Diesen Jänner hat sie ihren Rücktritt erklärt. Das sei hart gewesen: "Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht so enden mit mir, aber dann war mir klar, dass es nicht mehr viel Sinn hat. Ich hätte schon noch alles probieren können, aber nach dem Sport gibt es auch noch ein Leben. Da will ich gesund durch die Gegend laufen." In Kürze fängt sie wieder in der Polizeischule an. Heute würde sie alles wieder genauso machen: das Sportlerleben, das Reisen. Gedacht habe sie im Skizirkus von Rennen zu Rennen. Zu viel nachzudenken sei nicht ratsam, wenn das Risiko ständig mitfährt.
Erst Medien machen aus Athleten die Stars
"Du darfst nicht denken, wenn du an den Start gehst", sagt Alexandra Meissnitzer, auch schon in Skipension. Sie hat den Temporausch im Skisport heftig kritisiert. Mittlerweile bemüht sich die FIS, über die Kurssetzung etwas Tempo aus den Läufen zu nehmen. Leider kommt es weiterhin zu Horrorstürzen wie jenem von Daniel Albrecht in Kitzbühel. Also nicht zu viel denken, aber locker bleiben im Kopf. Leichter gesagt als getan. Als Meissnitzer als 18-Jährige in den Weltcup kam, galt sie als Nervenbündel. Die chinesische Meditationsform Quigong half ihr später dabei, ruhiger zu werden. Es folgte eine Bilderbuchkarriere. Mittlerweile greift die Trainingswissenschaft auf Hilfsmittel zurück, über die Trainer vor Jahren wohl noch den Kopf geschüttelt hätten. An der Spitze sind die letzten Zehntel zwischen Rang zehn und dem Siegespodest oft der längste und härteste Weg.
Wer ein Star werden will, muss aber auch Terminstress aushalten, schulterklopfende Politiker, Interviews. Das Fernsehen diktiert und finanziert nicht nur den Sport, es ermöglicht den Athleten, überhaupt erst eine Aura zu gewinnen. Slalomfahrer Rainer Schönfelder, selbsternannter Paradiesvogel, nutzt das Rampenlicht bei jeder Gelegenheit. "Wir leben von dieser Öffentlichkeit", sagt er. "Was wäre der Skisport ohne die Begeisterung der Skifans und das Interesse der Medien? Wer bin ich dann? Zu einem Skifahrer gehört nicht nur, dass er Ski fährt. Wir müssen auch auf anderer Ebene etwas zurückgeben." Schönfelder nutzt gerade eine Verletzungspause, um sich den Zirkus von außen anzusehen. Wenn er über seine Erkenntnisse erzählt, klingt er wie ein Formel-1-Fahrer, der über das Setup seines Autos spricht. Er habe durch TV-Studien erkannt, was in der "Kraftübertragungskette Fuß-Schuh-Bindung-Bindungsplatte-Ski" zu verbessern sein könnte. Man sei ständig mit der Reduktion von Komplexität beschäftigt. Dabei würde man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Schönfelder ist überzeugt, dass eine Auszeit viele Sportler weiterbringt, nicht nur was die Motivation betrifft: "Weil sie mehr gelernt haben, als wären sie im Hamsterrad geblieben."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!