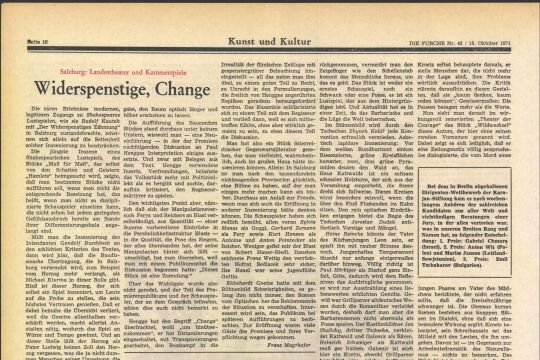Am Bayerischen Staatsschauspiel in München hat mit Martin Kusˇej eine neue Ära begonnen. Die ersten Premieren konnten indes nicht den hochgesteckten Erwartungen entsprechen.
Den Anfang des mehrtägigen Premierenreigens zur Spielzeiteröffnung besorgte der neue Hausherr gleich selbst. Die mit Spannung erwartete Inszenierung von Arthur Schnitzlers "Das weite Land“ war allerdings eine Enttäuschung. Denn was man am vergangenen Donnerstag zu sehen bekam, war keine Kusˇej-Inszenierung, wie man sie kennt und wie man sie erwartet hätte. Er, der mit Vorliebe Texte aufsprengt und in starke Bilder übersetzt, hat sich - wie er in einem Interview beteuerte - mehr für die seelischen Vorgänge interessiert. Nur gerade Martin Zehetgrubers Bühne ist ein bildmächtiges Zeichen für die Grausamkeiten einer heuchlerischen, verlogenen Gesellschaft, die Wasser predigt und Wein säuft, die vordergründig den Schein von Ordnung aufrechterhält, um sich im Verborgenen umso hemmungsloser dem Chaos hedonistischer Sehnsüchte und dunkler Triebe zu überlassen.
Über weite Strecken aber ist Kusˇejs Inszenierung ein Kammerspiel im Stil des psychologischen Realismus, dessen Ton so fein ziseliert, so intim ist, dass es die Rampe kaum zu überspringen vermag. Nur gerade ein, zwei Ideen nimmt sich der Regisseur heraus.
Im strömenden Regen
So lässt er die Szene, in welcher Friedrich Genia mit einiger Perfidie vorwirft, sie sei eigentlich Schuld am Selbstmord des Pianisten Korsakow, weil sie sich ihm nicht hingegeben habe, und diese Tugendhaftigkeit sei ihm nachgerade unheimlich, zweimal spielen. Unter den Blicken aller anderen soll die Wiederholung wohl so etwas wie eine Rechtfertigung seines weiteren Tuns bedeuten. Rätselhafter bleibt dagegen, warum die Gesellschaft vom Tennisspielen immer blutverschmiert zurückkommt. In der Anfangs- und Schlussszene lässt er die Figuren vereinzelt in strömendem Regen stehen, ein Bild, das unfreiwillig den Abend charakterisiert. Denn die Menschen begegnen einander hier kaum wirklich, sie ringen nicht miteinander, sondern verfehlen sich auf dieser breiten Bühne.
Kusˇej geizt mit Ideen, inszeniert - von kräftigen Kürzungen abgesehen - texttreu, was während der drei Stunden überwiegend Langeweile produziert. Daran vermögen auch die hochkarätigen Schauspieler nichts zu ändern: Tobias Moretti spielt den notorischen Ehebrecher Friedrich Hofreiter weniger als erotischen Hasardeur und virilen Gewaltmenschen, als vielmehr einen von gähnender innerer Leere Heimgesuchten. Juliane Köhler als seine Frau Genia ist eine ratlose, verhärmte Statue ohne andere Gefühle. Alle weiteren Figuren bleiben ebenso blass. Nur Markus Hering als Dr. Mauer glaubt man seinen Schmerz über das, was das Leben mit der Liebe anstellt.
Der zweite Abend im Premierenmarathon ist dem Lokalmatador Franz Josef Strauß gewidmet. Der Münchner Dramatiker Albert Ostermaier fühlte in dem Auftragswerk dem Mythos des deutschen Politikers auf den Zahn. Strauß’ zahlreiche Korruptionsaffären, seine Allmachtsfantasien und politischen Winkelzüge gestaltet Ostermaier als Farce, die er mit antiken Motiven und basalen Konflikten montiert. Strauß selbst lässt er allerdings in seiner Groteske mit dem Titel "Halali“ nicht auftreten, sondern nur einen, der sich einbildet, Strauß zu sein (Jörg Ratjen). Damit situiert Ostermaier die Szene in einem Irrenhaus mit vielen weiteren Patienten.
Regisseur Stephan Rottkamp hat mit Ostermaiers Textkonvolut offenbar wenig anzufangen gewusst. An der Nebenbühne, dem Cuvilliés-Theater (dessen Zuschauerraum spiegelverkehrt als Bühnenbild dient), hat Rottkamp eine Halali-Show inszeniert, die mit plakativen Regie-Einfällen (überdimensionale Backhendl, Straußens Leibspeise, konkurrenzieren mit den von Strauß erlegten Hirschen) über das mangelnde Textverständnis hinwegzutäuschen sucht. Der dennoch freundliche Premierenapplaus galt wohl eher dem "Original Royal Bavarian deep Beat Heart Rock Orchestra“ sowie dem engagierten Spiel des Ensembles.
Nach den wenig befriedigenden ersten beiden Premieren lagen die Erwartungen umso höher, dass Altmeister Wilfried Minks die deutschsprachige Erstaufführung von Neil LaButes "Zur Mittagsstunde“ zum erhofften Erfolg führen möge. Doch auch Minks’ minimalistische Inszenierung zeigte sich unspektakulär und wenig innovativ.
In sieben Szenen wird die Entwicklung von John (Norman Hacker) gezeigt, der als einziger den Amoklauf eines Bürokollegen überlebt, "ein Wunder“, wie er es darstellt, das ihn zu einem besseren Leben verpflichtet. Im Moment der Todesangst habe er eine Stimme gehört, Gottes Stimme, und sei in himmlisches Licht gebettet gewesen, welches Minks, der ja eigentlich nicht von der Regie, sondern vom Bühnenbild kommt, als inszenatorisches Mittel einsetzt: Grellweißer Hintergrund blendet das Publikum und markiert den Wechsel der Szenen, die John jeweils im Zwiegespräch mit seinem Anwalt (Arnulf Schumacher), seiner Ex-Frau (Katrin Röver) oder seiner Geliebten Jesse (Andrea Wenzl) zeigen. Der "neue“ John verkauft seine Interessen nun im Namen Gottes, aber gut gemeint heißt noch lange nicht gut. Der Glaube bzw. die Geschichte eines Mannes, "der versucht, ein guter Mensch zu sein, aber von seinem bisherigen Leben daran gehindert wird“, sind angesichts der aktuellen Katastrophen tatsächlich ein wichtiges Thema, welches LaBute allerdings recht variationsarm behandelt. Und auch Minks gelingt es kaum, die Spannung innerhalb der Beziehungen sichtbar zu machen. Trotz der überzeugenden Einzelleistungen der Schauspieler findet kaum ein Miteinander statt.
Sterbende neben Schwangeren
Die vorerst letzte Premiere war an der dritten Bühne des Residenztheaters, dem Marstall, zu sehen. Helmut Krausser benannte sein Stück nach dem isländischen Vulkan "Eyjafjallajökull-Tam-Tam“. Auf dem dortigen Flughafen spielt das von Robert Lehniger inszenierte Stationendrama, das auf Chaotik angelegt ist. Das Publikum geht durch lange Gänge in zwei Abflughallen, die das Chaos abbilden, welches in derartigen Situationen entsteht. Krausser verbindet die großen Lebensfragen mit momentanen Beziehungsproblemen, setzt Sterbende neben Schwangere und bildet den eigenen Betrieb ab, etwa wenn die Schauspielerin Ulrike Willenbacher zunehmend unter Druck gerät, weil sie zur Vorstellung muss. 55 Menschen, also das gesamte Ensemble, treffen auf ein Publikum, das sich die Frage stellt, was die zukünftigen Premieren wohl bringen. Luft nach oben ist da jedenfalls noch genügend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!