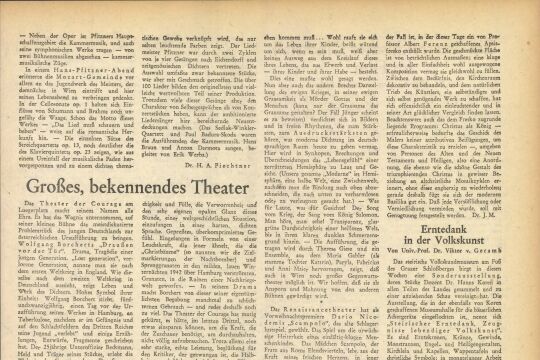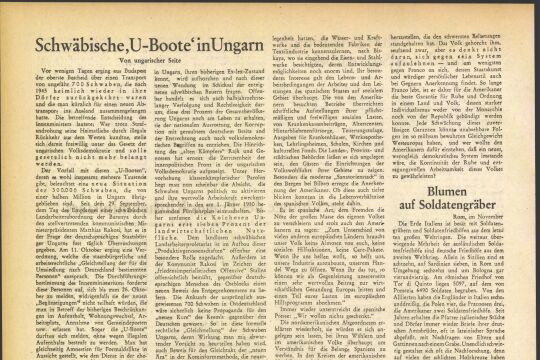„Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung“ von Kevin Rittberger: Das Schauspielhaus Wien widmet sich in der jüngsten Produktion den afrikanischen Flüchtlingsschicksalen.
Sie ereignen sich zu Tausenden, die Geschichten derjenigen, die aus der durch Bürgerkrieg bedrohenden, durch Armut bedrückenden und zukunftslosen Lebenssituation in Schwarzafrika den Weg nach Europa wagen. Sicher gibt es noch immer viele Menschen, die das Risiko der Überfahrt bis heute nicht kennen, die nicht wissen oder nicht glauben wollen, was sie erwartet. Aber ist es nicht allzu bequem, genau das immer zu behaupten, zumal Europa beträchtliche Summen investiert, um die Menschen vor Ort schon aufzuklären? Die europäischen Regierungen gehen noch immer den einfacheren Weg, statt die Ursachen der Migration zu bekämpfen. Trotzdem träumt nahezu jeder junge Mensch auf dem Kontinent davon, das Elend und die Perspektivenlosigkeit hinter sich zu lassen.
Hölle aus Lager, Illegalität, Kälte, Ablehnung
Dass der Tausende Kilometer lange Weg durch Steppe, Wüste und über das Meer gefährlich, ja für viele tödlich ist und dass die Flüchtlinge im vermeintlichen Paradies Europa eine Hölle aus Lager, Illegalität, Zwangsprostitution, Kälte und Ablehnung und nur allzu oft Abschiebung erwartet, hat sich auch in Nigeria, Mali, Sierra Leone, Ghana, Liberia, Senegal oder der Elfenbeinküste herumgesprochen. Und trotzdem kommen sie.
Was in diesen Menschen vorgeht, ist Ausgangspunkt des neuen Stückes des 1977 in Stuttgart geborenen Dramatikers Kevin Rittberger. Auf der Grundlage zahlreicher Gespräche mit Migranten an den Stränden Spaniens ist „Kassandra oder die Welt als Ende der Vorstellung“, wie der etwas hochtrabende, an Schopenhauer angelehnte Titel lautet, entstanden. Regisseurin Felicitas Brucker hat am Wiener Schauspielhaus die Uraufführung inszeniert. Rittberger unterlegt die Geschichte der afrikanischen Immigranten mit dem antiken Stoff der Kassandra, deren Schicksal es bekanntlich war, Unheil vorauszusehen, ohne dass ihr jemand Glauben schenkte, und die selbst dem eigenen vorhergesehenen Tod nicht entrinnen konnte.
Das Stück besteht aus zwei Teilen: Am Anfang hocken die sechs Ensemblemitglieder auf der hinten ansteigenden Bretterrampe des auf drei Seiten von bedruckten Plastikplanen begrenzten Bühnenraums von Frauke Löffel und bemalen sich gegenseitig die Gesichter mit schwarzer Farbe. „Da ist die Geschichte von …“, sagen sie immer wieder, um die Universalisierung der Existenz von Flüchtlingen zu unterstreichen. In einer Mischung aus Dokument und Fiktion schildert das Stück im ersten Teil des pausenlosen zweistündigen Abends die wahre Geschichte der zwanzigjährigen Nigerianerin Blessing. Sie „verdient“ sich die Überfahrt nach Europa, indem sie ihren Körper verkauft. Die fünfjährige Odyssee führt sie durch die Sahara nach Marokko, von wo sie die Überfahrt auf einem Fischerboot auf die Kanarischen Inseln oder auf das spanische Festland erhofft. Dort wird sie aber nie ankommen, denn das hoffnungslos überfüllte Boot kentert, und sie ertrinkt mit ihren beiden Kindern und zahllosen anderen Namenlosen.
Ganz nach Brechts Lehrstückidee schafft Brucker Distanz. Indem sie verschiedene Verfremdungseffekte inszeniert. Die offene Verwandlung der Darsteller, der Rollenswitch, die Verwendung der Bretter, die mal als Schutzwall der Festung Europa, mal als unsicheres Flüchtlingsboot oder als Schrifttafel dienen, oder der epische Erzählgestus sollen die Einfühlung verhindern. Das ist nicht schlecht gemacht, nur wirken die V-Effekte als theorie-lastiger Überbau, unter dem das Thema zu verschwinden droht. Denn einerseits sind sie wenig konsequent inszeniert und andererseits: Warum etwas verfremden, das sowieso das Vorstellungsvermögen übersteigt?
Rittbergers Anspruch bleibt unerfüllt
Der zweite Teil des Abends ist der europäischen Flüchtlingspolitik gewidmet und durch Medienkritik bestimmt. Die Darsteller, nun mit weiß bemalten Gesichtern, mimen Frontex-Beamte, die in absurd anmutenden Befragungen die Flüchtlinge tanzen, singen oder Gerichte aus der Heimat kochen lassen, um auf diese Weise ihre Herkunft zu ermitteln, die Grundlage, um sie abschieben zu können. Oder sie spielen Intellektuelle, die ebenso verzweifelt wie vergebens gegen die Ungerechtigkeit der Welt anschreiben. Da ist auch die Dokumentarfilmerin, die Risiken auf sich zu nehmen bereit ist, die mit aufs Boot will, um endlich authentische Bilder, den „anderen Blick“ zu bekommen, oder ein anderer Journalist, der lieber nicht nur dokumentieren als vielmehr helfen würde, der das „Leben nicht gegen Sprache eintauschen“ will.
Die Absicht Rittbergers ist ehrenwert und sympathisch. Aber sein Stück vermag auch künstlerisch kaum über das Gut-Gemeinte hinauszukommen. Er vermag der Sprachlosigkeit der Welt im Angesicht der obszönen Zustände keine eigene Form (der Sprachlosigkeit) zu geben. Sein Anspruch, zu beleuchten, warum in Afrika jene Hoffnungslosigkeit bleibt, die Menschen dazu treibt, alles zu opfern, vielleicht sogar den letzten und einzigen Besitz, ihr Leben, bleibt unerfüllt. Aber vermutlich übersteigt das jedes Vorstellungsvermögen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!