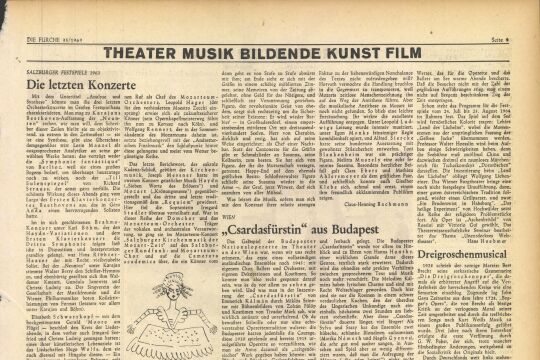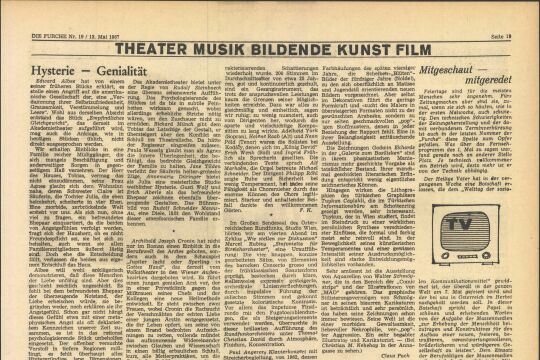Verklemmt ist an der Grazer Oper in der Neuinszenierung von Mozarts „Le nozze di Figaro“ durch Josef E. Köpplinger nicht bloß der Kühlschrank im Durchgehzimmer.
Nur mit dem Trick eines Fußtrittes lässt sich der Kühlschrank im Durchgehzimmer öffnen, wo Susanna ihre Brautnacht offenbar schon konsumiert hat und deshalb, ohne das unsägliche Gerenne zu hören, mit dem der Regisseur und Stadttheaterintendant Mozarts Ouvertüre in Grund und Boden trampelt, in den Armen ihres Figaro dahinschlummert. Dieser, dann Cherubino, dann der Graf dürfen hektisch abgreifen, wie Susannas „G’spaßlaberln“ und wohlgeformtes Gesäß beschaffen sind. Verklemmter geht’s nicht.
Für den Schnürboden gesungen
In der gräflichen Bruchbude, die zwar hinter einer Tapetentüre ein rudimentäres Bad birgt, aber sonst von einem zur Rumpelkammer devastierten Schlosstheater dominiert wird, möchte wohl niemand wohnen bleiben, außer der Gräfin, über deren Ehebett nicht nur der Graf mit Schuhen latscht. Immerhin verfügt sie über eine vielseitige Garderobe im begehbaren Wandschrank. Johannes Leiackers Bühne krankt zusätzlich daran, dass kein Schalldeckel den von Köpplinger gerne auf die Hinterbühne verbannten Sängern bei der Bewältigung ihrer feinsten Kantilenen hilft. Da wundert es auch nicht, dass Dirigent Tecwyn Evans mit dem hydraulisch hochgefahrenen Orchester keine dynamische Rücksicht auf die in ihren Partien debütierenden Protagonisten übt.
Also wird entgegen Mozarts Intentionen für den Schnürboden gesungen. So wurstig geht man auch mit anderen Details um. Der Graf führt zwar einen luxuriösen Jagdhund, geht aber in seinem besten Gewand auf die Jagd. Susanna trägt Demelinerinnen-Schwarz, Cherubino Jeans und Turnschuhe, dann den verhassten Tricornio der Guardia Civil. Auch der kurze Prozess um ein angebliches Eheversprechen, in dem der Graf und Don Curzio Figaro „legen“ wollen, scheitert en passant.
All dies wäre tolerierbar, begingen Köpplinger, Leiacker und Evans nicht im vierten Akt in bandenähnlichem Einvernehmen die öffentliche Hinrichtung jenes für Dramaturgie und Emotionalität, Erotik und Weltdeutung gleichermaßen paradigmatische Herzschlagfinale. Da sind keine Parkbäume, Lover Chairs, duftenden Rosenbüsche und schattigen Irrgärten der Liebe, nur derbe Ratlosigkeit.
Eigentlich schade, denn sowohl im Orchester (bis auf ein nicht vom Dirigenten gespieltes Cembalo) als auch im vielfachen Debütanten-Ensemble war Mozart dennoch partiell zu erleben. Am eindrucksvollsten bei der kräftig ruppigen Revoluzzerstimme des schon bühnenerprobten Figaro aus Taschkent: Alik Abdukayumov zeigt Bauernschläue im Spiel, liebevolle Verzweiflung in der Mimik und bassgrundierte vokale Dominanz. Seine blonde Susanna (Margareta Klobuèar) kann nicht nur durch ihren Körpereinsatz, sondern auch durch glasklare stimmliche Bravour plausibel machen, dass pubertierender Teen, eifersüchtiger Bräutigam, intriganter Musiklehrer und um sein ius primae noctis (das es in der Zeit, wohin Köpplinger die Oper ohne Not versetzt hat, nicht mehr gibt) geifernder Graf nach ihren Qualitäten lechzen.
Elegante Melancholie im farbreichen Timbre machen Gal James zu einer eindrucksvollen Gräfin, der vokal und darstellerisch stocksteife ukrainische Graf Igor Gnidii wird von der Landsmännin Christina Daletska als umtriebigem Cherubino an die Wand gespielt. Köstlich zwei Stützen des Hauses in Reife-Rollen: Fran Lubahn als aufgetakelte heiratswillige Marzellina und David McShane als aufsässiger Gärtner Antonio. Meisterliche Charakterporträts skizzieren Wilfried Zelinka als orgelnder Bartolo und Manuel von Senden wie ein Adabei-Reporter mitschreibender Intrigant Basilio – hier zeigt Köpplinger handwerkliche Finesse.
Gesinnungslose Kraftmeierei
Was soll man als Kritiker, der in vier Jahrzehnten Produktionen des „Figaro“ in Salzburg, Drottningholm oder Glyndebourne bewundern durfte,von jenem Aushöhlungsprozess halten, den der Opernbetrieb und sein noch zahlendes Publikum heute quer durch Europa offenbar meinungs- und wehrlos hinnimmt? Mag sein, dass Mozart und Da Ponte, zwei weltlich Gesonnenen, die hemmungslose Fummelei in Graz gefallen hätte. Die verinszenierte Ouvertüre, der heruntergenudelte Rechtsstreit, das ohne Rücksicht auf die Komposition durchgezogene Finale sind gesinnungslose Kraftmeierei.