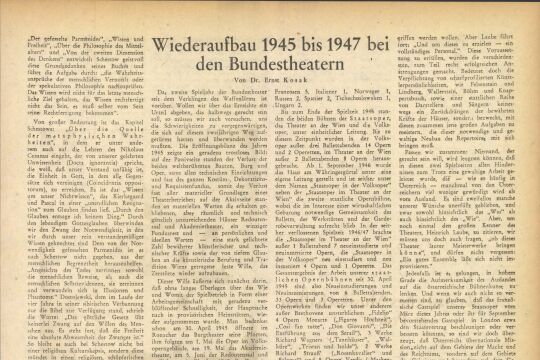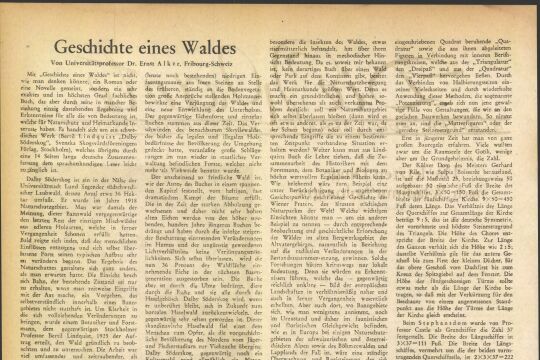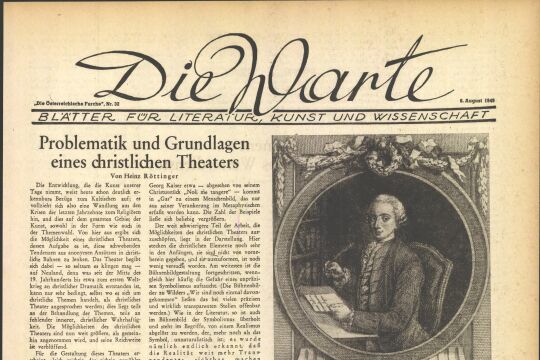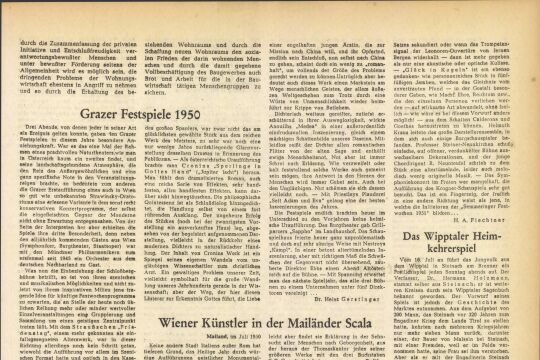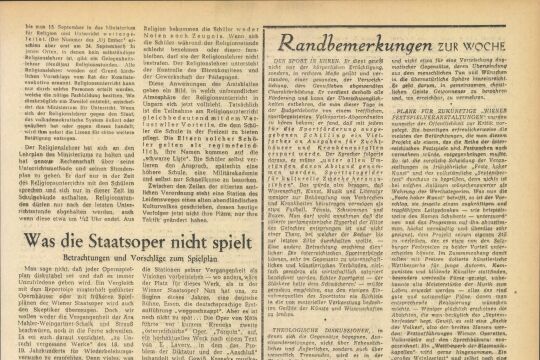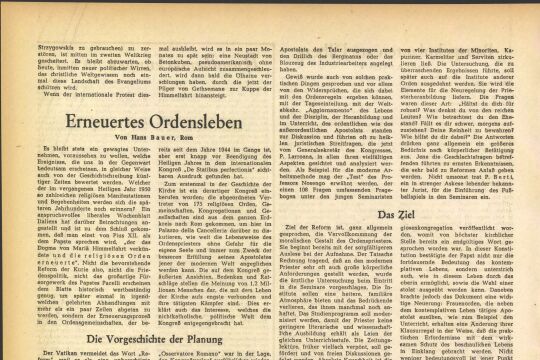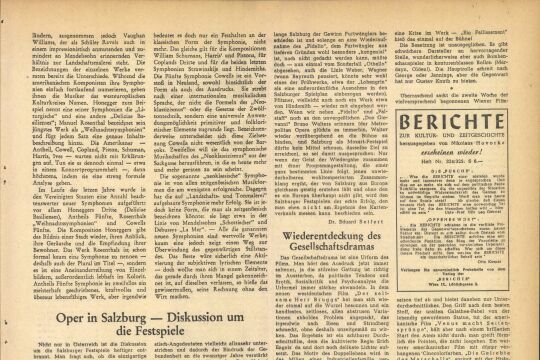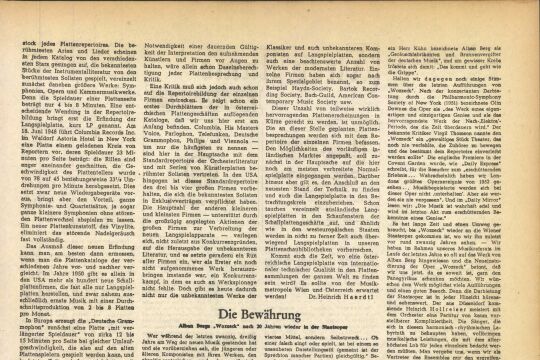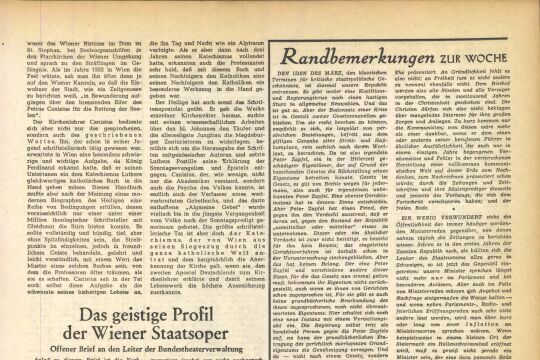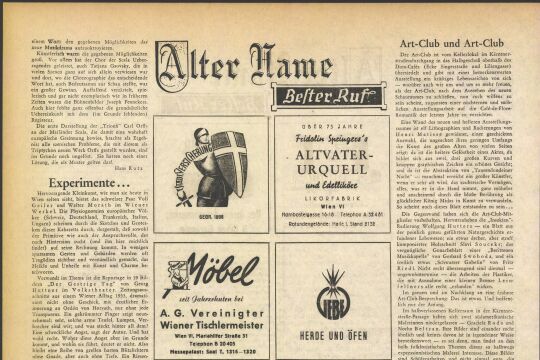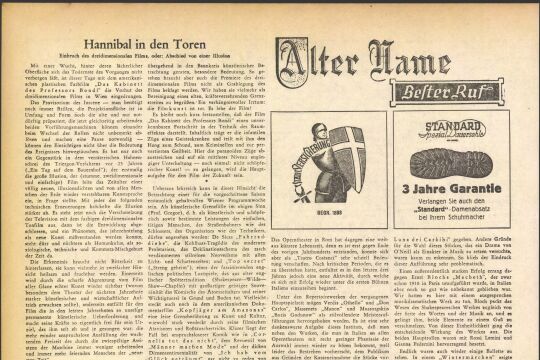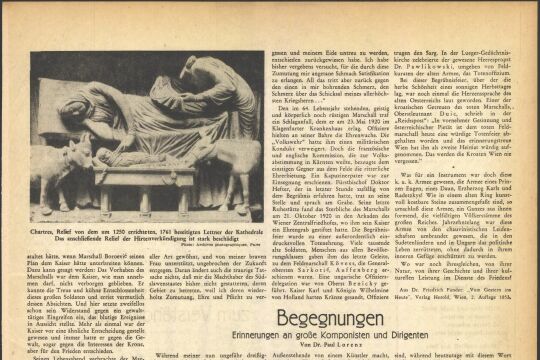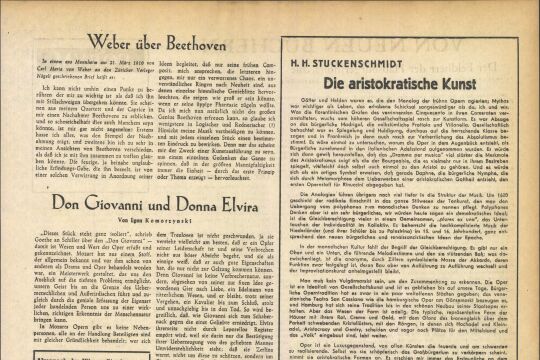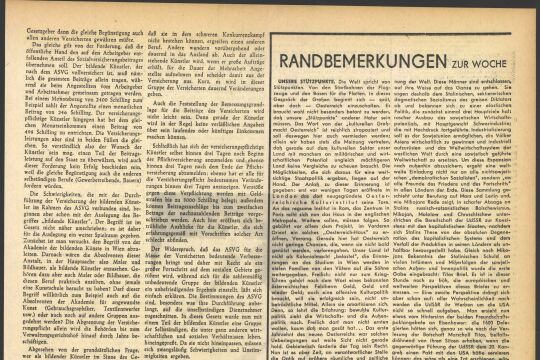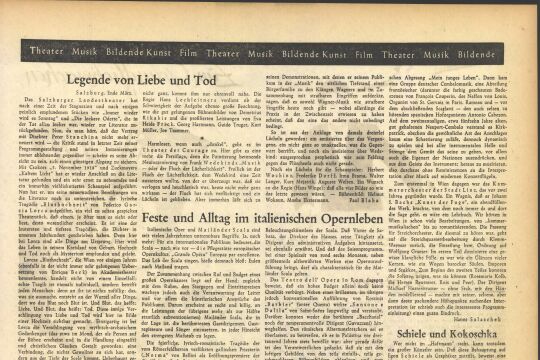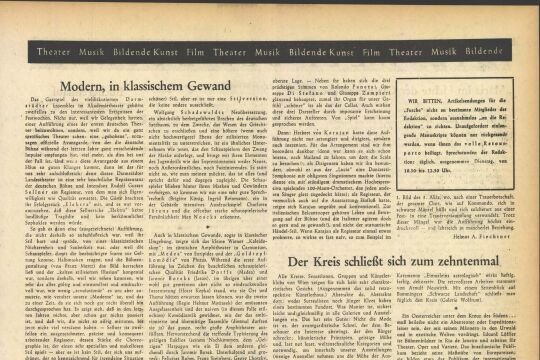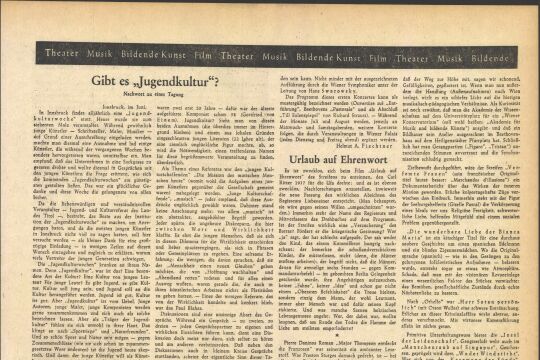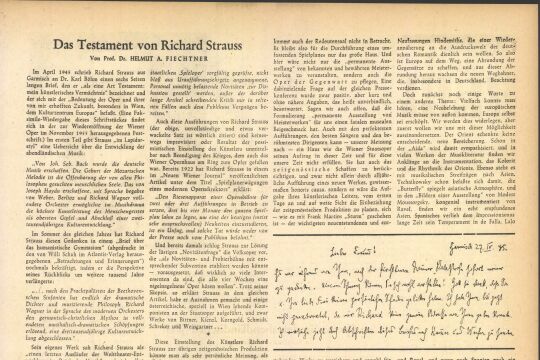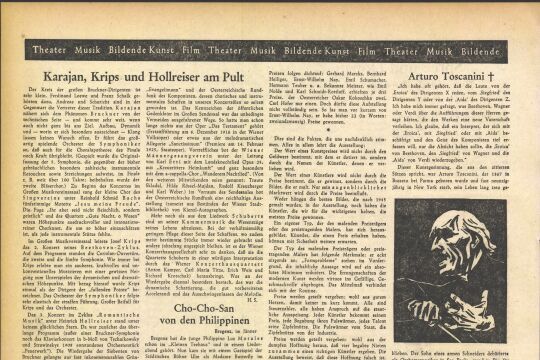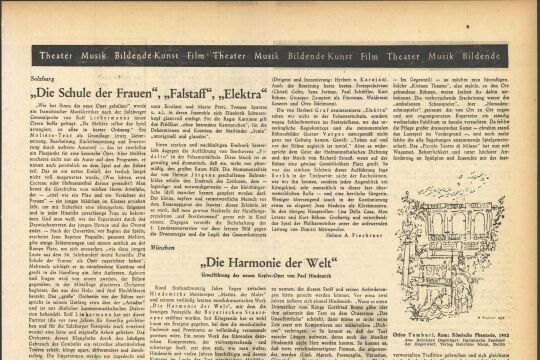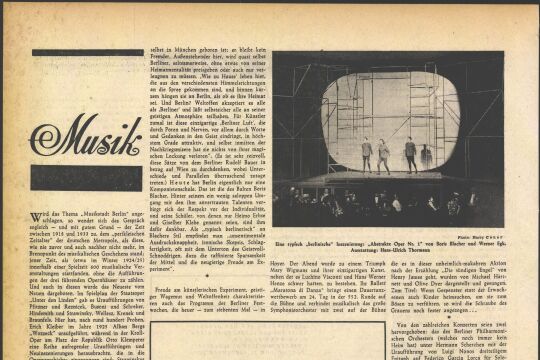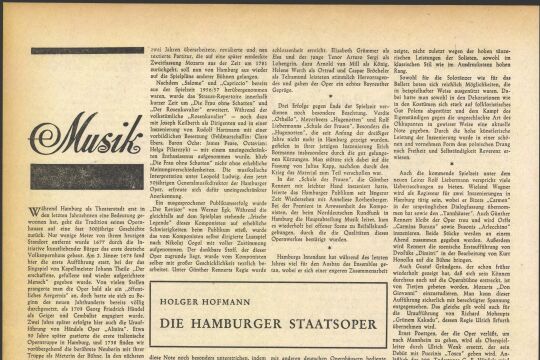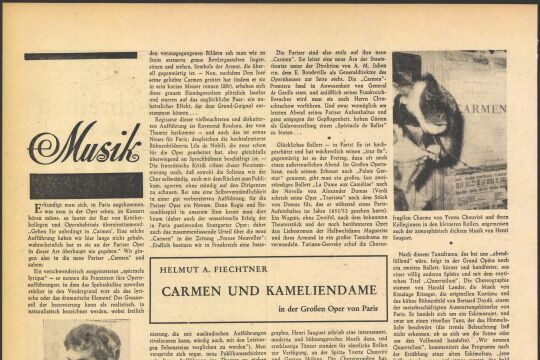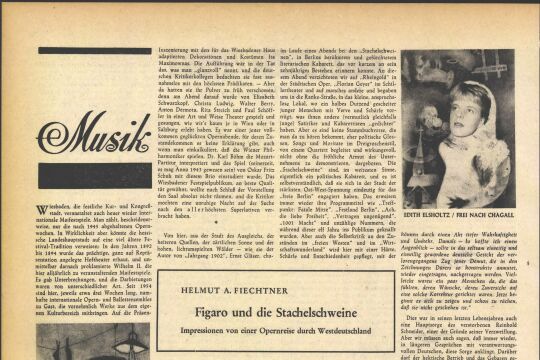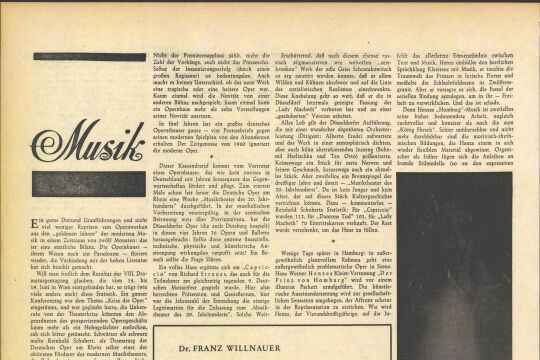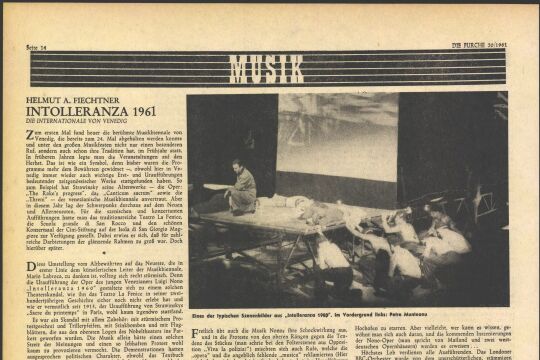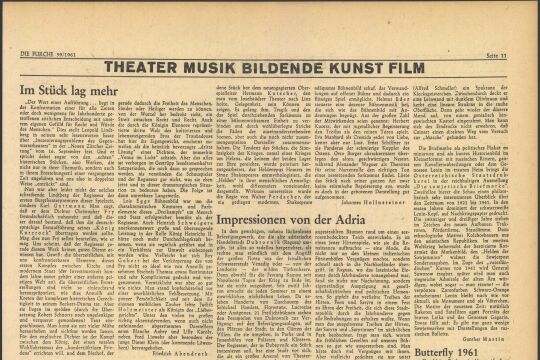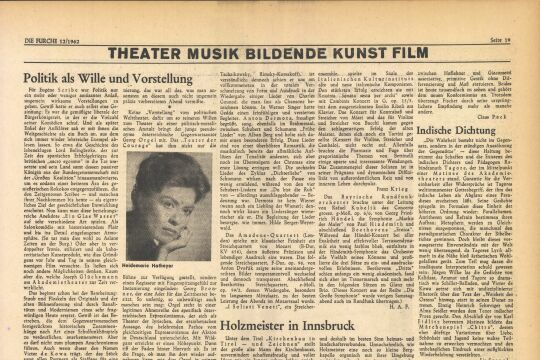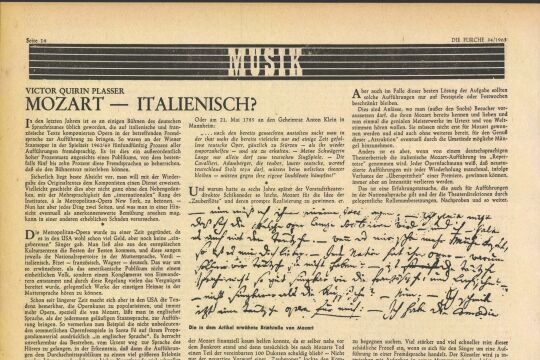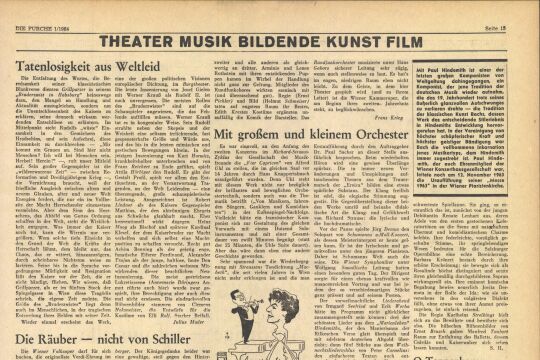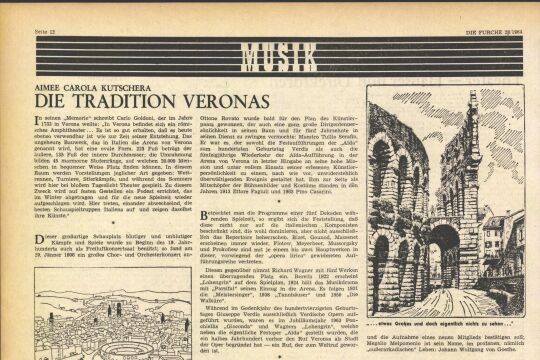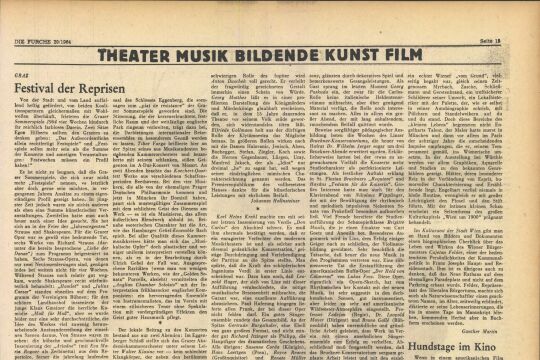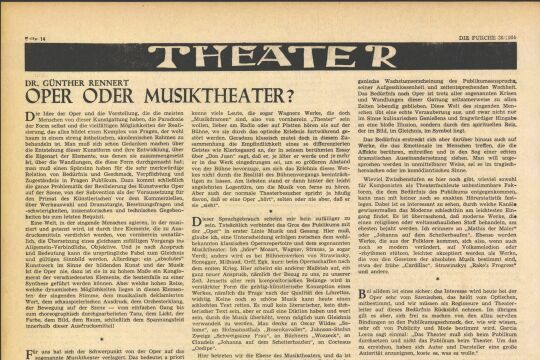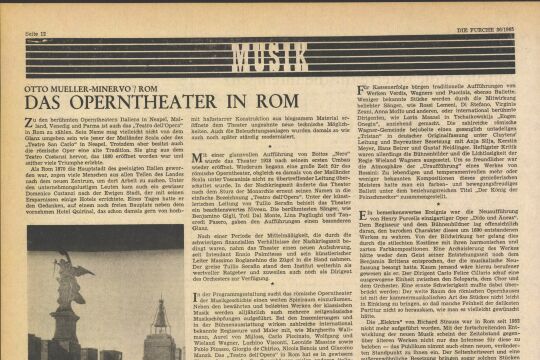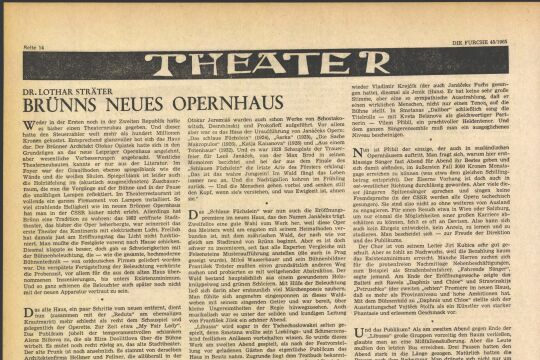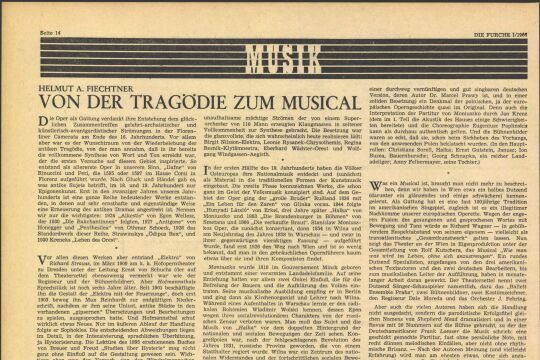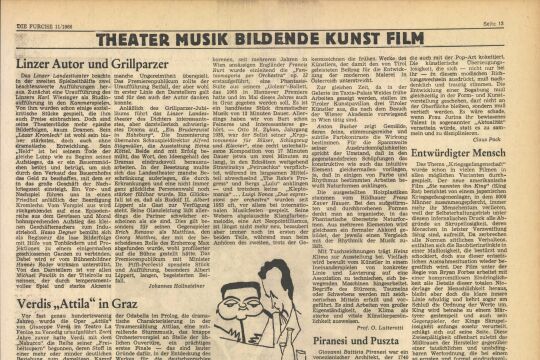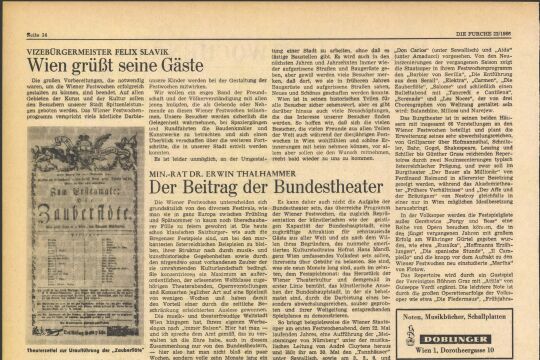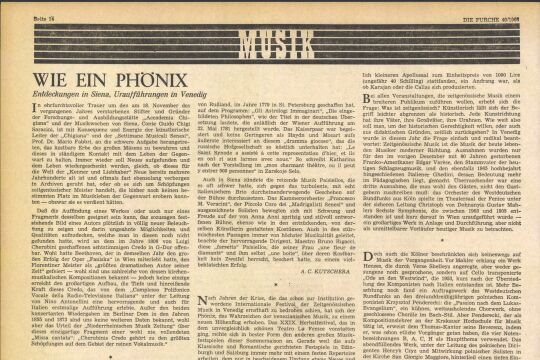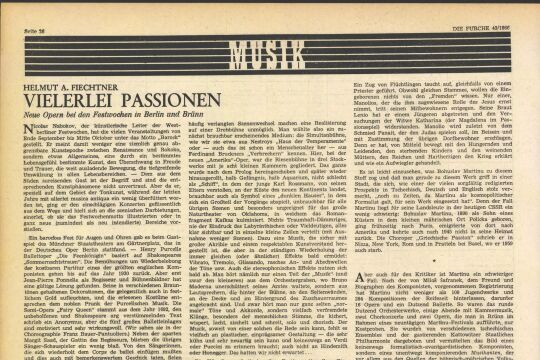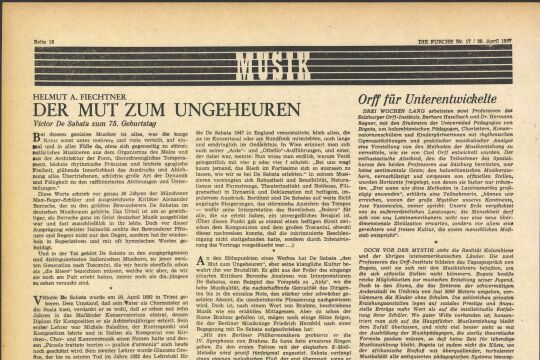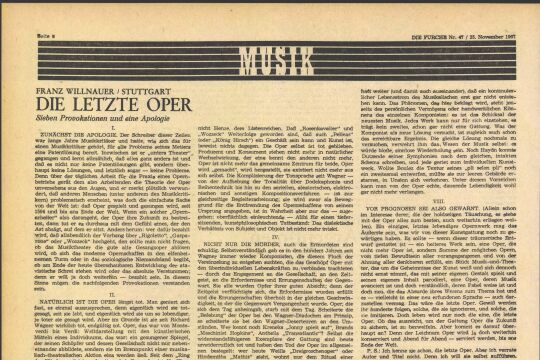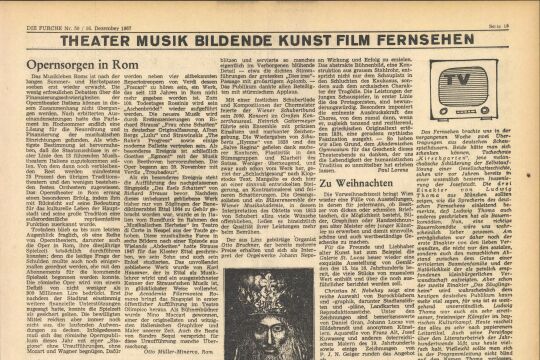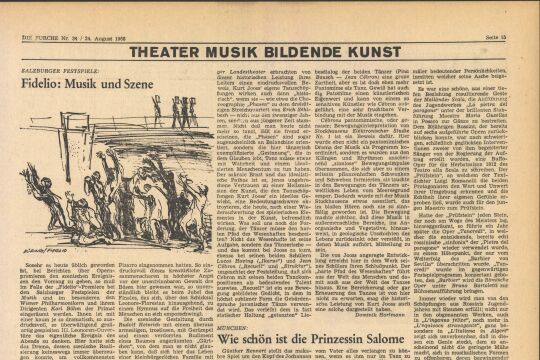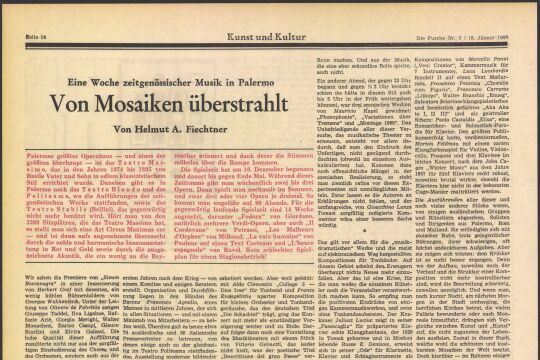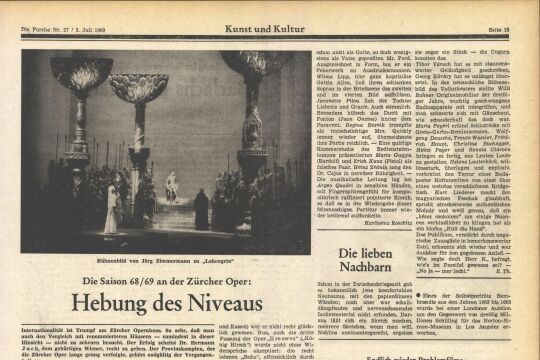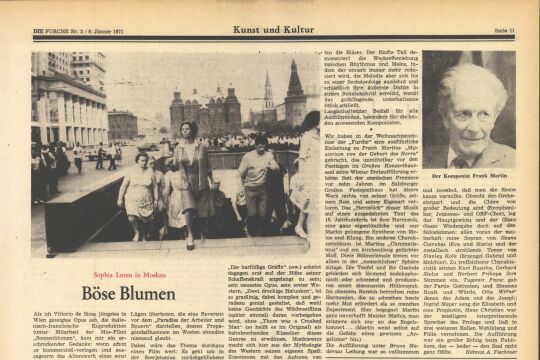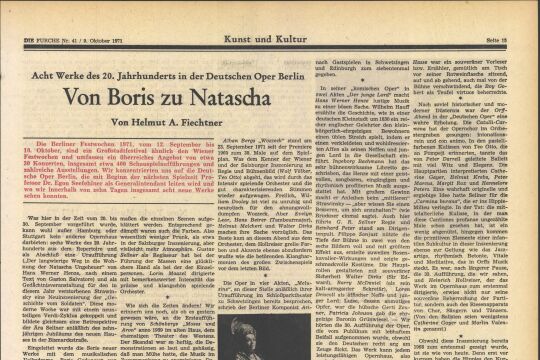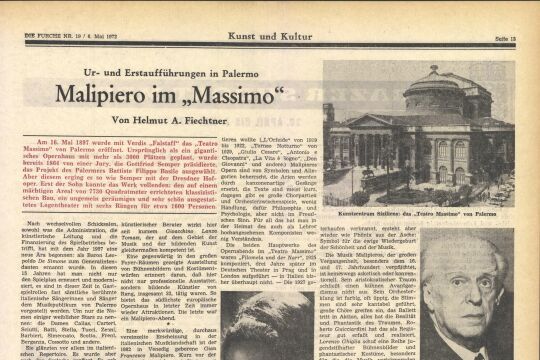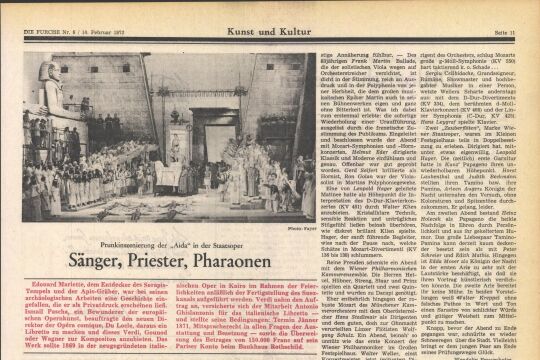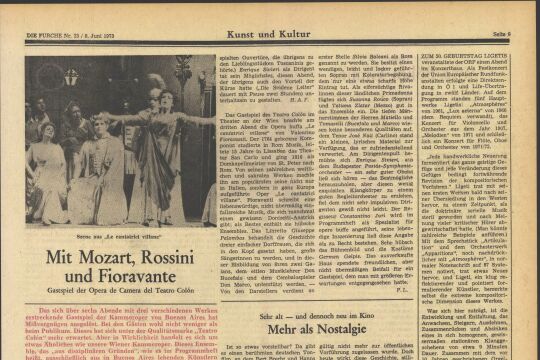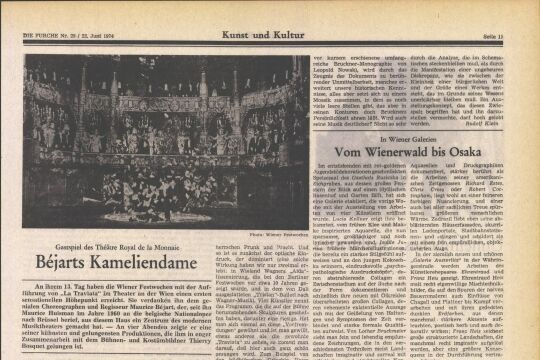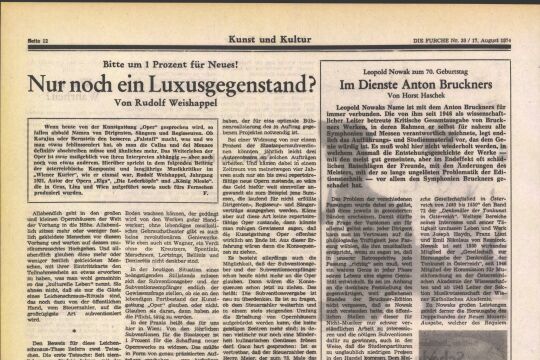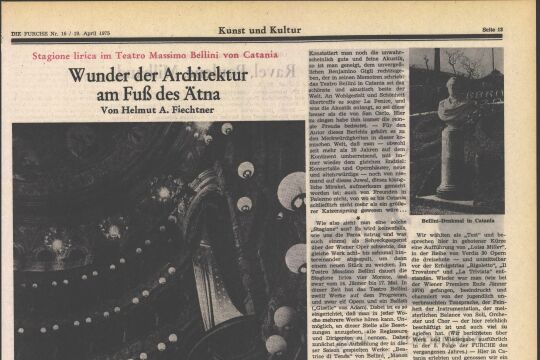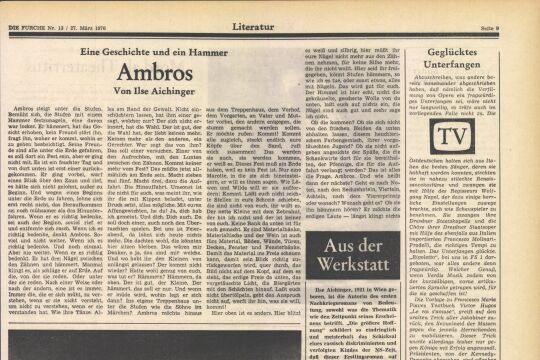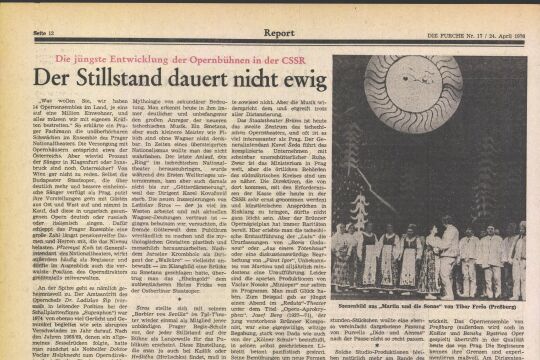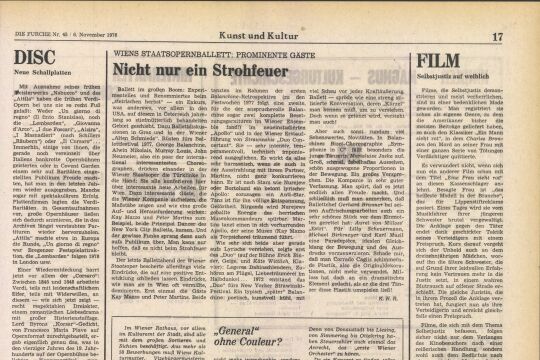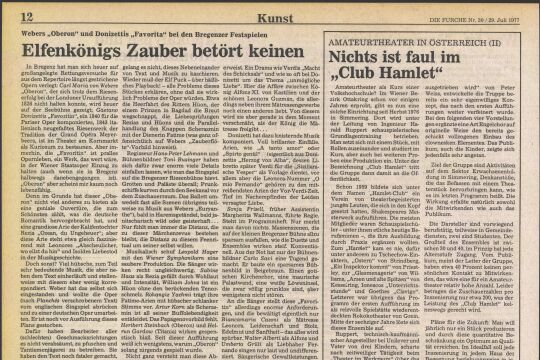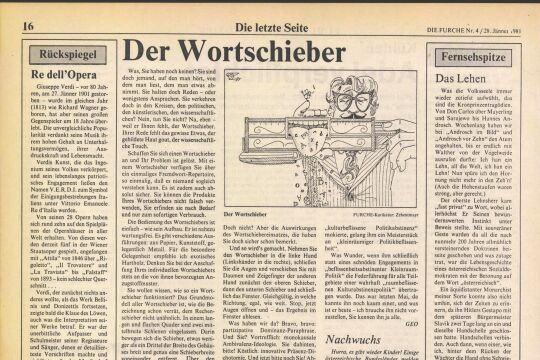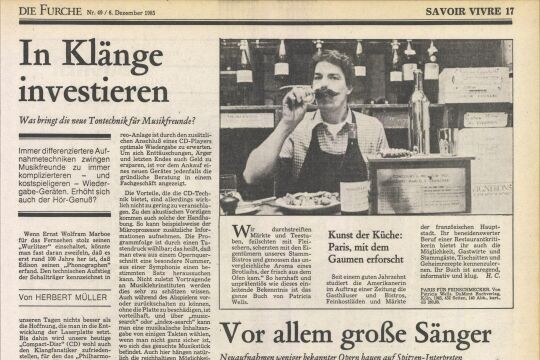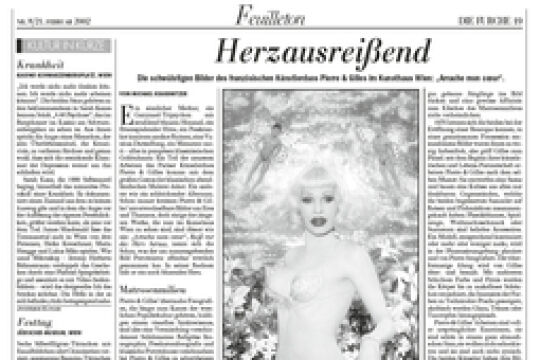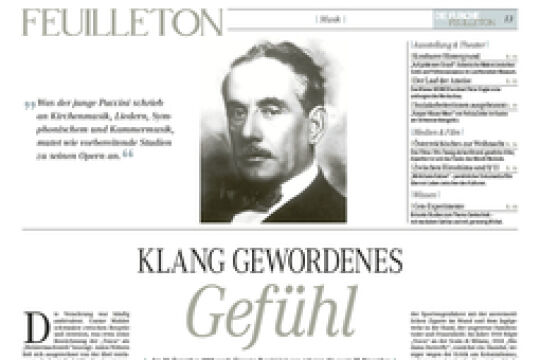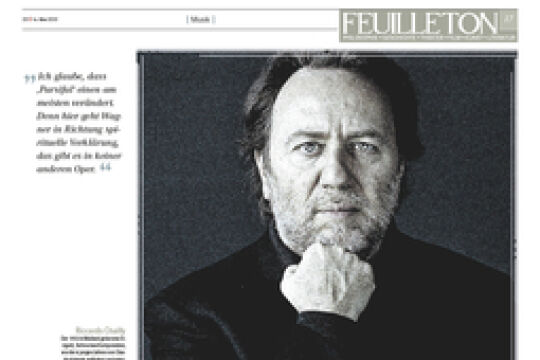Der Shakespeare der Opernbühne
Zum 100. Todestag des Komponisten Giuseppe Verdi.
Zum 100. Todestag des Komponisten Giuseppe Verdi.
Seine Werke sind aus dem internationalen Opernrepertoire nicht wegzudenken, noch ein Jahrhundert nach seinem Tod, der sich am 27. Jänner jährt, wird rund die Hälfte seiner 26 Opern in aller Welt gespielt: Giuseppe Verdi ist der erfolgreichste und populärste Opernkomponist der Geschichte, von Publikum, Kritik und Musikwissenschaft gleichermaßen geschätzt - ein seltener Fall. In seinem Heimatland war und ist Verdi ein Nationalheld. Der Gefangenenchor aus seinem "Nabucco" galt im bis 1859 zersplitterten Italien als heimliche Nationalhymne. Bis in die fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts konnte man in unserem südlichen Nachbarland Bauarbeiter bei der Arbeit Verdi-Arien singen oder pfeifen hören.
Als "Shakespeare der Opernbühne" bezeichnete ihn Hugo von Hofmannsthal und Igor Strawinsky meinte, in "La donna e mobile" - der berühmten Cabaletta aus "Rigoletto" - ,finde sich "mehr musikalische Substanz und mehr wahre Erfindung als in dem rhetorischen Redeschwall der ,Tetralogie'". Gemeint ist Wagners "Ring des Nibelungen". "Während Wagner mit seiner Opernsymphonik in eine Sackgasse geriet und an Nachfolgern nur Wagner-Epigonen produzierte, ist der Nachklang Verdis in Werken von Puccini, Richard Strauss, Britten, Poulenc und Strawinsky nachweisbar und wird von diesen nicht bestritten", schreibt der Wiener Musikkenner Christian Springer in der anlässlich des Todestages herausgekommenen, exzellenten Biografie "Verdi und die Interpreten seiner Zeit", die anhand zahlreicher Originalzitate vor allem das Bild des Künstlers Verdi plastisch werden lässt.
Neue Wege Giuseppe Verdi wurde am 9. oder 10. Oktober 1813 in dem kleinen Ort Le Roncole bei Parma als Sohn eines Gastwirtes geboren. Dass ihn das Mailänder Konservatorium nicht akzeptiert, wird er nie verzeihen, kann aber nicht verhindern, dass sich die Institution kurz vor seinem Tod nach ihm benennt. Nach einer privaten Musikausbildung beginnt Verdis Karriere gleich dort, wohin es andere ihr Leben lang nicht schaffen: an der Mailänder Scala mit der Oper "Oberto" (1839). Als seine beiden Kinder und seine erste Frau binnen zwei Jahren sterben und sein Zweitling "Un giorno di regno" (1840) zum Fiasko gerät, will der am Boden zerstörte Komponist seine Laufbahn beenden.
Doch er kann die künstlerische und existentielle Krise überwinden - mit "Nabucco" (1842) wird Verdi über Nacht zum gefeierten Komponisten. Der Verdi-Mythos besagt, das Libretto zu "Nabucco" sei ihm im Zustand tiefster Depression in die Hand gedrückt worden, er habe es zu Hause in eine Ecke geworfen, wo es sich wie durch eine Schicksalsfügung an der Stelle geöffnet habe, wo die Gefangenen "Va pensiero, sull'ali dorate" singen. In Wahrheit hatte es einige Monate in besagter Ecke gelegen, eines Tages setzt er sich damit widerwillig ans Klavier - und ist plötzlich wieder in seinem Element.
Die Ästhetik der italienischen Oper befindet sich im Umbruch, ein Generationenwechsel vollzieht sich: Vicenzo Bellini ist tot, Gioacchino Rossini hat 1829 seine letzte Oper geschrieben und das Schaffen des in geistige Umnachtung schlitternden Gaetano Donizetti neigt sich dem Ende zu. Die Absage an den verzierten Gesang des Belcanto, geballter Ausdruck und lodernde Melodien: das ist der neue Weg, den Verdi beschreitet. "Nicht Verdis erste Oper, aber die erste Verdi-Oper", nennt Springer "Nabucco".
Der enorme Erfolg der Oper hat jedoch andere Gründe: Ohne dass Verdi dies gewollt hätte, projiziert das Publikum die Thematik der babylonischen Gefangenschaft auf die politische Gegenwart. Italien ist in mehrere Staaten zersplittert, der Norden ist von Frankreich und Österreich besetzt, die Italiener sehnen das Risorgimento, das nationale Wiedererstehen herbei.
Mit "Nabucco" beginnt jene Zeit, die Verdi später einmal als seine "Galeerenjahre" bezeichnet": Ein Opernauftrag folgt auf den anderen. Auch die Chorschlager weiterer Opern werden - gegen Verdis Intention - als politische Aussagen verstanden: "I Lombardi" (1843), "Ernani (1844), bei der Uraufführung von "Attila" (1846) im unter österreichischer Herrschaft stehenden Venedig brechen Tumulte im Theater aus. Allein "La Battaglia di Legnano" (1849) ist eine echte politische Oper, Verdis bewusster Beitrag zur Einigung Italiens. Leo Karl Gerhartz spricht in der aktuellen Ausgabe der Österreichischen Musikzeitschrift den großen Chören des jungen - zeitlebens antiklerikalen - Verdi sogar einen "latent religiösen Charakter" und "Nähe zur katholischen Liturgie" zu.
Der Maestro, der immer stärkeren Einfluss auf die Gestaltung des Textes nimmt, führt auch neue Sitten am Theater ein: Er gibt authentische Klavierauszüge heraus und besteht auf Generalproben im Kostüm. Für "Macbeth" (1847), ein Werk das ihm besonders am Herzen liegt, setzt er über 100 Proben durch. Ab diesem Jahr lebt er auch mit der gefeierten Sängerin Giuseppina Streppone in wilder Ehe zusammen - sehr zum Missfallen konservativer Kreise, erst 1859 wird die Verbindung offiziell und Giuseppina seine zweite Frau. "Als weltgewandte, gebildete Frau, die brillant konversiert, (...) taktvoll und sensibel auf Gesprächs- und Geschäftspartner einzugehen versteht, das genaue Gegenteil und deshalb die ideale Ergänzung ihres berühmten Mannes, dem reservierten, bisweilen mürrisch-abweisenden, einzelgängerischen, Konfrontationen nie abgeneigten Komponisten", schreibt Christian Springer. "Nicht jedermann kann eine Aida schreiben, aber irgendwer muss die Koffer ein- und auspacken", meint Giuseppina einmal bescheiden.
Auf "Luisa Miller" (1849) folgen Opern, in denen die Gestaltung eines persönlichen Schicksals zu intimen meisterhaft entworfenen Charakterbildern gerät. Zuerst "Stiffelio" (1850), dann die "trilogia populare" - "Rigoletto" (1851), "Il trovatore" und "La Traviata" (beide 1853) - die den Höhepunkt von Verdis Schaffen darstellt. Das, wie man heute sagen würde, Hit-Potential von "La donna e mobile" schätzt der Komponist so hoch ein, dass er dem Sänger verbietet, es vor der "Rigoletto"-Uraufführung außerhalb des Theaters zu singen oder nur zu pfeifen. Am Tag danach singt und pfeift es ganz Venedig, bald ganz Italien. Auch der "Trovatore" tritt sofort seinen Siegeszug durch die Opernhäuser der Welt an, nur die "Traviata" wird anfangs kühl aufgenommen. Heute ist sie eine der beliebtesten Opern überhaupt.
In der "trilogia populare" hat der 40-jährige Verdi den Gipfel dessen erreicht, was mit den bis dahin verwendeten kompositorischen und stilistischen Mitteln zu erreichen ist. Niemand hätte ihn daran hindern können, schreibt er später in einem Brief, "nach der ,Traviata' eine Oper pro Jahr zu schreiben und ein Vermögen anzuhäufen, drei mal so groß wie das, das ich habe". Aber Verdi entscheidet sich, beginnend mit "Les Vepres siciliennes" (1855) neue Wege zu gehen - nicht ohne dafür Kritik einstecken zu müssen: "Verdi ist kein Italiener mehr. Er macht Wagner", rümpft etwa Georges Bizet die Nase.
Mit "Un ballo in maschera" (1859) sind Verdis Galeerenjahre zu Ende. Er zieht sich auf sein Landgut zurück und verkündet, mit Musik nichts mehr zu tun haben zu wollen. Im selben Jahr wird Italien fast zur Gänze geeint und Verdi lässt sich überreden, Abgeordneter im ersten italienischen Parlament zu werden. Doch so ganz kann er das Komponieren nicht lassen: Für St. Petersburg schreibt er "La forza del destino" (1862), für Paris "Don Carlos" (1967), für Kairo "Aida". Dass er letztere , wie oft kolportiert, ursprünglich für die Eröffnung des Suezkanals zwei Jahre zuvor komponierte, verweist Christian Springer in seiner Verdi-Biografie ins Reich der Legenden.
Nach "Aida" hält man Verdis Karriere für beendet, auch er selbst ist dieser Meinung und beschließt, sein Musikerleben mit dem "Requiem" zu krönen, einem Meisterwerk, das zum ersten Todestag des verehrten Risorgimento-Schriftstellers Alessandro Manzoni (1785 bis 1873) uraufgeführt wird.
Doch es kommt anders. In kongenialer Zusammenarbeit mit dem Librettisten und Komponisten Arrigo Boito entstehen die beiden Alterswerke "Otello" (1887) und "Falstaff" (1893), seiner ersten komischen Oper seit dem missglückten "Giorno di regno". In beiden Werken lässt er das obligate Nummernschema der klassischen italienischen Oper endgültig hinter sich. Die Uraufführung findet an der Mailänder Scala statt, dem berühmtesten Opernhaus Italiens, das vom berühmtesten Komponisten des Landes mehr als ein Vierteljahrhundert lang boykottiert worden war.
Soziale Verantwortung Als Verdi 1901 in einem Mailänder Hotel im Sterben liegt, wird vor dem Gebäude Stroh ausgelegt, um das Geräusch der Kutschen zu dämpfen, Straßenbahnen umgeleitet, die Königsfamilie stündlich per Telegramm über Verdis Zustand informiert. Als er am 27. Jänner stirbt, versammelt sich binnen weniger Minuten eine schweigende Menge vor dem Hotel.
Dass Verdi über einen ausgeprägten Sinn für soziale Verantwortung verfügte, hatte er schon zu Lebzeiten unter Beweis gestellt: Er stiftete Stipendien, unterstützte in Not geratene Künstler, stiftete ein Krankenhaus und ein Altersheim für Künstler. Dieser Casa di riposo, die noch heute existiert, vermachte er die Rechte an seinen Werken, um deren Existenz auch nach seinem Tod abzusichern. In der Kapelle dieses Altersheimes liegt Verdi auch begraben, an der Seite seiner Frau, die vier Jahre vor ihm gestorben war. Wie seine zweite Gattin war auch Verdi ein zutiefst bescheidener Mensch gewesen. Stets lehnte er es ab - oft vergeblich -, dass Institutionen nach ihm benannt wurden, selbst die von ihm gestifteten.
Auch eine realistische Selbsteinschätzung hat Verdi stets beibehalten. Bei den Proben zur Uraufführung von "Aroldo" (1857) ließ der Dirigent eine Orchesterpassage immer und immer wieder proben, ohne zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Nach der Probe versprach er dem anwesenden Verdi, die Musiker so lange proben zu lassen, bis die Passage seinen Vorstellungen entspreche. Aber Verdi lächelte nur und erklärte ihm, dass nicht das Orchester, sondern die Instrumentation mangelhaft sei; er würde sie bis zum nächsten Tag ändern.
Dass Verdi auch Humor besaß, zeigt folgende Episode: Ein gewisser Bertani teilt Verdi 1872 brieflich mit, dass er ,Aida' besucht und festgestellt habe, dass es sich um ein Werk handle, "worin nichts vorkommt, was zum Applaudieren verleitet". Die Oper werde "noch an zwei, drei Bühnen gespielt werden und dann in den Archiven verstauben", daher fordere er von Verdi Eintrittsgeld, Fahrtkosten und das Geld für eine Mahlzeit im Bahnhofsrestaurant zurück. Verdi lässt dem komischen Vogel tatsächlich die geforderte Summe zukommen, abzüglich des Essensgeldes ("Er hätte gut zu Hause abendessen können!!!"), der Verdi-Verächter muss allerdings eine Erklärung unterschreiben, in der er verspricht, nie wieder eine Verdi-Oper zu besuchen.
Ob Signore Bertani seine Unterschrift später einmal bereut hat, ist nicht bekannt.
Verdi und die Interpreten seiner Zeit Von Christian Springer, Verlag Holzhausen, Wien 2000, 490 Seiten, geb. öS 480.-/s 34,88\r