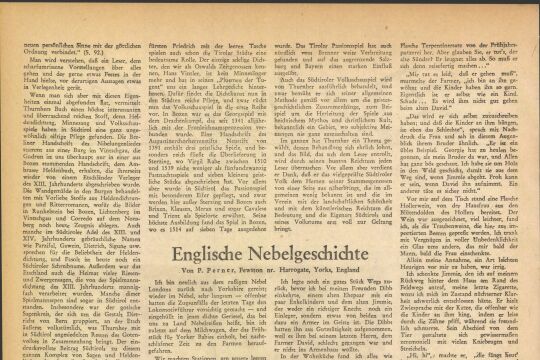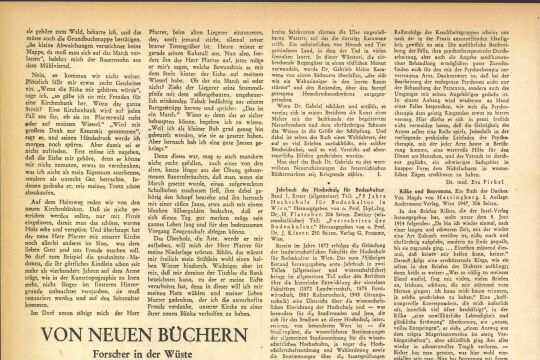Gewöhnlich meint man ja, man kenne die Dinge und Wesen, die einen so umgeben, ganz gut. Aber das ist ein Irrtum. Es kommt sogar vor, das man jene Objekte besonders wenig kennt, die man besonders häufig sieht. Man nehme nur Verwandte und Tanten, die an Jubelfesten und runden Geburtstagen bei uns hereinschneien (oder wir bei ihnen). Sie scheinen doch immer gleich zu bleiben. Aber sind sie uns bekannt, nur weil wir sie beiläufig fragen, wie es ihnen gehe, und sie sagen dann "gut"? Oder haben wir damit nur eine Beziehungslosigkeit verlängert, die wir nach Außen hin für eine Beziehung halten? Vor einem ähnlichen Problem stehen wir, wenn wir uns mit dem Tier und der Pflanze des Jahres 2019 bekannt machen. Denn man meint, es gäbe beinahe kaum Gewöhnlicheres als das Reh und kaum etwas Häufigeres als das Johanniskraut. Beide stehen sie zumindest die längste Zeit des Jahres um uns herum. Dabei ist das meiste, was wir über sie wissen, falsch. Gerade das Reh muss ein Lied davon singen, besser gesagt fiepen (Rehe fiepen). Denn es ist seit Generationen das Opfer einer argen Mär. Dass es nämlich ein weiblicher Hirsch sei. Man raubt dem Reh damit sowohl die Gattung als auch die Art -und dem Rehbock gleich seine Männlichkeit. Denn sicher ist, dass Hirsch und Reh höchstens den Paarhuf gemeinsam haben.
SCHRECKEN IN DER KINDERSTUBE
Schuld an dieser Verdrehung ist der berühmteste Rehbock der Welt: Bambi, das im Disney-Zeichentrickfilm vom so genannten Rehkitz zum kapitalen 16-Ender mutiert. Aber das ist an Bambi noch nicht das Schlimmste. Wir verdanken ihm neben dem zoologischen Miss-Wissen auch unzählige heiße Tränen, da seine Mutter von bösen Jägern erschossen wird. Psychologen sprechen sogar von einem "Bambi-Schock", den der Film auslöste: Die Angst Tausender Kinder vor dem Verlust der Eltern nach dem Konsum des scheinbar herzigen Kinderfilmes. Alles in allem also tiefschwarze Pädagogik im waldgrünen Gewand. Dass Disney-Entertainment den Plot Jahrzehnte später in Afrika wiedererstehen ließ unter dem Titel "König der Löwen", machte die Sache nicht besser, wenn auch lukrativer. Es handelte sich um eine lupenreine Re(h)traumatisierung. Wie also dem Reh gerecht werden, bei soviel Trug? Die Beobachtung der reinen Natur könnte helfen. Unser redaktioneller Prokurator über Wissenschaft und Achtsamkeit, Professor Tauss, begegnet dem Reh häufig in natura auf seinen Waldläufen in den Föhrenbergen im Süden von Wien. Sie blicken einander an, so erzählt er, und beide Wesen, Tauss und Tier, verharren in ihrem Tun und Treiben. In diesem völlig aus der Zeit gefallenen Stillleben passiert etwas äußerst Wichtiges: Nämlich nichts. Absolute und beinahe ontologische Stille. Diese Situation ist das Kondensat von Gegenwart. Sie fließt nicht. Sie steht quasi Augʼ in Augʼ im Föhrenwald. Sie wird erst Vergangenheit, wenn Professor Tauss sich für die Zukunft (im Büro!) entscheidet und weiterläuft, und mit seiner Bewegung das Reh zum Verschwinden bringt.
Das ist die philosophische Seite des Rehs, dieses wunderbare Verharren. Sie ist übrigens keiner natürlichen Achtsamkeit geschuldet, sondern der schlechten Sehfähigkeit des Wildes. Denn so schön die Rehaugen sein mögen, so zweidimensional und verschwommen ist sein Bild von der Umwelt. Weshalb das Tier erst dann rennt und springt, wenn eine Gefahr (Hund, Wolf, Fuchs, Luchs) oder ein Professor tatsächlich schon mit Riesenschritten auf es zustürmt.
Das Reh deshalb zu verlachen, wäre allerdings ein Hohn. Denn wie vielen Zivilisationen ist es schon passiert, dass sie sehenden Auges einer Katastrophe, die sie kommen sahen, nicht auswichen, sondern erstarrten und stehen blieben, bis sie verschlungen wurden? In diesem Sinne müsste man im Großen den Brexit und im noch Größeren den Klimawandel als eine solche letal-starrende "Rehaktion" (Wortschöpfung von Desert/Kleinberger/Hill) bezeichnen. Natürlich besteht das Reh nicht aus katastrophal menschelnden Anlagen allein. Es ist etwa im Sozialverhalten uns weit überlegen. In der absoluten Notlage des Winters und der Kälte nämlich schließt es sich zu Trupps von bis zu 10 Tieren zusammen, die gemeinsam auf Nahrungssuche gehen. Wird die Versorgungslage besser, zerstreuen sie sich wieder.
HERDE STATT HORDE
Der Mensch scheint das Gegenteil zu tun, in der Krise in Panik auseinanderzulaufen und einander jeden Bissen streitig zu machen aus Hungerangst. Dagegen läuft er in Friedenszeiten bevorzugt als Horde gemeinsam jedem noch so waghalsigen Versprechen nach. Noch mehr Annehmlichkeiten, noch mehr Genuss. Das gilt für den Konsum ebenso wie für die Politik. Und noch ein scheinbares Paradoxon sollte uns beschäftigen, wenn es um die Rehlichkeit geht. Studien in Frankreich, Schweden und Deutschland haben herausgefunden, dass Rehe in Gebieten, in denen sie intensiver bejagt werden, durchschnittlich um 25 Prozent länger leben, sie beschränken aber ihre Reproduktion auf ein Minimum. Wenn der Mensch eine solche Strategie wählen würde, wäre die Welt mit einem Schlag das Problem der Überbevölkerung los, das sich daraus ergibt, dass er meint, in größter existenzieller Bedrängnis besonders viele Nachkommen zeugen zu müssen. Letzteres schlägt sich sofort in Nahrungsnotständen nieder, also im Gegenteil der Absicht. Und an diesem Punkt müsste man eigentlich die Behauptung umdrehen und feststellen, dass nicht das Reh paradox und unvernünftig handelt, sondern der Mensch.
Es handelt sich also nicht um ein Waldund schon gar nicht um ein Wiesenproblem. Zumindest weiß davon das Johanniskraut nichts. Denn es treibt seine gelben Blüten gerade dort besonders reich, wo der Boden karg und nährstoffarm ist. Das Wunderbare an dieser Pflanze ist, dass sein Gedeihverhalten sich Eins zu Eins auf die Psyche übertragen lässt. Dort, wo die Seele besonders karge Phasen durchlebt und in Angst oder Niedergeschlagenheit dahinsiecht, kann der Saft des Johanniskrauts neue Lebensfreude spenden. So sagt es zumindest Hildegard von Bingen. Wenn man diesen aufhellenden Effekt in die Gesellschaftspolitik übersetzen wollte, dann würden die Sozialpolitik (und auch die Asylpolitik) die Funktion eines "Johanniskrauts" erfüllen und Menschen aus der Misere zurück zur gesellschaftlichen Integration heben.
DEPRESSIONS-LOSE
Wobei hinzuzufügen ist, dass besonders in jüngster Zeit diese Leistungen so stark gekürzt wurden, dass sich der Verdacht mehrt, man wolle Depression hier mit Depressiva bekämpfen. Aber so negativ soll es hier nicht zu Ende gehen. Das letzte Wort hat das Johanniskraut. Es soll magisch in Liebesdingen wirken. Wenn nämlich ein Verliebter die gelben Blüten in der Johannisnacht (24. Juni) presst und es kommt rötlicher Saft heraus, dann "ist mein Schatz mir gut, denn es kommt rotes Blut". Der Spruch gelingt immer, denn selbst wenn in einer Beziehung noch vieles fehlt, dem Johanniskraut fehlt niemals sein wunderschöner, roter Farbstoff.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!