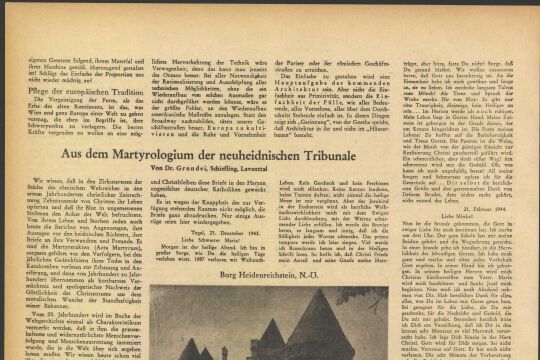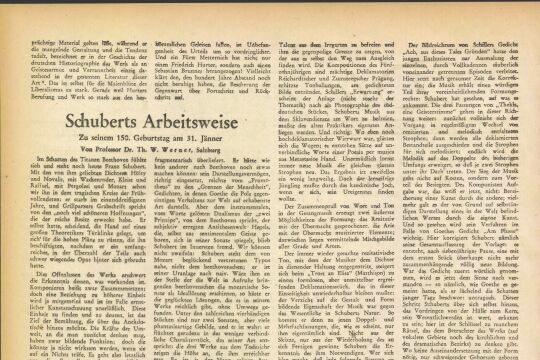Zur Staatsopernpremiere am Gründonnerstag: Wagners "Parsifal" im Spannungsfeld von Kunst und Religion.
Es beginnt schon mit der so ominösen wie monströsen Bezeichnung des Werks als Bühnenweihfestspiel. Der Ausdruck vermittelt Assoziationen an ein Mysterium, lässt esoterische Begleitgefühle entstehen. Gleichwohl hat Richard Wagner durchwegs ästhetisch und bühnenpraktisch gedacht, als er für sein opus ultimum besondere Aufführungsbedingungen schaffen, es vom schlampigen Routinebetrieb der Opernhäuser seiner Zeit fernhalten wollte.
Die Aura des Liturgisch-Erhabenen setzt sich fort mit der noch heute brisanten Beifallsfrage. Besonders am Ende des ersten Aufzugs gibt es in Bayreuth und anderswo hörbare Konflikte zwischen unvoreingenommenen Theaterbesuchern, die den Künstlern spontan den verdienten Applaus spenden wollen, und jenen eingefleischten Jüngern einer Quasireligion, die sich bei einer sakralen Handlung empfindlich gestört fühlen. Auch in diesem Punkt trägt ein vom Schöpfer des Werks selbst anders gemeintes Verdikt bis in die Gegenwart zu Verwirrung und gegensätzlichem Verhalten bei.
Österliche Passion
Und es gibt endlich Jünger des Meisters, Adepten auch seiner Philosophie und Ästhetik, die den "Parsifal" zu Ostern, vielleicht auch schon am Gründonnerstag, rituell begehen und mitfeiern, als gelte das Ereignis der Leidensgeschichte Christi, als wohne der Besucher einer kirchlichen Feier bei. Der im Deutschen notorische Doppelsinn von Passion drängt sich da unwillkürlich auf.
Nun fehlt es ja wahrhaft nicht an Merkmalen, Textstellen im Libretto und Äußerungen des Dichterkomponisten, die eine Deutung und subjektive Würdigung dieses Musikdramas als klerikale Zeremonie wenn nicht rechtfertigen, so doch verständlich machen.
Die Versuchung beginnt schon mit jenem viel zitierten Brief Wagners an König Ludwig II. vom 14. April 1865: "Ein warmer, sonniger Charfreitag gab mir durch seine heilige Stimmung einst den Parzival ein: er lebt seitdem in mir fort und gedeiht, wie ein Kind im Mutterschoß. [...] Ich hatte ein einzelnes Häuschen mit freundlichem Garten, in wundervoller Lage, mit herrlicher Aussicht auf den Züricher See und die Alpen, beziehen können. Ich saß - es war der erste schöne Frühlingstag! - auf der Zinne meines Asyls, die Glocken läuteten, die Vögel sangen, die ersten Blumen blickten zu mir auf, da war, nach tiefer Entrückung, der Parzival empfangen!" Eine Ursprungslegende, fast zu schön und stimmungsvoll, um wahr zu sein. Und in der Tat, die biografische Recherche hat ergeben, dass Wagner im Jahre 1857 erst etwa zwei Wochen nach dem Karfreitag die Dependance des Wesendonck'schen Anwesens bei Zürich bezog: Wie nicht selten im Rückblick großer Künstler liegt eine Mystifikation vor, eine fingierte Situation wird zum authentischen Erlebnis stilisiert.
"Nehmet hin mein Blut"
Richtig ist freilich, dass sich der Komponist bereits 1845, also noch vor der Komposition des "Lohengrin", mit Wolframs "Parzival"-Epos sowie in der Folge mit den biblischen Wurzeln der Geschichte vom heiligen Gral beschäftigt hat. Und wie so oft in seinem Schaffen hat er sich das Gelesene rasch zu Eigen gemacht, individuell anverwandelt und kreativ umgestaltet. Ein Brief an Mathilde Wesendonck (29./30. Mai 1859) gibt über dieses Verfahren beredtes Zeugnis: "Der Gral ist nun, nach meiner Auffassung, die Trinkschale des Abendmahles, in welcher Joseph von Arimathia das Blut des Heilands am Kreuze auffing." Gurnemanz, der Gralsritter und Waffengenosse des früheren Königs Titurel, spinnt in seiner großen Erzählung im ersten Aufzug diese Interpretation Wagners sinngemäß fort. Denn Titurel "neigten sich, in heilig ernster Nacht, dereinst des Heilands selige Boten: daraus er trank beim letzten Liebesmahle, das Weihgefäß, die heilig edle Schale, darein am Kreuz sein göttlich Blut auch floß, dazu den Lanzenspeer, der dies vergoß, - der Zeugengüter höchstes Wundergut, das gaben sie in unsres Königs Hut."
An Stellen aus dem biblischen Geschehen und Anklängen an christliches Gedankengut ließe sich aus der Dichtung manches beibringen: Die Gralsritter schreiten "zum letzten Liebesmahle gerüstet Tag für Tag". Knabenstimmen verkünden aus der Höhe der Kuppel: "Der Glaube lebt, die Taube schwebt, des Heilands holder Bote. Der für euch fließt, des Weins genießt, und nehmt vom Lebensbrote!" Eine andere Botschaft von oben lautet fast wie im Messtext: "Nehmet hin mein Blut, nehmet hin meinen Leib, auf daß ihr mein gedenkt." Und eine weitere Passage könnte vollends der christlichen Liturgie entnommen sein: "Wein und Brot des letzten Mahles wandelt einst der Herr des Grales durch des Mitleids Liebesmacht in das Blut, das er vergoß, in den Leib, den dar er bracht."
Karfreitagszauber
Liest oder hört man die Worte, die Gurnemanz im dritten Aufzug zur Musik des sogenannten Karfreitagszaubers singt, so wird die Spannung zwischen Tradition und Neuschöpfung, zwischen überkommenem Dogma und künstlerischer Aussage deutlich - und Wagners angebliches Erweckungserlebnis durch die blühende Natur erscheint verständlich. Denn auf die erstaunte Frage Parsifals, wieso denn am "höchsten Schmerzenstag" die Landschaft nicht trauere und weine, anstatt aufzuleben, antwortet sein greiser Mentor: "Des Sünders Reuetränen sind es, die heut mit heil'gem Tau beträufet Flur und Au: der ließ sie da gedeihen. Nun freut sich alle Kreatur auf des Erlösers holder Spur, will ihr Gebet ihm weihen." Selbst der Mensch schont an diesem Tag die Blüten und Blumen, die es auf ihre Weise danken, "da die entsündigte Natur heut ihren Unschuldstag erwirbt".
Fluch und Erlösung
So wird Parsifal in dieser Szene gleichsam zum Nachfolger Christi, wenn er die Heidin Kundry in die Glaubensgemeinschaft aufnimmt: "Mein erstes Amt verricht ich so: die Taufe nimm, und glaub an den Erlöser."
Eben diese Kundry ist vielleicht die vielschichtigste Gestalt im Figurenrepertoire von Wagners Musikdramen und gerade, so paradox das klingen mag, in der Vielzahl von Vorbildern, die sie in sich vereinigt, seine originellste Erfindung. Sie ist ebenso dienende Gralsbotin wie sinnliche Verführerin in Klingsors Zaubergarten. In ihr sind Züge der biblischen Herodias und einer Walküre Gundryggia "aufgehoben". Im Text heißt sie "Namenlose, Urteufelin, Höllenrose", mehrere Frauenbilder aus Wolframs Epos sind in sie eingegangen, vor allem gemahnt sie an das Vorbild des Ahasver. Wie offenbart sie doch selbst in der Exaltation des zweiten Aufzugs: "Seit Ewigkeiten harre ich deiner, des Heilands - ach! - so spät ... den einst ich kühn geschmäht ... Ich sah - Ihn - Ihn - und ... lachte: da traf mich ... sein Blick! Nun such ich ihn von Welt zu Welt, ihm wieder zu begegnen. In höchster Not wähn ich sein Auge schon nah, - den Blick schon auf mir ruhn ... Da kehrt mir das verfluchte Lachen wieder." Wo aus der Verknüpfung wiederkehrender Schuld keine Lösung zu erhoffen ist, kann nur Erlösung helfen.
"Zum Raum wird hier die Zeit"
Es bezeugt einmal mehr die Polarität, die dialektischen Gegensätze in Wagners Kunstwollen, wenn neben die wortreiche, bisweilen redundante Erläuterung knappe, rätselhafte Wendungen treten. So antwortet Gurnemanz im ersten Aufzug auf des Toren Parsifal Frage "Wer ist der Gral?" änigmatisch: "Das sagt sich nicht; doch, bist du selbst zu ihm erkoren, bleibt dir die Kunde unverloren."
Und dem über den raschen Ortswechsel Erstaunten gibt er die dunkle Auskunft: "Du siehst, mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit."
"Erlösung dem Erlöser!"
Wohl kaum eine Aussage der musikdramatischen Literatur ist so häufig und widersprüchlich diskutiert worden wie das finale "Erlösung dem Erlöser!" aus dem "Parsifal"-Text. Die Probleme beginnen mit der Lesart des Rufzeichens: Bedeutet es die Affirmation eines erreichten Zustandes oder chiffriert es einen Auftrag an die Gemeinschaft? Bezieht es sich auf den Titelhelden, der die Gralsritter aus ihrer Erstarrung befreit und ihren König Amfortas von seiner Wunde geheilt hat? Ist dieser Satz am Ende gar eine Konsequenz von Wagners unsäglicher Schrift "Das Judentum in der Musik"? Unter den vielen Lösungen erscheint diejenige als die plausibelste, die vom Kontext bestätigt wird und mit dem für die Entstehungszeit reichlich bezeugten Gedankengut des Schöpfers korrespondiert. Der Erlöser ist und bleibt Christus, der biblische Stifter auch des Gralsbundes. Und wovon er durch Parsifal erlöst wird, bekennt dieser selbst in seinem ekstatischen Ausbruch (2. Aufzug): "Des Heilands Klage da vernehm ich, die Klage, ach, die Klage um das entweihte Heiligtum: Erlöse, rette mich aus schuldbefleckten Händen!' So rief die Gottesklage furchtbar laut mir in die Seele."
Kunstwerk oder religiöse Offenbarung, so lautete die Alternative, von der dieser Beitrag ausgegangen ist. Die Frage ließe sich simpel beantworten: Schon der übliche Aufführungsort und die szenische Darstellung sprechen klar für ein Bühnenwerk. Und der Text ergibt trotz zahlreicher sakraler Momente und heilsgeschichtlicher Vorbilder kein kirchliches Hochamt und keine Karwochenliturgie.
Kunst-Religion
Eine differenziertere Beschäftigung mit dem Problem führt aber eher zu einem Ausgleich, zu einem "sowohl als auch", sprachlich kodiert, zum Kompositum "Kunst-Religion". Gerade die jüngste Wagner-Forschung (Dieter Borchmeyer, Udo Bermbach) hat gezeigt, dass Wagner mit der Botschaft seines "Parsifal" die Dialektik von Individuum und Gesellschaft, die Krisen von Politik und Amtskirche mythisch-ästhetisch sublimieren wollte. Wie schreibt der Autor selbst in seinem Aufsatz "Religion und Kunst" (1880): "Man könnte sagen, daß da, wo die Religion künstlich wird, der Kunst es vorbehalten sei, den Kern der Religion zu retten, indem sie die mythischen Symbole ... ihrem sinnbildlichen Werte nach erfaßt, um durch ideale Darstellung derselben die in ihnen verborgene tiefere Wahrheit erkennen zu lassen."
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!