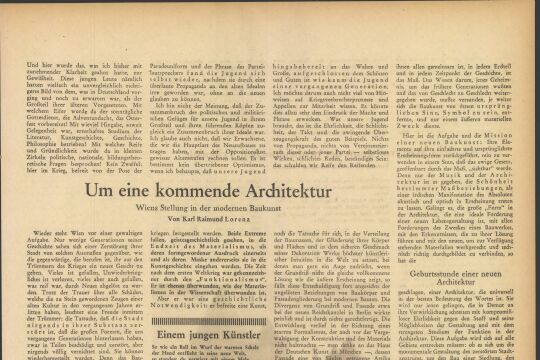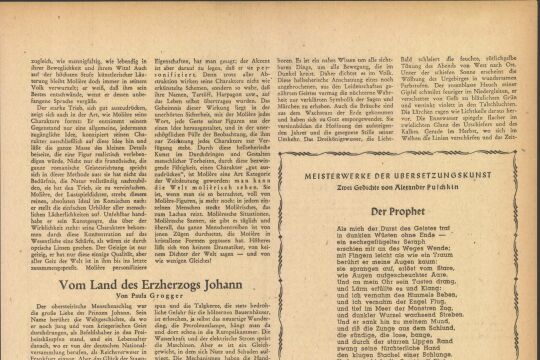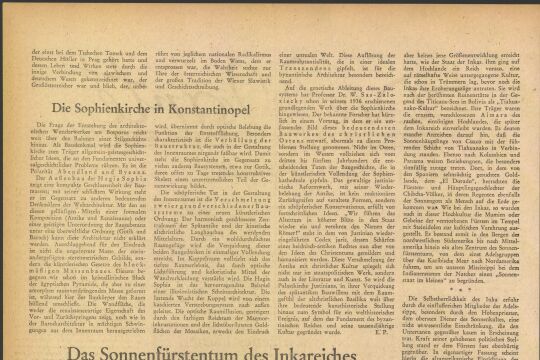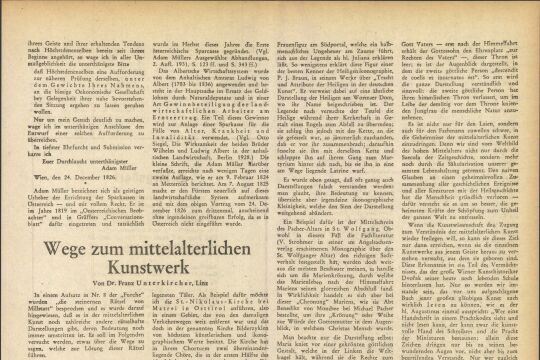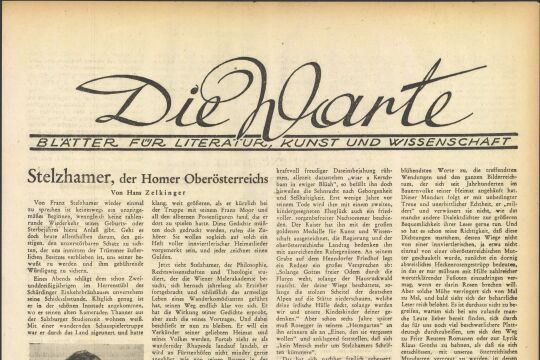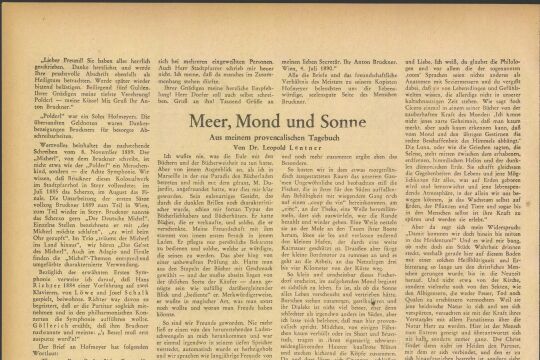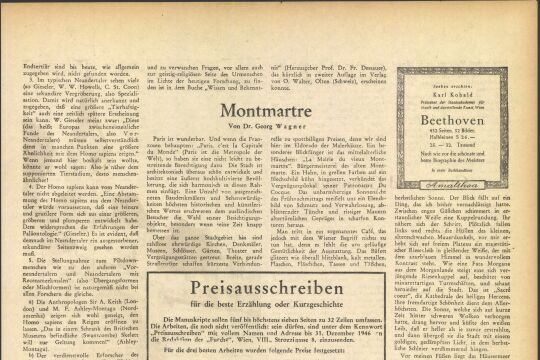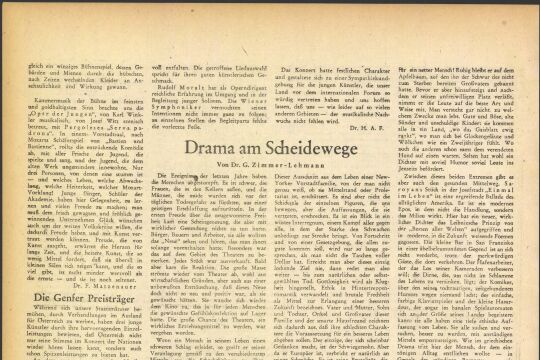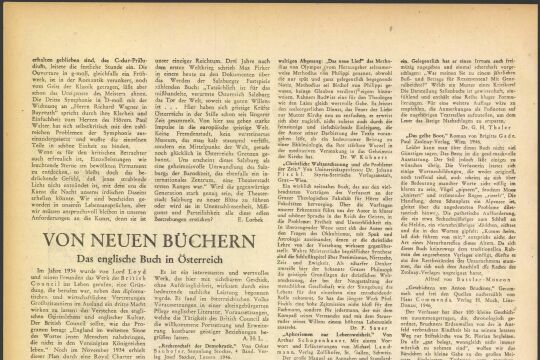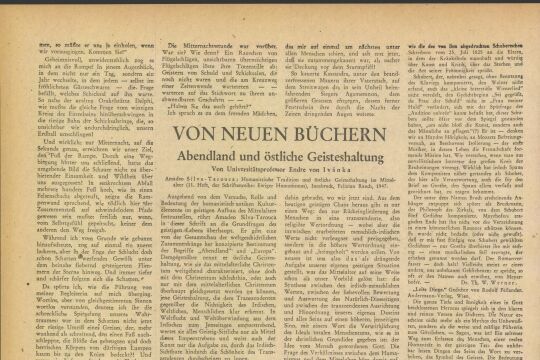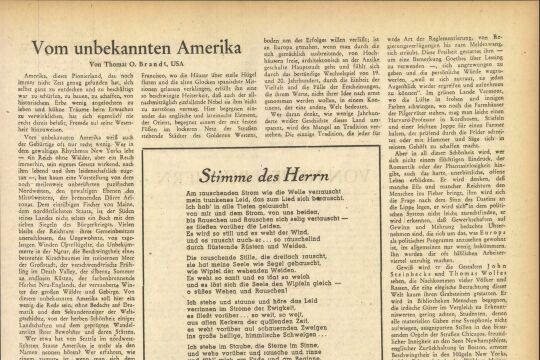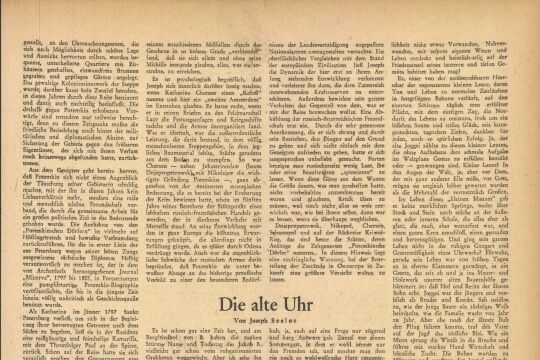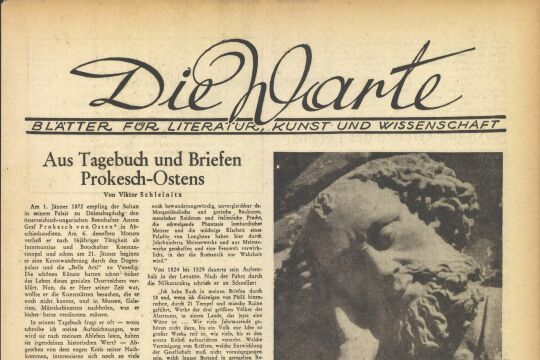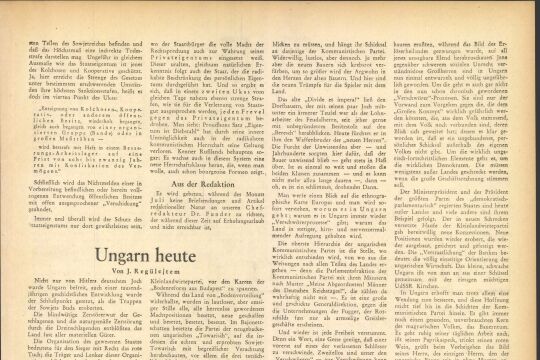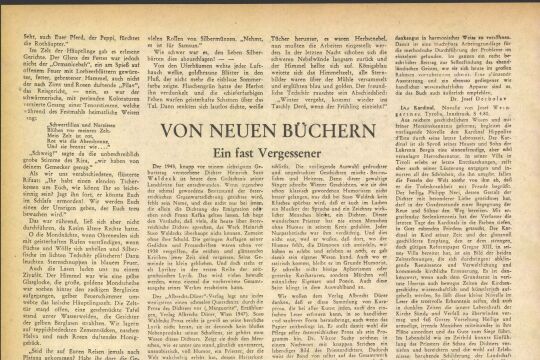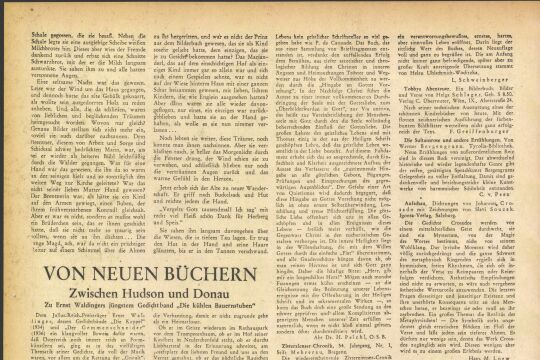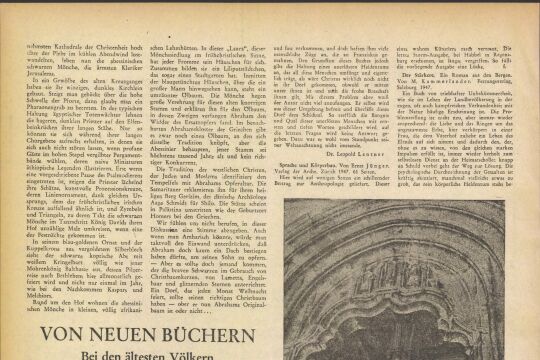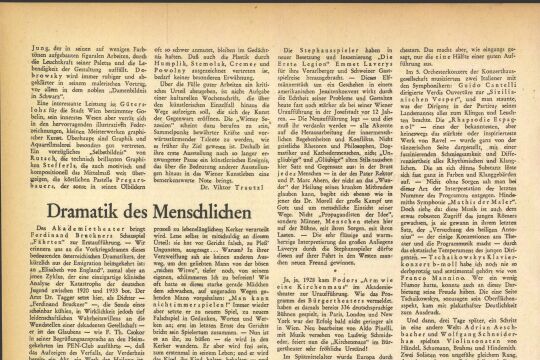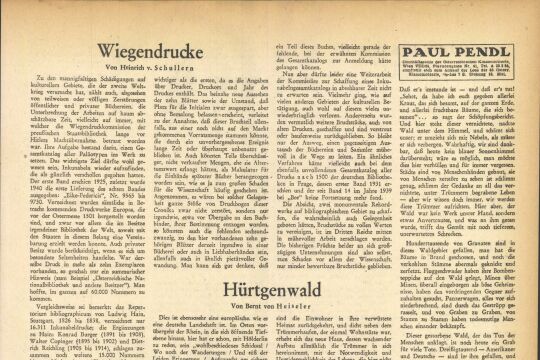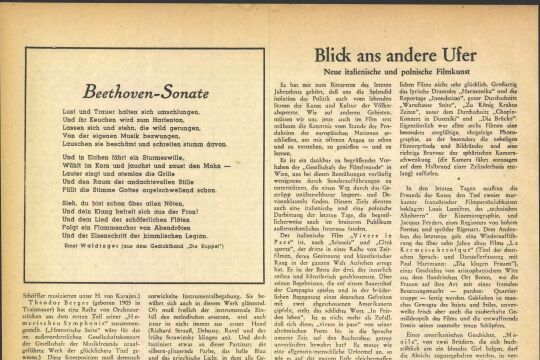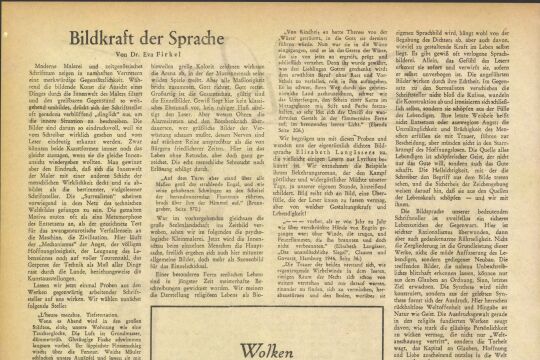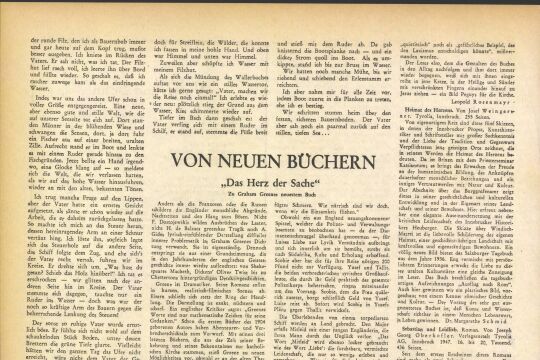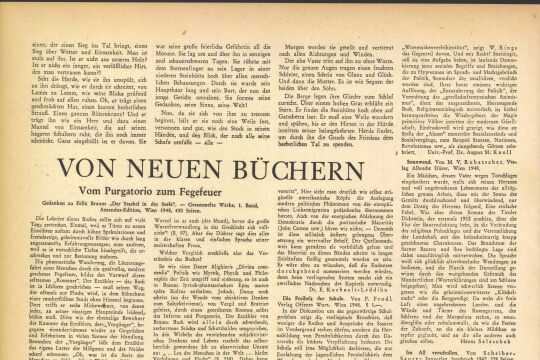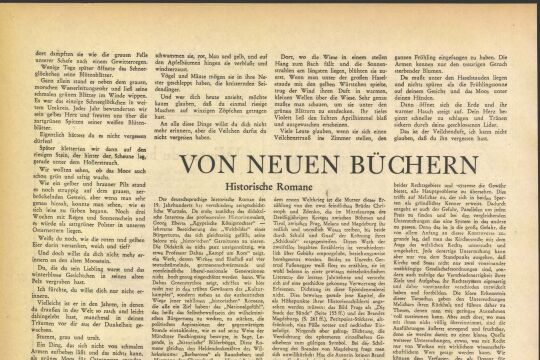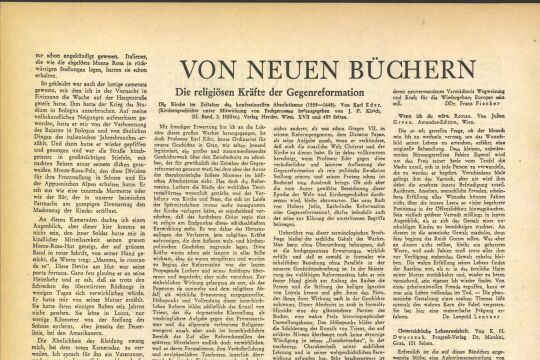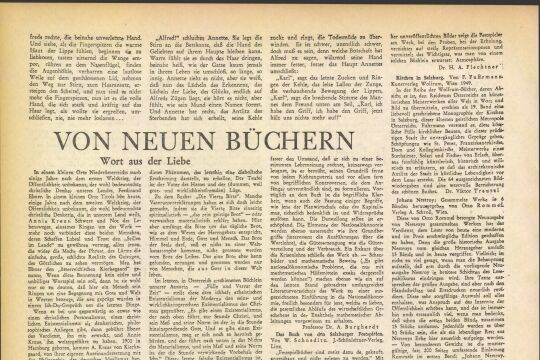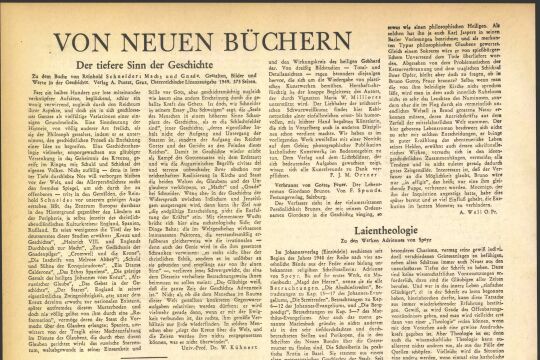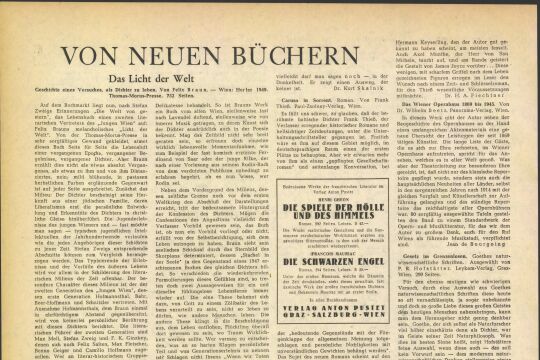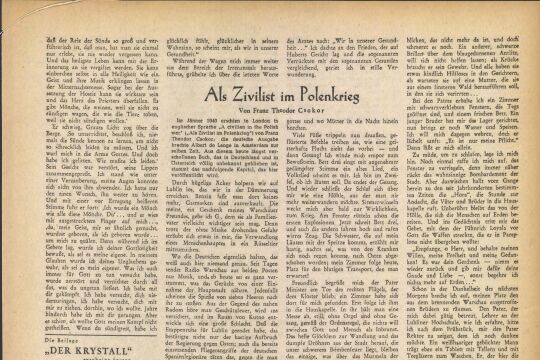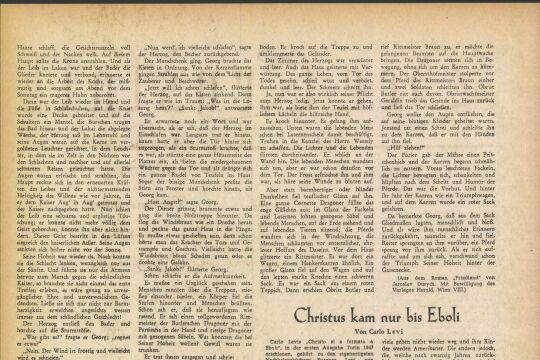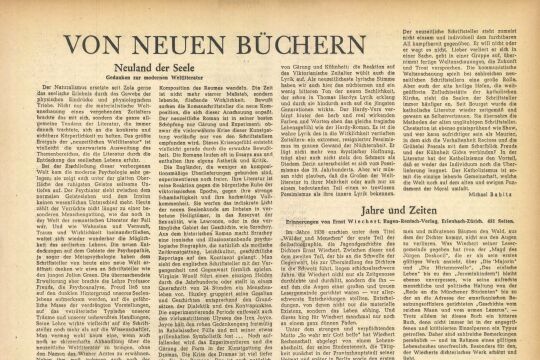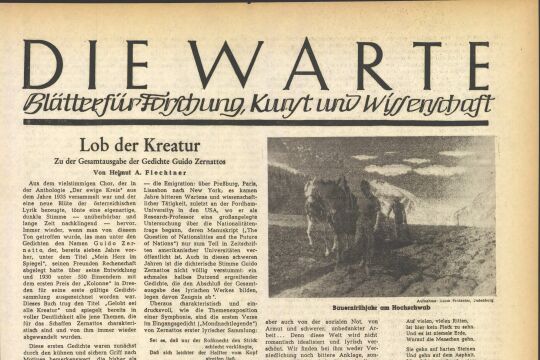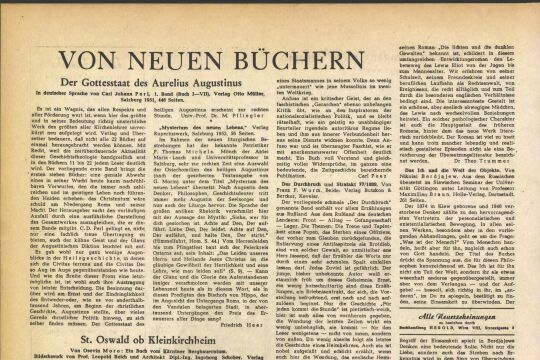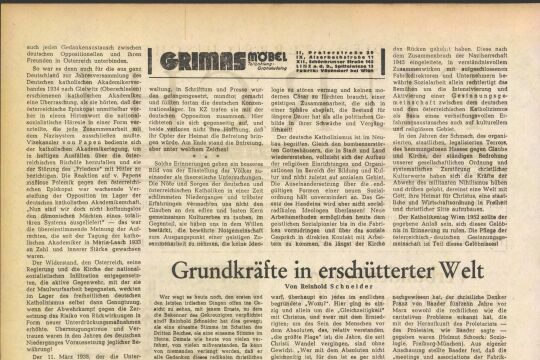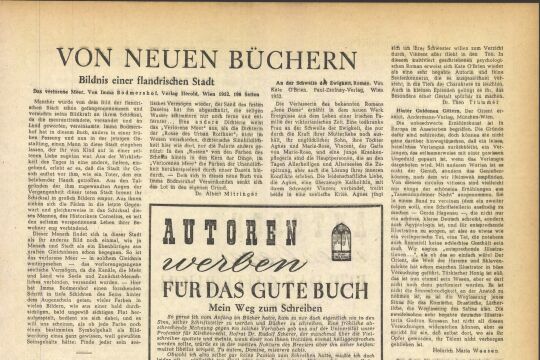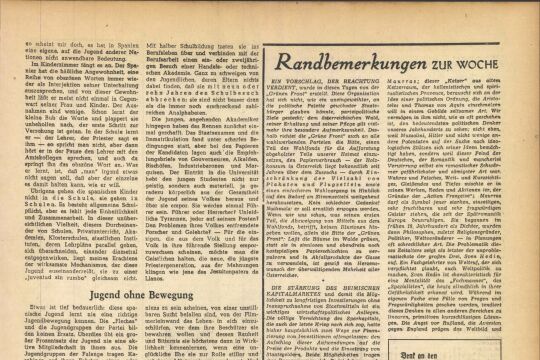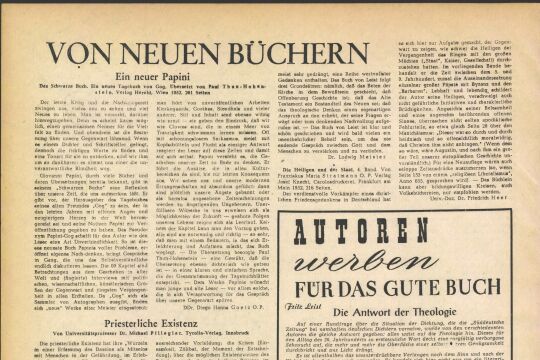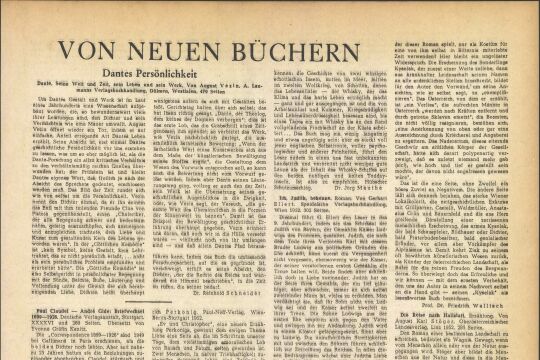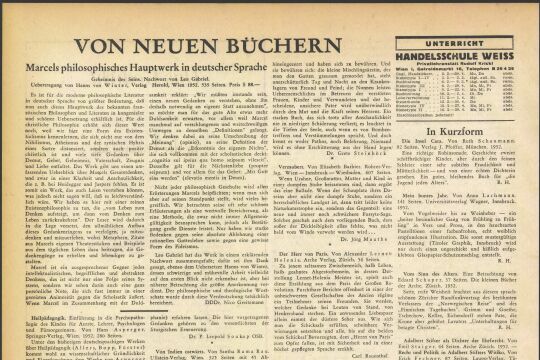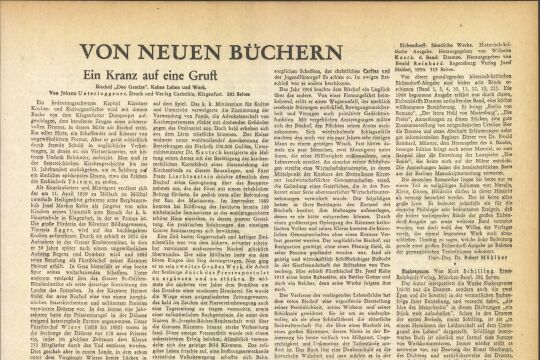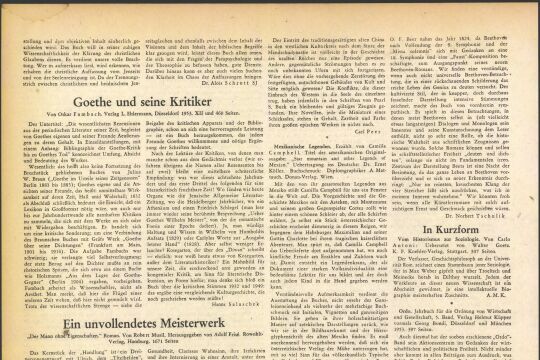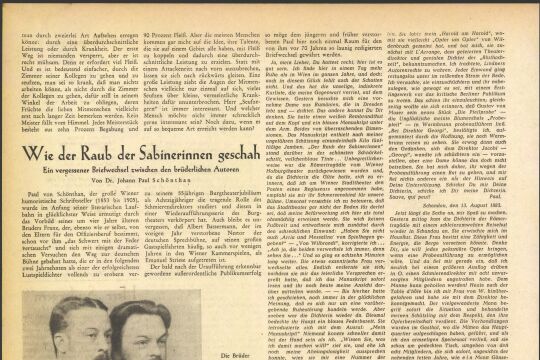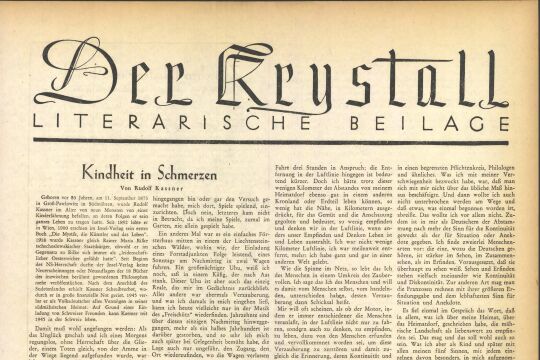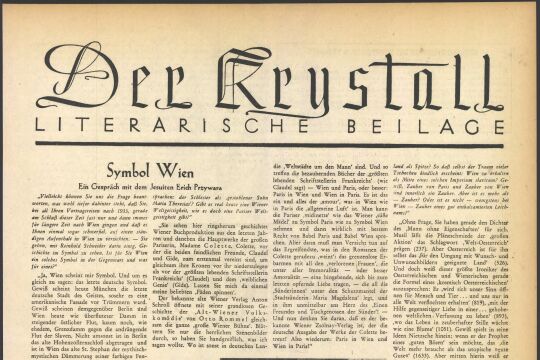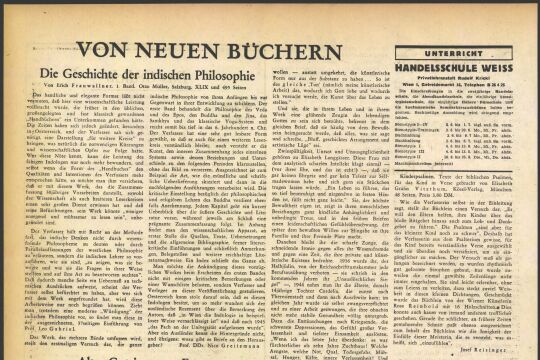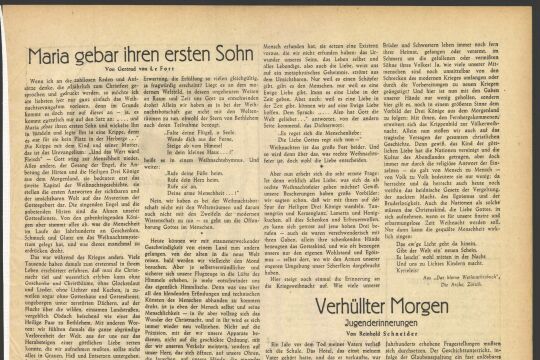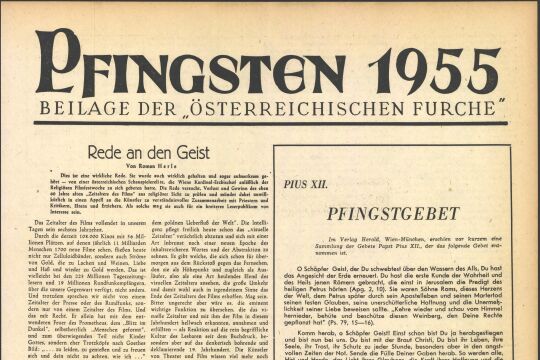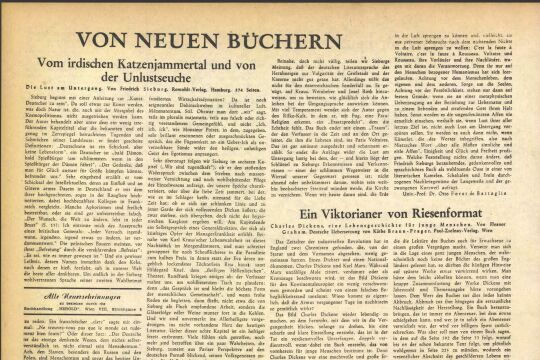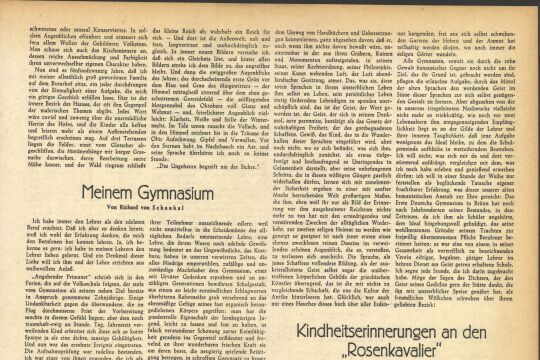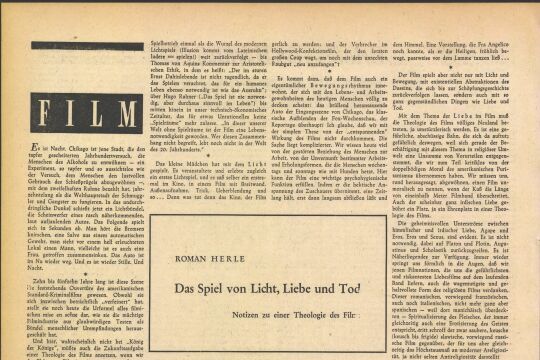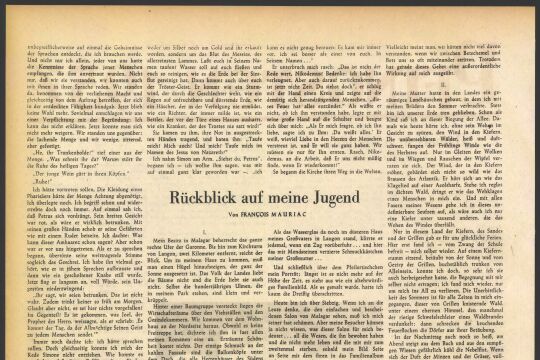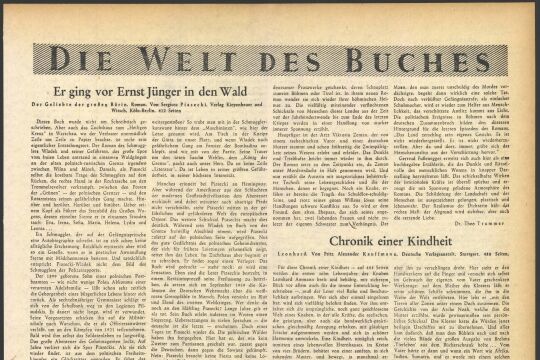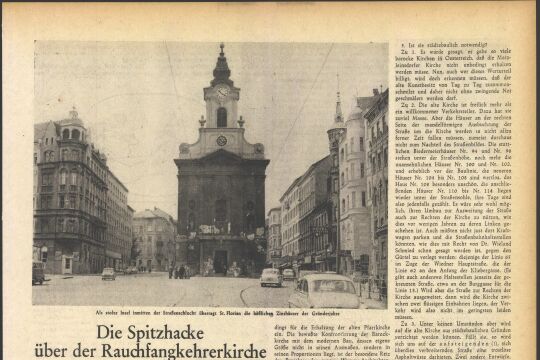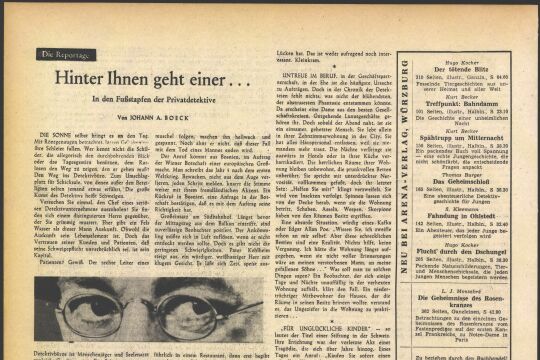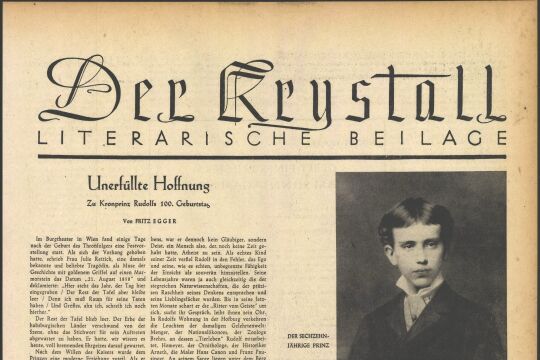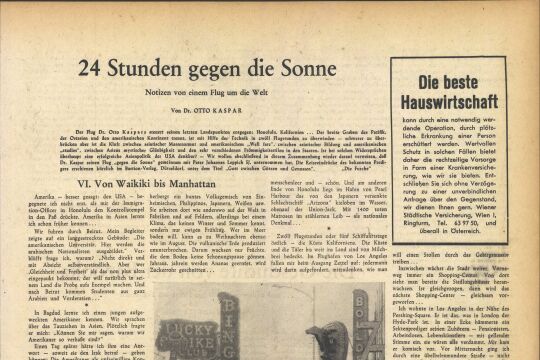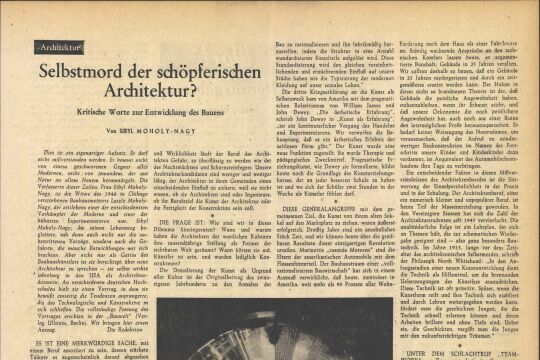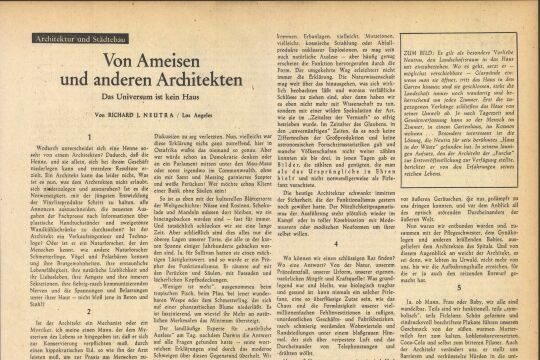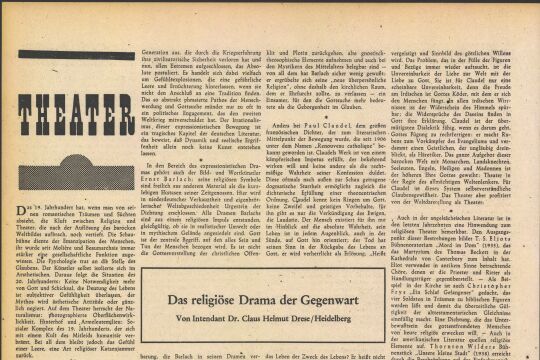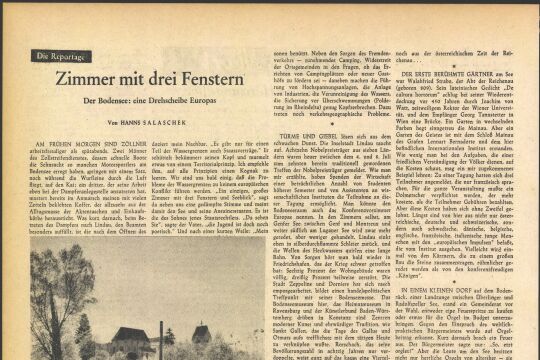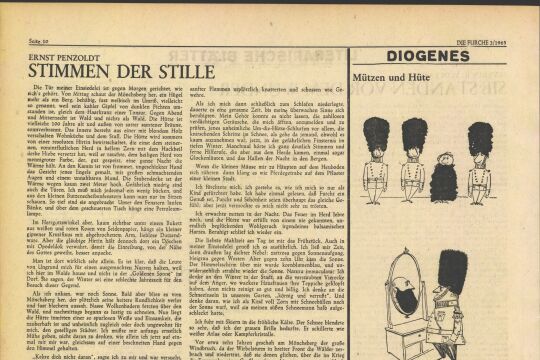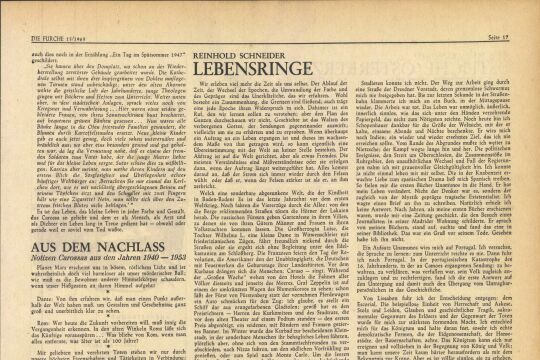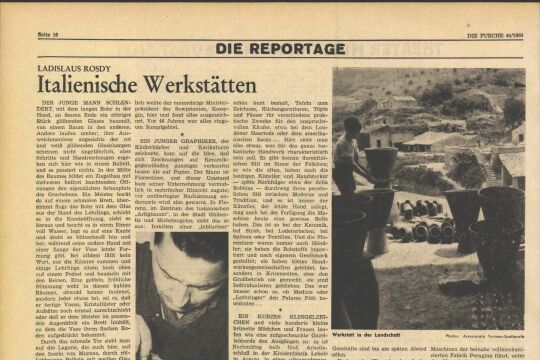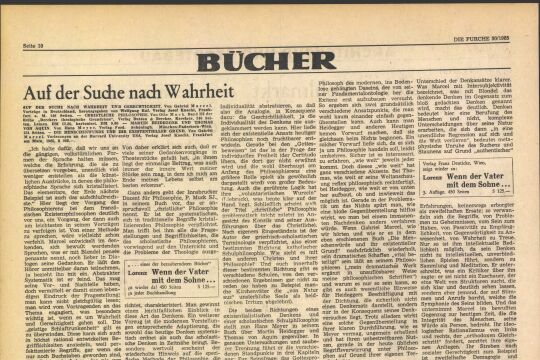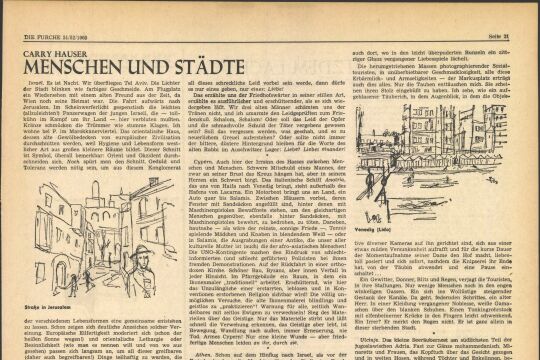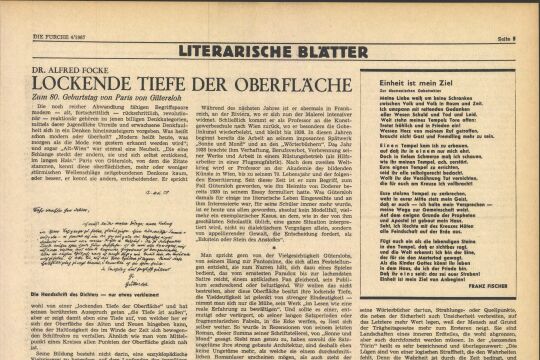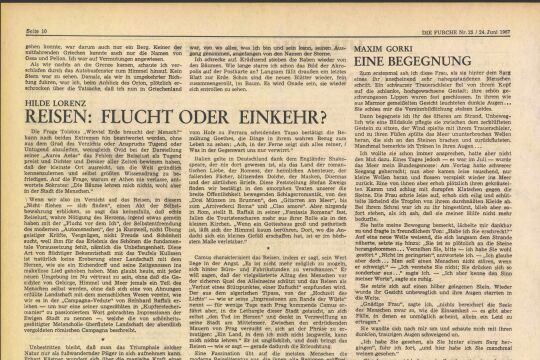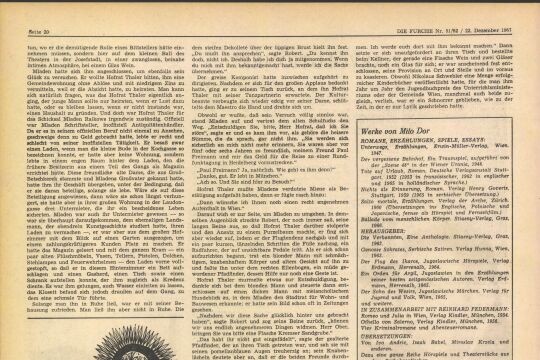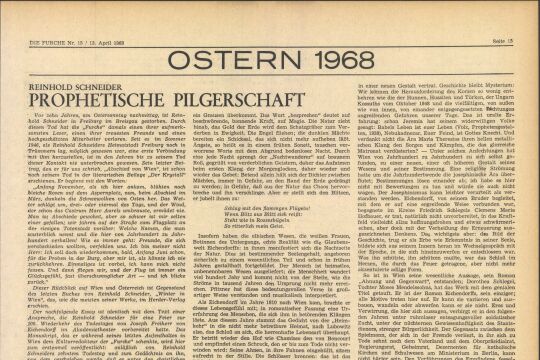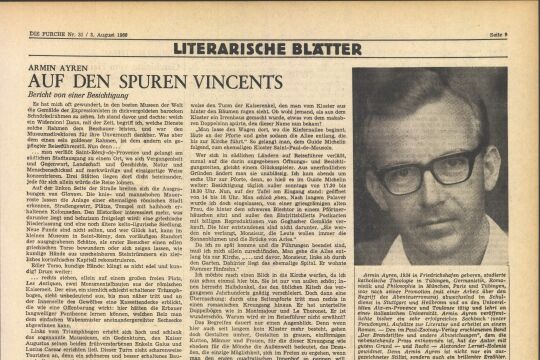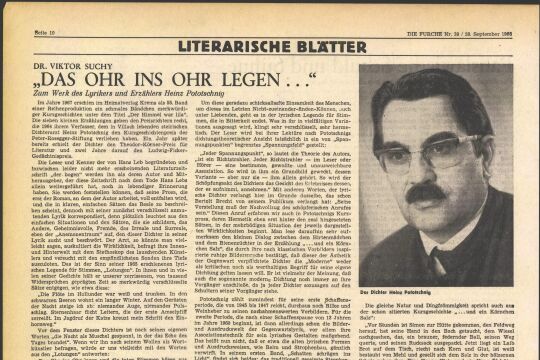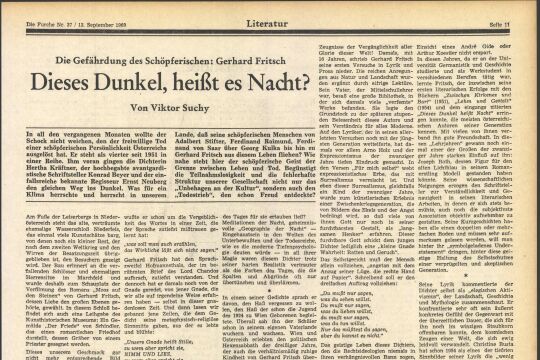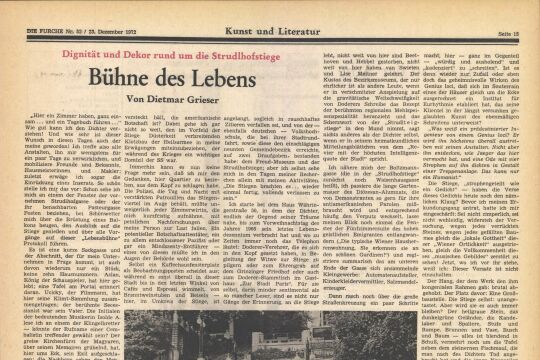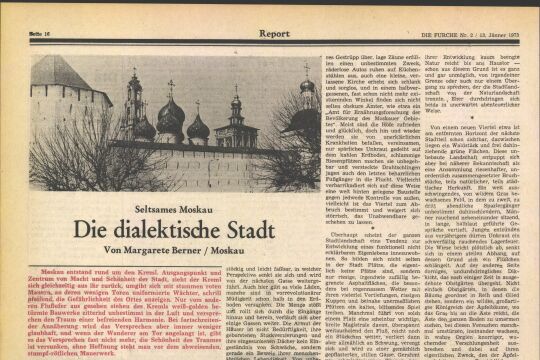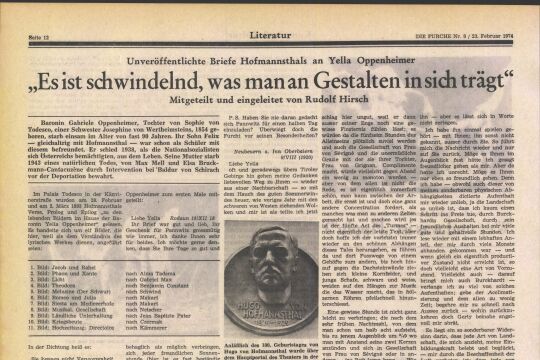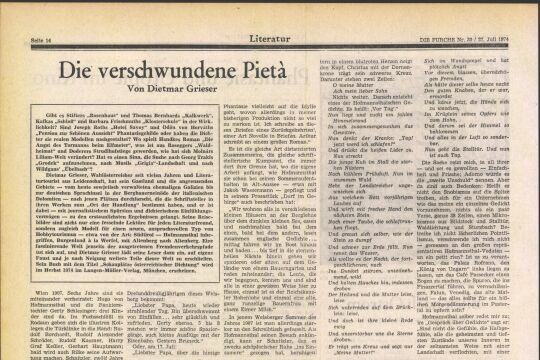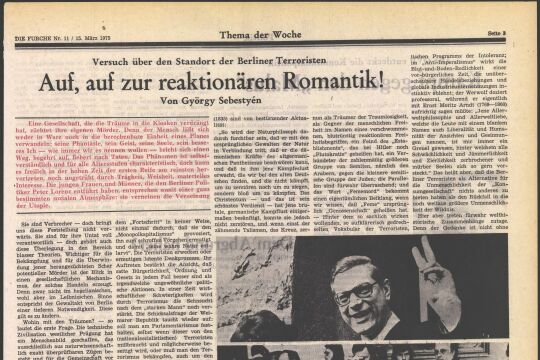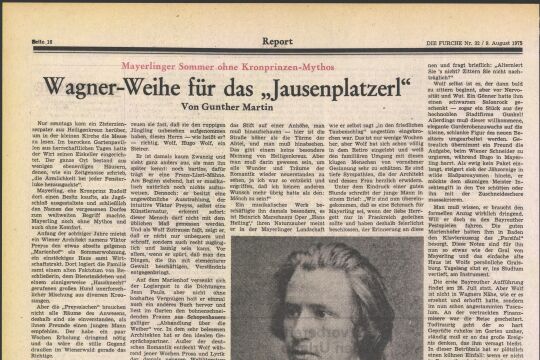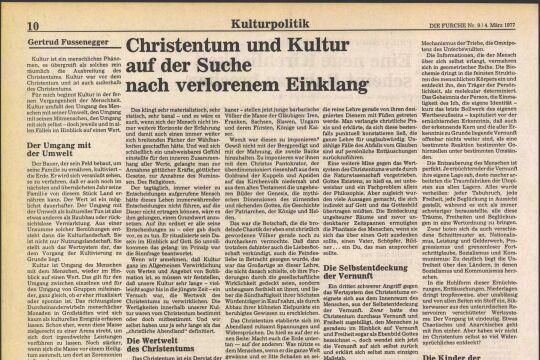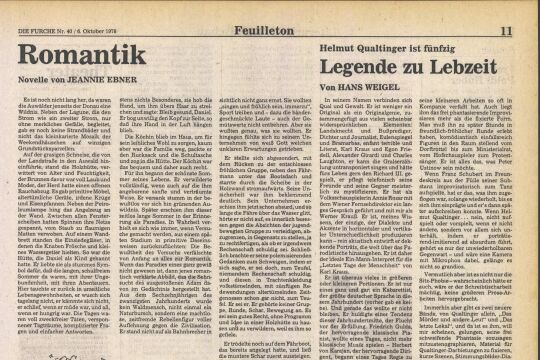Die Hütte: zivilisatorischer Anfang und Rückzugsort
Sie ist Urbild menschlicher Behausung und dient bereits seit Jahrhunderten als Objekt architekturhistorischer, philosophischer wie literarischer Betrachtungen: die Hütte.
Sie ist Urbild menschlicher Behausung und dient bereits seit Jahrhunderten als Objekt architekturhistorischer, philosophischer wie literarischer Betrachtungen: die Hütte.
Woanders zu leben, weit entfernt von dem überfüllten Haus, fern der städtischen Sorgen“, – diese Sehnsucht treibt zivilisationsmüde Bürger nicht erst seit Covid-Zeiten um. Es keimt der Wunsch nach einem schlichten Rückzugsort, einem Kokon der Geborgenheit inmitten der Natur. Mit anderen Worten: Wir fantasieren uns in ein Hüttendasein. Was genau da in unserem Geiste widerhallt, hat der französische Philosoph Gaston Bachelard in seiner „Poetik des Raumes“ ergründet (daraus stammt auch obiges Zitat).
Bei unseren „Hüttenträumen“, so Bachelard, tragen wir ein Urbild intimer Räumlichkeit im Kopf. „Gravüren“ nennt er solche Vorstellungen, weil sie fest in unser kollektives Gedächtnis eingraviert seien. Zugleich verweist der Philosoph auf die Dialektik dieser Urbehausungs-Fantasie: „Wer ein Schloss hat, träumt von der Hütte; wer eine Hütte hat, träumt vom Schloss. Ja, noch mehr: jeder von uns hat seine Hüttenstunden und seine Palaststunden.“ Das Bedürfnis nach Zurückgezogenheit wechsle mit jenem nach Ausbreitung, der Wunsch nach Einfachheit mit jenem nach Pracht.
Von der Hütte zum Chalet
Immobilienentwickler und Touristiker haben das Potenzial dieser widerstrebenden Sehnsuchtsziele erkannt. Sie multiplizieren Blockhaus mit Wellness, Hightech und Komfort. Das Ergebnis ist die Luxus-Design-Hütte, im Branchen-Jargon gerne als „Chalet“ etikettiert und mit idyllisierenden Hausnamen wie „Bergwiesenglück“, „Zirbenwald“ oder „Joggl-Hütte“ versehen. Ganze Hüttendörfer schießen neuerdings aus den – vornehmlich alpinen – Böden vieler Länder. „In den Bergen bei uns können Sie zur Ruhe kommen und neue Kraft für den Alltag tanken“, lockt ein Anbieter auf den Katschberg und stellt als Auszeit-Quartier „uralte originale ,Troadkästen‘“ (Getreidespeicher, Anm.) zur Verfügung – mit der „richtigen Mischung aus Originalität und Luxus“. Der Betreiber schmückt seine Werbeprosa mit einer kurzen Geschichte dieser Troadkästen – und mit einer Dosis lyrisierender Zeitkritik: „Ja, heute gibt es TV und Radio-Geräte und […] auch ein Wifi – aber mal ehrlich, ist es nicht schöner, wenn all diese Geräte einmal still sind?, [...] wenn der Abendwind durch die Tannen streicht und man in der Ferne schon einen Uhu oder einen kleinen Singvogel hört?“
Wie der Traum von der Hütte ist auch deren Verklärung nicht neu. Ursprünglich hatte diese Form der Unterkunft freilich wenig Romantisches an sich. Sie war reines Obdach, bot Schutz vor der Witterung und war aus den Materialien der Umgebung fabriziert. Erst die Überwindung dieser Stufe, die Entwicklung einer festen Behausung, ermöglichte eine Verklärung des harten Hüttenlebens. Schlägt jemand aus freien Stücken aber den umgekehrten Weg ein, also vom Haus zur Hütte, stößt er meist auf wenig Verständnis, wie die deutsche Journalistin Petra Ahne in ihrer empfehlenswerten Kulturgeschichte „Hütten. Obdach und Sehnsucht“ darlegt (Reihe Naturkunden, Matthes & Seitz 2019): „Wer sich aus dem Hütten-Dasein herausarbeitet, hat das Zeug zum Helden, wer sich aber freiwillig für sie entscheidet, erregt Verdacht.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!