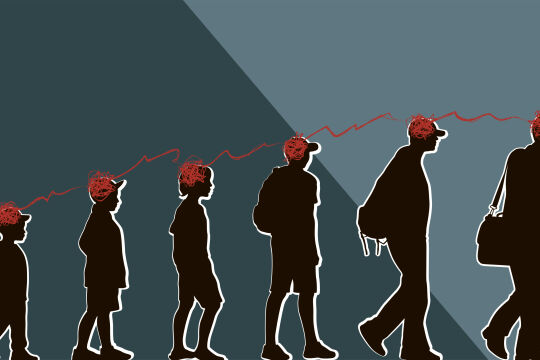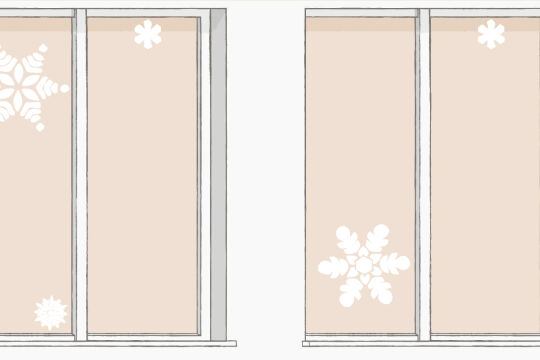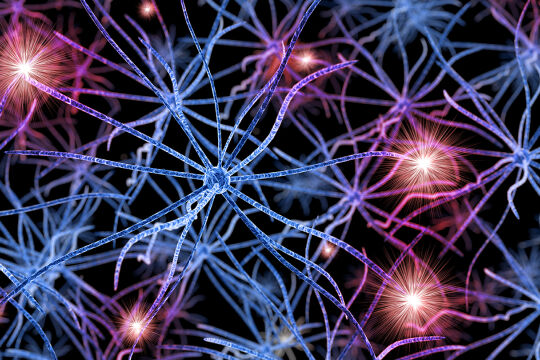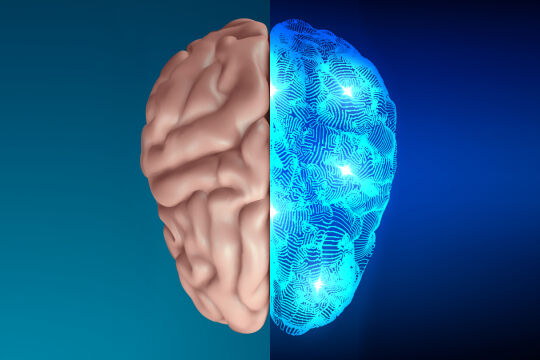Anna Felnhofer und Oswald D. Kothgassner: Die Krux mit der Ausgrenzung
Die Angst vor der Verbannung ist tief im Menschen verwurzelt: Sie trifft uns auch, wenn es sich um virtuelle Gemeinschaften handelt.
Die Angst vor der Verbannung ist tief im Menschen verwurzelt: Sie trifft uns auch, wenn es sich um virtuelle Gemeinschaften handelt.
Einer sozialen Gruppe anzugehören und positive Beziehungen zu ihren Mitgliedern zu pflegen, ist ein lebenslanges Grundbedürfnis des Menschen. Von anderen abgelehnt und ausgegrenzt zu werden, ist deshalb ein stark negatives Erlebnis. Anna Felnhofer und Oswald D. Kothgassner, die beide im Bereich der Klinischen Psychologie der Universität Wien forschten und nun an der Med-Uni Wien und am AKH der Stadt Wien tätig sind, wollten wissen, ob sich soziale Ausgrenzung in einer virtuellen Welt genauso negativ auswirkt.
In einem Experiment haben sie 45 männliche und weibliche Studierende im Alter von 19 bis 35 Jahren mittels einer Virtual-Reality-Brille ein Computerspiel spielen lassen, bei dem die Testperson aus der Ich-Perspektive mit zwei virtuellen Personen einen Ball hin und her kickt. Den Testpersonen wurde gesagt, es würden damit ihre Reaktionszeit und das Spielerlebnis untersucht. Ein Teil der Probanden konnte sechs Minuten lang spielen. Ein anderer wurde nach einer Minute von den beiden virtuellen Partnern nicht mehr beachtet und musste die restlichen fünf Minuten tatenlos zusehen, wie die beiden sich gegenseitig den Ball zukommen ließen.
Vier soziale Grundbedürfnisse
Die Studienteilnehmer wurden anschließend gefragt, wie sie sich dabei gefühlt haben. Jene, die vom Spiel ausgeschlossen und von ihren virtuellen Mitspielern ignoriert worden waren, fühlten sich unsicherer, trauriger und wütender als davor; ihr Glücksgefühl war reduziert. In der Sprache der Wissenschaft: Sie fühlten sich in ihren vier evolutionär verankerten sozialen Grundbedürfnissen "soziale Kontrolle","Zugehörigkeit", "Selbstwert" und "Daseinsberechtigung" maßgeblich beeinträchtigt.
Die virtuelle Ausgrenzung habe bei den Probanden zu den gleichen Reaktionen geführt wie soziale Ausgrenzung im realen Leben, sagen die Studienautoren. Dabei machte es unmittelbar keinen Unterschied, ob ihnen vor dem Spiel gesagt worden war, dass die Figuren von einem Menschen gesteuert werden - den sie vorher im Warteraum gesehen haben - oder von einem Computerprogramm. (Tatsächlich spielten sie immer nur mit dem Computer.)
Wenn allerdings zwischen dem Spiel und der Befragung ein wenig Zeit vergangen war, fühlten sich jene Testpersonen, denen gesagt worden war, dass sie nur mit dem Computer spielen, besser. Sie führten die Ausgrenzung oftmals auf externe Faktoren, wie etwa auf einen Fehler im Computerprogramm, zurück, relativierten das Erlebte also aus Selbstschutz. Jene, die vermeintlich mit einem Menschen gespielt hatten, fühlten sich trauriger.
Anna Felnhofer und Oswald D. Kothgassner wollten auch wissen, ob sich die soziale Ausgrenzung in der virtuellen Welt auf das Sozialverhalten in der realen Welt auswirkt. Dafür bauten sie in die Interviewsituation nach dem Ballspiel zwei weitere, "heimliche" Tests ein: Beim ersten wird die Testperson gebeten, in einem Raum Platz zu nehmen, in dem bereits der vermeintliche Mitspieler sitzt. Dabei wird gemessen, wie weit von der anderen Person entfernt sich die Testperson hinsetzt. Für den zweiten lässt der Interviewer scheinbar aus Missgeschick seine Bleistifte fallen und es wird gemessen, wie lange die Testperson braucht, bis sie reagiert und ihm hilft, die Bleistifte aufzuheben. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die beim Spiel ausgeschlossen worden waren, waren bei diesen Tests weniger hilfsbereit und hielten mehr räumlichen Abstand zu der anderen Person als jene, die die ganzen sechs Minuten lang Ball spielen durften.
Für die Forscher ergeben sich nun mehrere Schlussfolgerungen. "Natürlich war das nur ein Experiment, aber es hat gezeigt, dass wir Menschen die evolutionäre Bereitschaft haben, auf virtuelle Charaktere so zu reagieren, als wären es reale Menschen", erläutert Anna Felnhofer. "Wir haben erstmals untersucht, wie sich die Ausgrenzung in einer virtuellen Welt auf die reale Welt auswirkt."
Den Teufelskreis unterbrechen
Das sei wichtig, weil jemanden zu ignorieren und auszuschließen eine Form von Cyberbullying (Cybermobbing) sein kann, ergänzt Oswald Kothgassner. Viele Opfer von Cyberbullying würden später selber zu Tätern. Dass soziale Ausgrenzung in der virtuellen Welt genauso zu Traurigkeit, Depression, Wut und Aggression führt und die Betroffenen danach distanzierter und weniger hilfsbereit sind, sich vielleicht an denen rächen wollen, die sie ausgeschlossen haben (indem sie sie zum Beispiel ihrerseits ignorieren), könnte eine Erklärung dafür sein. Langfristig könnte diese Reaktion zu einem Teufelskreis führen, wenn nämlich das Opfer zum Täter wird und deshalb wieder ausgegrenzt, also wieder Opfer wird, und so weiter und so fort.
Negative Gefühle durch Ausgrenzung können übrigens auch in textbasierten Medien am Computerbildschirm entstehen. Die Virtual-Reality-Brille ermögliche allerdings ein höheres Maß an Immersion, also des Eintauchens ins Geschehen, sagt Oswald Kothgassner. Er nimmt an, dass auch jetzige "flache" Online-Plattformen wie Facebook in Zukunft virtueller werden und die Nutzer diese Medien damit intensiver erleben könnten. Ein Indiz dafür ist für ihn, dass Facebook Inc. 2014 die Firma Oculus VR gekauft hat, die Datenbrillen entwickelt.
Hilfreiche "Online-Communities"
Oswald Kothgassner und Anna Felnhofer wollen zum Thema soziale Beziehungen in virtuellen Welten weiter forschen und damit die theoretische Basis zur Prävention von Cyberbullying schaffen. Vor allem für Jugendliche, die viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen und aufgrund ihrer starken Orientierung an Gleichaltrigen und dem großen Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe stärker gefährdet sind, wäre das hilfreich. Die Forscher betonen jedoch, dass virtuelle Welten auch positive Effekte haben können, gerade für Jugendliche. "Online-Communities sind für Jugendliche hilfreich und virtuelle Welten kann man auch für Therapien nutzen", so Kothgassner.
Keith Wilcox, Professor für Marketing an der Columbia University in New York, hat in einer Studie festgestellt, dass soziale Netzwerke vor allem dann das Selbstwertgefühl von Nutzern erhöhen können, wenn sie dazu verwendet werden, enge Kontakte zu Freunden zu pflegen, und nicht nur sich selbst gut darzustellen. Andere Studien haben gezeigt, dass Menschen, die mit ihrem Leben unzufrieden sind oder schlechte Erlebnisse hatten, sich in sozialen Medien auch Hilfe holen - oder sich einfach schon dadurch besser fühlen können, dass sie die Einträge ihrer Freunde lesen.