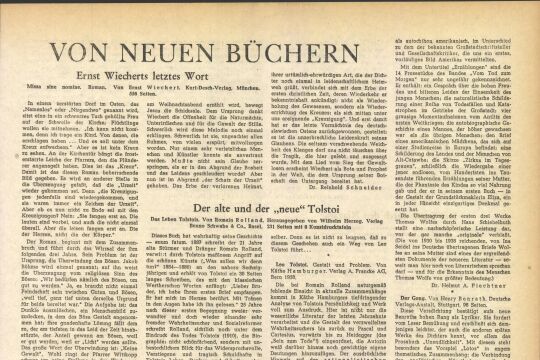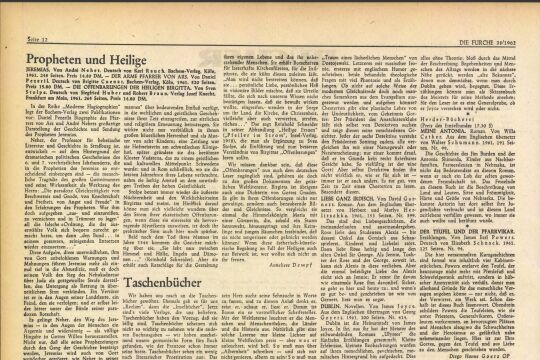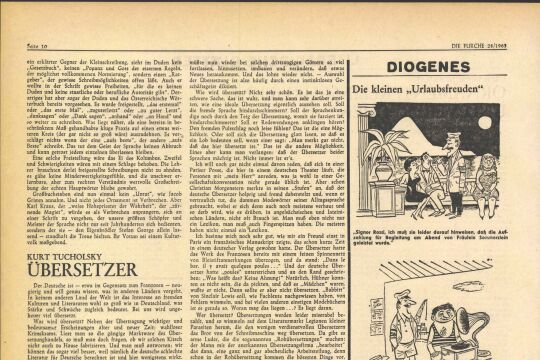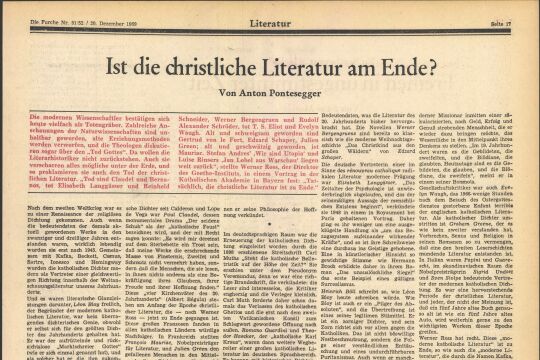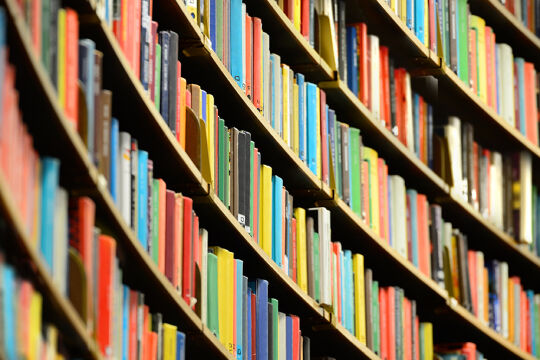John Banville schrieb Romane über Kunst und Wirklichkeit, Erinnerung und Täuschung. Am 25. Juli erhält der irische Autor den Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur.
"Von all den Dingen, die zu ihrem Troste wir ersannen ist doch das Einzige, was funktioniert, die Morgendämmerung …“ Bei einem solchen Romananfang wird einem doch gleich recht homerig ums Herz. Und so geht es denn auch weiter, ganz offensichtlich aus Götterperspektive: "Wenn Dunkelheit wie feiner Ruß der Luft entrieselt und mählich sich von Osten her das Licht ausbreitet, regt selbst im jämmerlichsten aller Menschen sich frisches Leben. Das ist ein Schauspiel, wie es uns Unsterblichen gefällt, so eine kleine Auferstehung jeden Tag.“
Wer seinen Roman so beginnt, nennt sich nicht Homer, sondern John Banville, der im Folgenden niemand Geringeren als Hermes sprechen macht. Zumindest lässt er das seine Leserinnen und Leser lange glauben. Bis sich Zweifel regt, wer hier spricht, oder vielleicht besser: denkt. Und damit wären schon einige Literaturmarkenzeichen des irischen Autors benannt, der am 25. Juli 2013 mit dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur ausgezeichnet wird: John Banville hat beim Schreiben nicht unbedingt ein Mehr an Klarheit im Sinn, wenn er die Kraft der Literatur zur Wirklichkeitserschaffung und -verwirrung einsetzt. Und er schreibt ohne Scheu und munter in den Fußstapfen großer Dichter, zitiert Sprache und Motive anderer, vorangegangener Texte mit Lust und Laune. Zu seinen ständigen Begleitern gehören William Shakespeare, Marcel Proust, Henry James, Samuel Beckett, Vladimir Nabokov, Heinrich von Kleist, Thomas Bernhard und Franz Kafka. Das klingt vielversprechend.
Literaturland Irland
Große Vorbilder darf ein irischer Schriftsteller auch nicht fürchten, immerhin ist die grüne Insel voll davon. Die Werke von William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde und George Bernard Shaw machen es nachgeborenen Autoren nicht leicht, ihren Platz innerhalb so prägender Tradition zu finden - und zudem zu vermeiden, den "Typisch Irisch“-Stempel aufgedrückt zu bekommen. John Banville, der 1945 im irischen Wexford geboren wurde, mag solche Klischees überhaupt nicht und weiß als langjähriger Literaturredakteur der Irish Times, wie gute Literatur aussehen kann. Und er weiß - und tut dies in teils überraschend heftigen Kritiken (wie etwa jene gegen Ian McEwans 9/11-Roman "Saturday“) auch kund -, wie aus seiner Sicht Literatur aussehen soll: Literatur muss sich - und darauf verweisen auch die Banvillschen Vorbilder - um die Sprache kümmern.
Seit seinem Schriftstellerdebüt im Jahr 1970 erschienen viele auch ins Deutsche übersetzte Romane. Thematisch lassen sich einige einem "Naturwissenschafts“-Zyklus zuordnen: "Doktor Kopernikus“, "Kepler“, "Newtons Brief“ und "Mefisto“. Die Themen Moral, Ästhetik, Authentizität, Kunst und Identität werden in "Das Buch der Beweise“, in "Geister“ und in "Athena“ verhandelt: Das Lob dieses Romans im "Literarischen Quartett“ machte den Autor schlagartig auch im deutschsprachigen Raum bekannt.
Mit seinem Roman "The Sea“ ("Die See“) erhielt er 2005 endlich den renommierten Booker Prize und damit den wichtigsten Literaturpreis der Länder Großbritannien, Irland und des Commonwealth.
Reale Vorbilder
Banville greift für seine Romane nicht nur auf mythologische oder literarische Vorlagen zurück, sondern auch auf konkrete Gestalten der Weltgeschichte. Für den Roman "Der Unberührbare“ diente der britische Spion und Kunsthistoriker Anthony Blunt als Vorlage, im Roman "Caliban“ scheint durch die Figur des Axel Vander der Literaturwissenschaftler Paul de Man durch. Dieser war einerseits durch seine dekonstruktivistischen Beiträge über das Lesen von Texten berühmt geworden ("Allegorien des Lesens“), andererseits wurde 1987 seine verborgene Vergangenheit als Verfasser von Beiträgen in belgischen Kollaborationszeitungen der 40er Jahre bekannt. Hier die Theorie, dass die Sprache, selbst wenn sie etwas zeigen will, immer auch verbirgt - und da der Mensch, der diese Theorie vertritt und seine Vergangenheit verbirgt - ein verlockendes Sujet für einen Autor, der sich gerne mit Themen wie Sprache, Wahrheit, Kunst und Täuschung auseinandersetzt.
Spannend ist auch in diesem Roman die Erzählstimme - denn wie kann man einem Erzähler trauen, der schon am Anfang sagt: "Lügen ist meine zweite, nein, meine erste Natur. Ich habe mein ganzes Leben lang gelogen. Ich habe gelogen, um davonzukommen, ich habe gelogen, um geliebt zu werden, ich habe gelogen für Macht und Würde; ich habe gelogen um des Lügens willen. Es war eine Lebensweise: Lügen sind das Beinahe-Anagramm des Lebens.“ Wie kann man einer Instanz vertrauen, die Sätze sagt wie: "Ich habe mir eine Stimme erschaffen, genauso wie ich mir vorher ein Ansehen erschaffen habe - aus lauter geklautem Material“ und "In meinem Textkörper ist nicht ein einziger Knochen.“
Nebenbei schreibt Banville als Benjamin Black Kriminalromane und inzwischen ist wegen der Bekanntheit des Autors der echte Namen meist mit auf dem Cover zu sehen. Seine Werke wirken wie mühelos errungen, in der scheinbar großen Einfachheit liegt aber gerade ihre Kunst.
Wenn in einem Roman wie dem zuletzt auf deutsch erschienenen, "Unendlichkeiten“, der Erzähler ein Gott sein darf, kann er darin mit den Figuren und der Handlung machen, was er will. Ein Eldorado für Erzähler! In einem Interview mit der NZZ gestand Banville: "Je älter ich werde, desto mehr begreife ich, dass die Gattung des Romans im Wesentlichen humoristisch ist. Selbst wenn ein Roman tragisch ist, hat er etwas zutiefst Komisches, zumal bereits dem Bemühen des Romanciers, seine Erzählung so lebensecht wie möglich erscheinen zu lassen, etwas Lächerliches anhaftet.“ Und das gelingt Banville tatsächlich: Die Situation, dass ein Pater familias im Sterben liegt und seine Familie im Haus versammelt ist, leichtfüßig wie auf geflügelten Hermesschuhen zu erzählen und so sogar dem Thema Tod mit Augenzwinkern zu begegnen, während im Haus auch Zukunft gezeugt wird, auf eine Weise, die die alten Griechen nicht hätte staunen lassen.
Gewinn und Verlust
In "Unendlichkeiten“ kann der Erzähler Hermes - aber vielleicht kann jeder zu einem Hermes werden, auch der Sterbende - den Menschen zumindest insofern helfen, als er "Geschichten, tröstliche oder wenigstens tröstlich vernünftige Erzählungen davon, wie und warum die Dinge so sind, wie sie sind“ mitbringt. Wenn das kein Trost ist, der wie die Morgendämmerung funktioniert. Literatur sozusagen als kleine Auferstehung für jeden Tag.
"Man geht nicht zur Kunst, um zu entkommen, sondern um zu verweilen; nicht um zu fliehen, sondern um einzutreten“, schrieb John Banville einmal in einem Essay. "In der Kunst finden wir vielleicht keine Tatsachen, aber wir finden Wahrheit. Und möglicherweise ist dies die wirkliche Quelle jenes schmerzhaften, schneidenden Gefühls von gleichzeitigem Erkennen und Fremdheit von Gewinn und Verlust, das wir im Angesicht großer Kunst erfahren; des Gefühls nämlich, dass diese Welt unsere Heimat ist und dass wir doch nicht in ihr daheim sind; dass die Welt immer Gegenwelt ist.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!