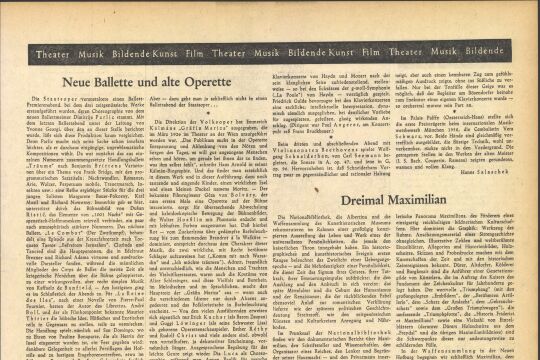Der Wiener Staatsoper ist mit der letzten Premiere dieser Saison ein großer Wurf gelungen: Strauss' Alterswerk "Capriccio" überzeugt musikalisch wie szenisch.
Richard Strauss' musikalisches Testament zählt nicht zu den Fixsternen am Opernhimmel. Der Komponist selbst meinte über seine letzte Oper, sie sei "vielleicht ein Leckerbissen für kulturelle Feinschmecker", aber "kein Stück fürs Publikum". Heute, wo Oper keine populäre Unterhaltungsform mehr ist und das Publikum zum überwiegenden Teil aus Kulturgourmets besteht, hat dieses Diktum seine Gültigkeit verloren. Dies hat die Wiener Staatsoper in einer mustergültigen, in jeder Hinsicht exzellenten Produktion von "Capriccio" deutlich gemacht. Das vermeintlich spröde und altväterische "Konversationsstück" aus dem Jahr 1942 erweist sich als ein an wunderschönen Melodien reiches, höchst intelligentes, witziges und modernes Werk.
Prächtige Klangfarben
Den Grundstein für die außergewöhnliche Aufführung legt Philippe Jordan mit dem Staatsopernorchester, indem er Strauss' prächtige Klangfarben kraftvoll aufträgt und auch für die zahlreichen musikalischen Reminiszenzen und Zitate (vom Barock über den italienischen Belcanto bis zum "Rosenkavalier") den richtigen Ton trifft. Marco Arturo Marellis Inszenierung punktet mit ihrer optischen Opulenz ebenso wie mit ihrem Witz.
Der Regisseur hat die von Strauss gemeinsam mit Clemens Krauss verfasste Geschichte in ihrer Zeit und an ihrem Ort, dem französischen Rokoko, belassen. "Capriccio" behandelt ja die alte Frage, was in der Oper Vorrang hat: der Text oder die Musik. Symbolisiert wird der Konflikt durch den Dichter Olivier (Adrian Eröd) und den Musiker Flamand (Michael Schade), die um die Gunst der Gräfin buhlen. Renée Fleming verkörpert diese Zentralfigur im Stile einer echten Diva, souverän und graziös, perfekt in Stimme und Ausdruck. Ihren Anteil an dem leidenschaftlich geführten Diskurs haben auch die zugleich selbstbewusste und verletzliche Schauspielerin Clairon (Angelika Kirschschlager), der sich als Schauspieler versuchende, hoffnungslos unbegabte Graf (Bo Skovhus lässt wieder einmal sein komödiantisches Talent spielen) und der das Klischee des Bassbuffos schnell hinter sich lassende Theaterdirektor La Roche (Franz Hawlata).
Modernität und Humor
In dem hervorragenden Sängerensemble bleiben lediglich Jane Archibald und Cosmin Ifrim stimmlich farblos. Dafür ist die Szene um das italienische Sängerpaar, das im Salon der Gräfin eine Probe ihres Können gibt, um so köstlicher inszeniert: In venezianischen Gondeln schweben die beiden auf die Bühne und schmachten ihr "Addio, mia vita, addio" bevor sie sich theatralisch ein Messer in die eigene Brust stoßen. Diese Szene und der sich in den folgenden Oktetten entwickelnde Streit über das Wesen der Oper, der durch ein flammendes Plädoyer La Roches beendet wird, stellen die inszenatorischen Höhepunkte der Aufführung dar (zu denen sich "Mondscheinmusik" und der Schlussmonolog der Gräfin als musikalische Glanzlichter gesellen).
In den beschriebenen Schlüsselszenen offenbart sich auch die Modernität des "Capriccio"-Textes, der überdies vor subtilem Humor nur so sprüht. Der Streit zwischen Wort und Musik mutet aus heutiger Sicht ein wenig scholastisch an, doch der Konflikt zwischen dem auf Wirkung bedachten Theatermacher und den Verteidigern der Unversehrtheit der hehren Kunst hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. "Regie die Lösung, Regie das Geheimnis" lautet La Roches diesbezügliches Bekenntnis. Bisweilen verwundert es, dass ein Stück, das derartige Passagen enthält, während der NS-Herrschaft uraufgeführt werden durfte: eine Oper über Oper zu einer Zeit, als im deutschen Kino Filme über Filme längst verboten waren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!