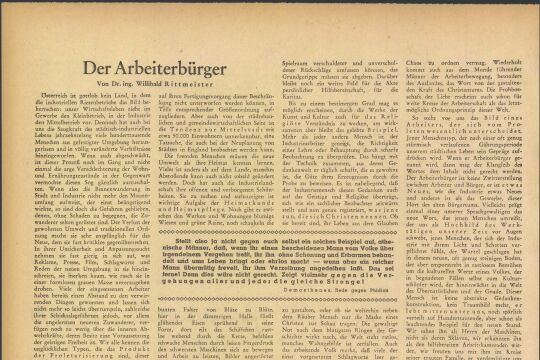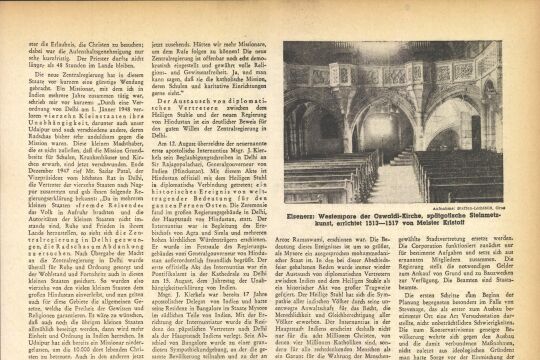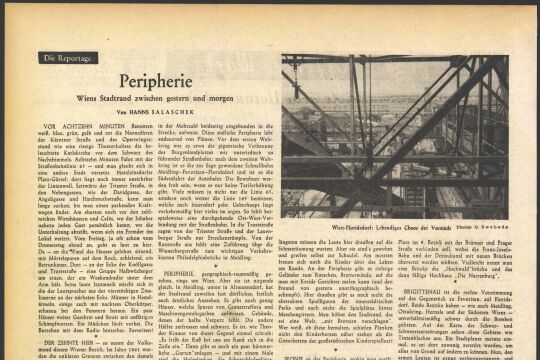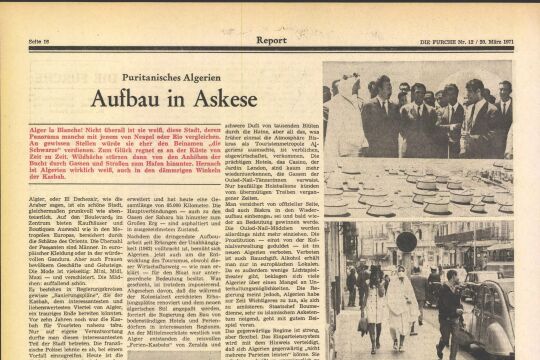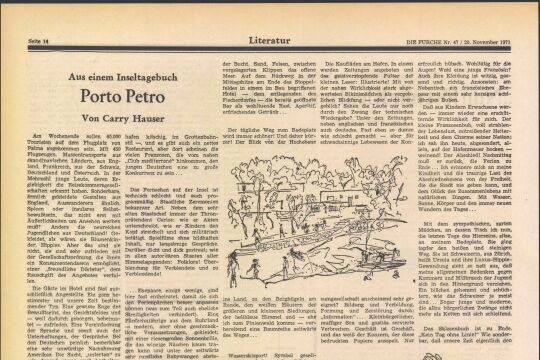Hochtrabende Pläne, enttäuschte Hoffnungen, leere Kassen. Ein Streifzug durch ein von der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise schwer in Mitleidenschaft gezogenes Land.
Bunt, elegant und voll von jungen, weißen Menschen: Die Bilder des Stadtviertels, die gleich vor dem Bahnhof von Stratford von den Plakatwänden strahlen, sehen aus, als hätte man sich in der Gegend geirrt. Denn hier, im Osten Londons, ist die Wirklichkeit ganz anders. Hier ist man nicht elegant und nur ganz selten weiß. Stratford, Dagenham, Brixton: Seit Generationen wandert die Armut kreuz und quer durch London, krallt sich immer wieder in irgendeinem Viertel fest. Wo die Industrie abwandert, verschwinden bald auch die Menschen – zumindest jene, die anderswo eine Zukunft finden. Abgelöst werden sie von Zuwanderern aus Pakistan, Bangladesch – und einem Berg sozialer Konflikte.
In Stratford hat man Eisenbahnen gebaut, auch das ist lange her, davon blieben nur die Hallen, die langsam verfallenden Arbeiterwohnungen und die älteren, weißen Bewohner, mit denen der Aufschwung des vergangenen Jahrzehnts nichts anzufangen wusste. Bei ihnen sammeln die Faschisten von der British National Party bei dieser Parlamentswahl die Stimmen ein.
Doch das soll jetzt alles anders werden, schnell und gleich im großen Stil, im ganz großen. Die Hallen, die Arbeiterwohnungen, all das ist in einer riesigen Baugrube verschwunden. In Stratford entsteht der Olympia-Park für die Sommerspiele 2012 und hinter den Plakatwänden wächst die Stadt dazu: Wohnungen, öffentliche Einrichtungen und als Mittelpunkt ein Einkaufszentrum. Das größte Europas, heißt es auf den Plakatwänden, samt Hotel und Freizeitpark. Ein Motor für den Aufschwung. Doch der stockte auf einmal im Herbst 2008. Seit der Finanzkrise läuft das wirtschaftliche Karussell, das die Labour-Regierung so konsequent angetrieben hat, nicht mehr rund – und nicht mehr so schnell.
Die sichtbarsten Zeichen dieser Krise sind die Einkaufstempel. Das ganze Land hat man damit gepflastert, ärmliche Vororte, Autobahnkreuzungen und natürlich die Innenstädte von Manchester bis Leeds.
Brachen und Hoffnungslosigkeit
Dort, wo die britische Industrie seit Ende der siebziger Jahre ihrem unausweichlichen Ende entgegendämmerte, Brachflächen und Hoffnungslosigkeit hinterließ, plante und baute man das neue Großbritannien der Dienstleister und der Shopper. Die niedrigen Zinsen machten den Menschen Lust auf Kredite, der Immobilienboom gab ihnen Geld in die Hand – und die Einkaufszentren genug Gelegenheiten, um es auch auszugeben.
Mehr als genug, wie man heute sieht: Immer öfter bleiben in den pompösen Shopping-Palästen die Schaufenster dunkel. Die Kunden kamen nicht mehr, also gingen die Geschäfte auch, und die Restaurants mit ihnen. Die Krise hat Hunderttausende den Job gekostet, noch mehr aber hat sie Angst gemacht – und Angst macht keine gute Shopping-Laune.
Im Londoner Stratford macht man sich unverdrossen Hoffnung auf den Boom, auch wenn die ersten Gerüchte über ausbleibende Investoren und verlängerte Bauzeiten umgehen.
Anderswo im Land ist diese Hoffnung längst dahin. In Bradford, in Yorkshire, klafft seit Jahren an Stelle des Stadtzentrums eine riesige Baugrube. Hier merkt man den Plakatwänden rund um das Gelände schon an, dass sie schon ein paar Jahre das unleidliche Wetter des englischen Nordens aushalten müssen. „Fünf Jahre mindestens – eine Schweinerei ist das“, erfährt man von einem ähnlich unleidlichen Passanten. Aus den „fantastischen Möglichkeiten“, die die Werbung auf den Blechwänden verspricht, ist nichts geworden. Vom gigantischen Einkaufszentrum, das hier entstehen sollte, bleiben bis auf Weiteres nur die rohen Betonpfeiler für das Fundament. Die Wirtschaftkrise hat dem Immobilienprojekt endgültig den Garaus gemacht. Die Investoren sind weg, die Baulücke bleibt, als surreal hässliche Erinnerung an den Aufschwung, der irgendwann steckenblieb.
In der Baulücke von Bradford steckt auch der Plan, mit dem die Labour-Regierung die abgewirtschafteten Industriestädte des Nordens beleben wollte. In Bradford war die Textilindustrie langsam aber unaufhaltsam zugrunde gegangen. Zurück blieben nur die Menschen aus Pakistan und Bangladesch, die man geholt hatte, um hier die Stoffe aus Leeds zu Kleidung zu verarbeiten. Doch in Leeds werden keine Stoffe mehr gemacht – und in Bradford keine Hemden mehr genäht. In Sheffield kein Stahl, in Rotherham kein Koks. Also sollte es eben Dienstleistung sein: Callcenter, Finanzdienstleistungen, Versicherungen und viele, viele Beamtenjobs wurden hierher verfrachtet.
Das Shopping-Wachstum
Und das so verdiente Geld sollte möglichst rasch von Hand zu Hand gehen, Wirtschaftskreislauf eben. Also war das Herzstück des perfekt inszenierten Booms immer ein Shoppingcenter, öfter aber noch eine ganze Handvoll davon.
Das ging viele Jahre und an erstaunlich vielen Orten ziemlich gut. Wer sich etwa vor ein paar Jahren nach Birmingham wagte, in der fixen Erwartung, eine Stadt im industriellen Elend vorzufinden, wurde überrascht. Ein neue Konzerthalle, eine Fußgängerzone voll mit Bars und Geschäften und Bürohochhäuser, die sich fast schon auf die Füße traten, so dicht an dicht hatte man sie ins Zentrum gebaut. Platz gab es ja genug, britische Städteplaner sind nicht so zimperlich wie ihre Kollegen auf dem Kontinent. Plätze wurden angelegt, damit man sich zu Fuß vom Büro ins nächste Einkaufszentrum begeben konnte. Die waren ja Stadtzentren in sich, mit Kinos, Restaurants und all den Modeketten, die flächendeckend von London bis Glasgow diese Einkaufszentren besiedelten.
Heute, ein paar Jahre später, ist dem Aufschwung auch in Birmingham die Luft ausgegangen. Die Bürohochhäuser sind mit Schildern „zu vermieten“ zugepflastert. Einem Einkaufszentrum sind die Restaurants im Erdgeschoss abhanden gekommen, einem anderen die zugkräftigen Modemarken. Die Krise lässt die Zweifler lauter werden. Der Aufschwung sei auf Luft, und vor allem auf den Schulden der Menschen gebaut. Großbritannien habe sich wirtschaftlich zu Tode konsumiert.
In den einstigen Kohle- und Stahlregionen beschwören die Politiker jetzt wieder die industrielle Tradition Englands, die man beleben müsse. Firmenansiedlungen werden als politische Triumphe gefeiert. Auch von grünen Jobs ist überall die Rede, die Windparks an Englands Südküste sind zum Statussymbol für die wieder entstehende Hightech-Nation Großbritannien geworden.
Armut und Millionenboni
Der Mythos von britischer Innovationskraft und technischer Überlegenheit ist guter Stoff für Wahlkampfreden. Vor allem in Zeiten, in denen die Arbeitsplätze viel schneller verschwinden als entstehen. Die Angst vor den unausweichlichen Budgetkürzungen durch die nächste Regierung geht um. Gerade in den Krisenregionen hat Labour großzügig Jobs in der Verwaltung verteilt, um so die Menschen aufzufangen, die in der neuen Dienstleistungsgesellschaft sonst keinen Platz gefunden hätten. Wenn jetzt, vor den Wahlen, von Bürokratieabbau und schlankerer Verwaltung die Rede ist, wissen die örtlichen Politiker längst, dass damit ihre Lehrer, Polizisten, Beamten gemeint sind.
Während sich die Krise überall im Land festsetzt, scheint sie dort, wo sie ihren Anfang nahm schon wieder vergessen. In der Londoner City, dem Herzstück der britischen Finanzwelt, spricht man heute wieder offen über Gewinne und die unweigerlich dazugehörigen Managerboni. In den Wirtschaftsnachrichten folgt eine gute Bankenbilanz der nächsten.
Abends in den Pubs am Fuße der Bürotürme, tauschen die Banker die Geschichten über rote Zahlen, gefallene Investment-Stars und Kündigungslisten inzwischen wie Heldenlegenden aus einem vergangenen Krieg aus. „Bei einem Pint und mit gelockerter Krawatte“, erzählt ein City-Bewohner, „gratuliert man einander, dass man alles überstanden hat.“
* Der Autor ist Außenpolitik-Redakteur des „Kurier“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!