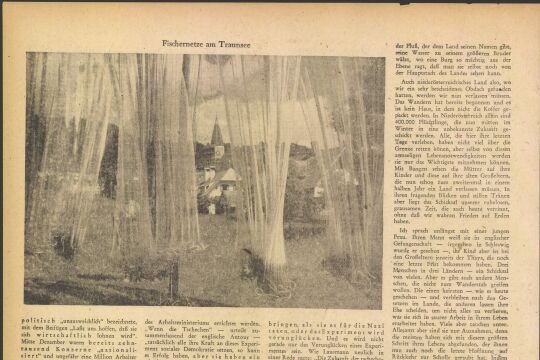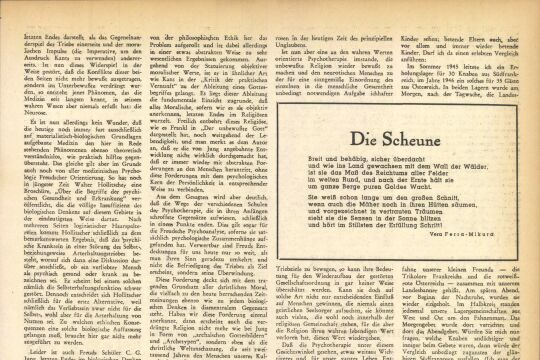Wo das Leid unerträglich wird und überdimensional, führt es zur Lähmung. Ein Besuch in Srebrenica, wo im Juli 1995 8000 Menschen ermordet wurden.
Als wäre ihre Familie nur Einbildung gewesen, ist Hatidz˘a Mehmedovic´ nur noch eine Ahnung geblieben. Nur in Gedanken kann sie nachspüren, wie sich dieses Leben anfühlte, wie ihr Mann sie ansah, wie ihre Kinder rochen, und wie sie einst am Fensterrahmen lehnte, wenn ihre beiden Buben von der Schule einmal wieder länger brauchten als üblich.
Als die Mehmedovic´s ihr Haus bauten, schürfte der jüngere Sohn seinen Namen neben die Haustürschwelle in den feuchten Asphalt. LALO. Heute wirken diese vier Buchstaben wie eine Nachricht aus der Vergangenheit. Sie sind Hatidz˘as einziger Trost, denn sie geben ihr Gewissheit, dass das Leben, das sie einst mit ihrer Familie führte, Wirklichkeit war.
Genauso wie die Murmeln ihres älteren Sohnes. Wenn sie von den Kindern erzählt, holt Hatidz˘a sie aus der Kredenz und rollt sie zwischen den Handflächen, als würde sie dadurch das vergangene Leben erspüren, als würde sie darin ein wenig Wärme finden, damit die Sehnsucht betäuben. Die Buchstaben im erstarrten Asphalt und die Murmeln - das ist alles, was der 61-Jährigen als Andenken an ihre Familie geblieben ist. Denn Hatidz˘a hat ihren Mann und ihre Söhne verloren, sie wurden im Massaker von Srebrenica ermordet. Das, was 1995 passierte, "war meine größte Strafe“, sagt Hatidz˘a. Aus ihr hat es eine Art Prophetin gemacht. Ihr Leben hat sie seither der Warnung vor dem gewidmet, was ihrer Familie einst widerfahren ist. "Das, was mir passiert ist, darf sich niemals wiederholen.“
Hatidz˘a ist Obfrau der Vereinigung "Mütter von Srebrenica“, ihre Mitglieder sind Frauen aus Srebrenica und Umgebung, die, so wie Hatidz˘a selbst, nahezu alle männlichen Verwandten verloren haben. Hatidz˘a hat beispielsweise nicht nur ihre Söhne und den Ehemann zu beklagen, sondern auch alle Neffen, Brüder, Schwager, Cousins. Ihre Verwandten gehören zu den mehr als 8000 Opfern, die von serbischen Milizen systematisch ermordet wurden, nur deswegen, weil sie Muslime waren.
Ein Muster weißer Stelen
Der Ort des Massakers ist längst zur Chiffre geworden für das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg - Srebrenica, ein kleiner Ort im Osten Bosniens, rund 15.000 Einwohner. Auf einer zweispurigen Straße fädelt sich diese Gemeinde auf, rechts davon taucht irgendwann der große Friedhof auf, auf dem die Opfer des Massenmordes begraben sind. Weiße Stelen ragen aus dem Boden empor, in exakten Abständen zueinander, sodass ihr Anblick beim Vorbeifahren geometrische Muster ergibt. Der Hauptplatz ist eine Straßenkreuzung, gesäumt von Rathaus, Kirche, Moschee, einer Bankfiliale. Srebrenica, das sind eigentlich die vielen Dörfer rundherum auf den Hügeln, die vielen verstreuten Siedlungen in dieser satten bosnischen Landschaft, mit ihren kalten Nächten und grünen Wäldern.
Silberin lautet der alte deutsche Name dieses Ortes, schon zu Zeiten des Römischen Reiches wurde hier Silber abgebaut. Als einst katholische Franziskaner nach Bosnien kamen, ließen sie sich zunächst hier nieder und gaben ihrer Provinz den Namen Bosna Srebrena, Bosna Argentina, Silbernes Bosnien.
Und auch in jüngster Vergangenheit hat dieses Kaff dem ganzen Land seinen Stempel aufgedrückt, es ist weltweit zum Synonym geworden für Verbrechen, Tod, für Bosnien. Nur wenige Tage im Jahr allerdings widmet sich die Weltöffentlichkeit diesem Teil Europas. Dann, wenn sich das Massaker wieder jährt, wenn wieder einmal Beisetzungen sterblicher Überreste stattfinden, gehen die jährlich immergleichen Bilder um die Welt - Frauen mit weißen Kopftüchern, die Särge mit grünen Spanntücher umarmen, die sich winden vor Kummer, für die der Tod nochmal physisch wird, die alles nochmal durchleben. Hatidz˘as hatte einst ebenfalls vor den Sarkophagen ihrer Familie gekniet, das war im Jahr 2010. Heute sagt sie, an diesem Tag wäre sie am liebsten gestorben, aber man gab ihr Beruhigungsmittel, sie benebelten ihr Leiden.
Nichts ist, wie es war
Über Hatidz˘as Augen hat sich ein milchiges Netz gelegt, es lässt sich kaum erraten, ob ihre Augen braun oder grün sind. Sie hockt auf ihrem Stockerl vor dem Couchtisch, ihr locker geknotetes Kopftuch löst sich immer wieder. Wenn sie weint, dann scheint es ihr gut zu tun, als sei sie in diesen Momenten erleichtert, überhaupt noch irgendetwas empfinden zu können. Immer wieder sucht sie diese Momente des Schmerzes, wie ein Pyromane, den es zum Feuer drängt, hastet sie zu den Geschichten über ihre Qualen und jenen Worten, die sie als einziges überhaupt noch berühren können. "Der Regen ist nicht so schön, wie er einst war. Der Schnee ist nicht mehr Schnee, Tage und Nächte sind für mich gleich, denn ich bin nicht mehr glückliche Mutter, nicht mehr glückliche Ehefrau“, sagt sie. "Ich werde die Hochzeit meiner Kinder niemals erleben, keine Feiern, diese Freuden werde ich nicht mehr spüren, ich werde keine Schwiegertöchter haben, keine Enkelkinder. Mein Haus wird nie wieder von Freude erfüllt sein.“
Es ist ein kaltes Haus, in dem Hatidz˘a lebt, nur in der Wohnküche, wo Holz im Ofen brennt, ist es warm, dort lässt es sich sitzen und Kaffee trinken. Der Rest des Hauses ist Rohbau, das Haus wurde während des Krieges zerstört. Mit bescheidenen Hilfsgeldern internationaler NGOs konnte sie sich ein bisschen was zusammenschustern: ein, zwei Zimmer, Bad, WC, ein paar Steckdosen - bosnischer Standard seit Kriegsende 1995.
Vor dem Krieg war Hatidz˘a Näherin, heute wirkt sie müde, das Leben hat die fromme Muslima unfreiwillig zu einer Kämpferin gemacht. Als ihre beiden Söhne ums Leben kamen, waren sie gerade einmal 21 und 18 Jahre alt, "zwei Buben, die sich nichts zuschulden haben kommen lassen“, sagt sie. "Ich habe ein ruhiges Gewissen, denn ich weiß, sie waren unschuldig“, sagt sie, "ich kann ihren Mördern in die Augen sehen.“
Im Hotel "Misirlije“, dem einzigen des Ortes, lungern einige Journalisten und Touristen herum, Deutsche und Holländer. Sie sitzen breitbeinig auf ihren Sesseln und skypen unüberhörbar für alle, sie wirken beseelt von dem, was sie insgeheim für Mut halten. Dass sie es wagen, hierher zu kommen, an den Ort des Grauens, der banaler ist, als sie es jenen gegenüber, zuhause, am anderen Ende der Internetleitung, zugeben möchten. Hier in Srebrenica fühlt man sich schnell als Voyeur, egal welche Absichten man hat.
Doch das Leid hier ist kein Spektakel, dass einen anzieht, es ist eher ein dumpfer Strom, von dem man sich am liebsten abwenden möchte. Und das beschämt, weil man in Wahrheit zu schwach dafür ist, zu faul für die Realität, weil das eigentliche Leid nicht endet, weil es die eigene Vorstellungskraft übersteigt und weil es keine Wendung in dieser Geschichte gibt. Das Leid hier ist monoton und alltäglich.
Die Tage vergehen hier, es wird niemand mehr umgebracht. Doch alles, was darüber hinausgeht, ist fast unmöglich. Verschlossenheit, Verbissenheit und eisiger Hass sind hier überall. Die Leute hier leben nicht miteinander, sie leben nebeneinander, wenn nicht gegeneinander. Die Schulen sind nach Volkszugehörigkeit geteilt, es gibt keine gemeinsamen Cafés, die Leute könnten zumindest bei der Arbeit zusammenkommen, aber die gibt es hier fast gar nicht.
Die Situation ist nahezu im gesamten Land ähnlich verheerend wie in Srebrenica. Die Menschen in diesem Land haben gar keine Gelegenheit, die Kriegserlebnisse hinter sich zu lassen, denn die Spuren sind noch immer allgegenwärtig. Vieles ist immer noch nicht aufgebaut, Ruinen klaffen an jeder Ecke, die Menschen haben kein Geld, es gibt keinen wirtschaftlichen Fortschritt, geschweige denn politischen. Und Europa scheint es egal zu sein, dass nur fünf Autostunden von Wien entfernt die Grenzen eines Landes beginnen, das wie ein Wachkoma-Patient vor sich hinvegetiert. Während in Österreich zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg Wirtschaftswunder und Aufbruchseuphorie herrschten, ist Bosnien-Herzegowina in den letzten zwei Dekaden zu einem der ärmsten Länder Europas geworden.
Die Serben, die hier in Srebrenica leben und seit dem Krieg die Mehrheit stellen, sind freundlich zu Fremden. Sie helfen, wo sie können, sie bemühen sich besonders - wohl auch, weil sie das Klischee der Bösen aktiv widerlegen wollen. Viele von ihnen sind selbst nicht von hier, viele hat es aus anderen Teilen des Landes während des Bosnienkrieges hierher verschlagen.
Hinter vorgehaltener Hand sagen manche von ihnen, bei den Gedenkfeierlichkeiten im Sommer würden sich die Muslime wie bei einem Volksfest aufführen. Solche Worte sollen die anderen in ihrem Leid diskreditieren. Und dann gibt es noch manche Muslime, denen das Gefühl der chronischen Benachteiligung in den Knochen sitzt. Man müsse die Geschichte Srebrenicas der Welt erzählen, meint etwa eine junge Frau. Die Welt jedoch, sie kennt die Geschichte dieses Ortes, es scheint aber, als würde sie einfach alles am liebsten vergessen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!