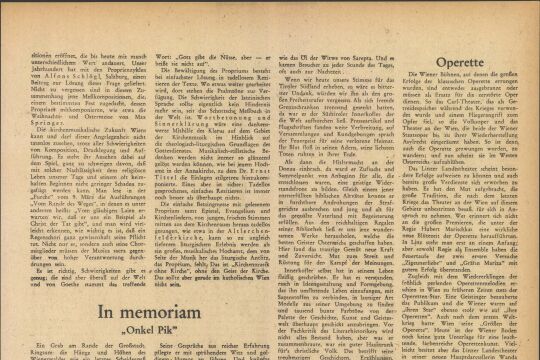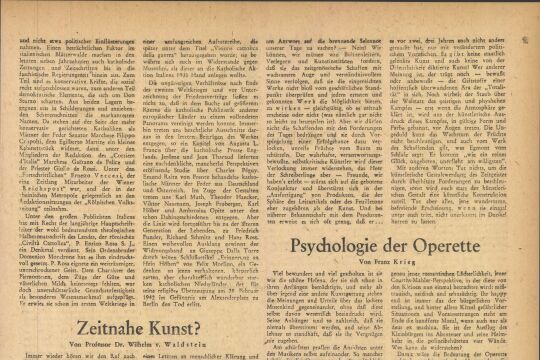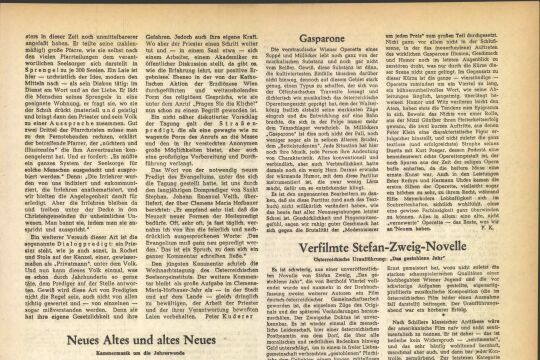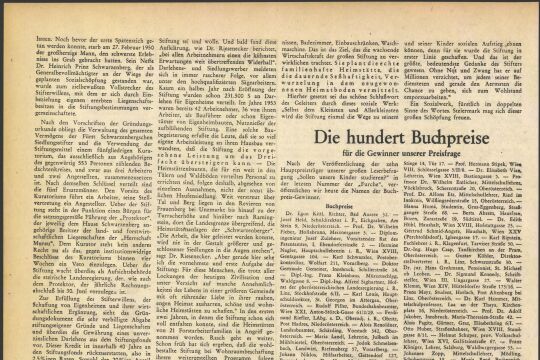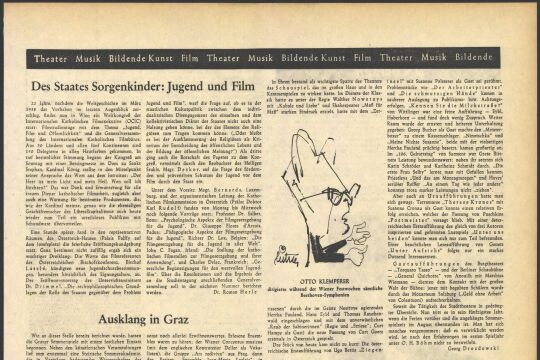Die unerhörte Kunst
Die Operette gilt noch immer als Inbegriff der Verlogenheit und des Kitsches. Doch die verdiente Anerkennung dieses verkannten Genres zeichnet sich ab.
Die Operette gilt noch immer als Inbegriff der Verlogenheit und des Kitsches. Doch die verdiente Anerkennung dieses verkannten Genres zeichnet sich ab.
Das Theater ist eine Baustelle. Mitten im Chaos kramen zwei ältere Herrschaften in Abendkleid und Frack nach Erinnerungen. Ein letztes Mal entfaltet der Herr Kammersänger den Chapeau claque, ein letztes Mal legt die Frau Kammersängerin das gleißende Kollier an. "Lippen schweigen, 's flüstern Geigen" singen sie und "Glücklich ist, wer vergißt", musikalische Pretiosen der unwiederbringlich vergangenen Glanzzeit der Operette. Doch bevor sich für die beiden bernhardesken Figuren der Vorhang endgültig senkt, gewinnen sie unerwartet noch eine Bewunderin: eine junge Frau, die mit Blaumann und Schutzhelm verbissen am Neuaufbau des Theaters arbeitet.
Der Operettenabend "Wenn wir morgen noch daran denken ..." an der Wiener Volksoper ist ein Sinnbild für den gegenwärtigen Zustand der Operette: Ihre goldene Zeit ist vorbei, sie hat mit vielen Unannehmlichkeiten zu kämpfen und doch verdient sie einen gebührenden Platz in einer ungemütlich gewordenen Theaterlandschaft, wo für Gefühl, Sentiment und die leichte Muse immer weniger Platz zu sein scheint. Die Operette war kürzlich auch Thema eines von der Volksoper und der Europäischen Musikakademie veranstalteten Kongresses: "Operette. Die unerhörte Kunst?", lautete die doppelsinnige Frage. Die Antworten: Ja, die Operette wird von vielen nicht ernst genommen; ja, sie ist eine außergewöhnliche, erhaltenswerte Kunstform; aber: sie ist leider auf den Hund gekommen.
An der Operette scheiden sich die Geister. Vor allem Intellektuellen gilt sie als minderwertig, als Inbegriff von Verlogenheit und Kitsch. Für Manfred Wagner, Inhaber der Lehrkanzel für Kultur- und Geistesgeschichte an der Wiener Hochschule für angewandte Kunst, ist Operette keine Kunst, sondern "gefrorene Zeitzeugin": "Ihr Platz ist das Museum". Für den Präsidenten der internationalen Schönberg-Gesellschaft ist es folglich auch "eine Schande", daß Franz Lehars "Lustige Witwe" an der Wiener Staatsoper gespielt wird. Mit seiner Einschätzung kann er sich immerhin auf Karl Kraus oder Theodor W. Adorno berufen. Auch die Ö1-Hörer sind geteilter Meinung: Panisch stürzen viele Hörer zum Radio, wenn am Donnerstag um 13 Uhr die Kennmelodie des Ö1-"Operettenkonzerts" ertönt, wie ORF-Kulturchefin Heide Tenner weiß: "Sie wollen alles hören, nur nicht Operette."
Doch die Sendung hat auch ihre treuen Fans, wie ORF-Untersuchungen belegen. Die Operette ist in Österreich alles andere als tot, im Gegensatz etwa zu Deutschland, wo sie nur mehr ein kümmerliches Schattendasein fristet. Zu den Seefestspielen Mörbisch pilgerten dieses Jahr 160.000 Operetten-Freaks, um sich "Wiener Blut" von Johann Strauß zu gönnen, für den "Zigeunerbaron" im nächsten Sommer sind bereits jetzt 90.000 Karten vorbestellt. Auch viele österreichische Sänger treten mit größtem Vergnügen in Operetten auf. Während Kammersänger Kurt Schreibmayer auf der Musikhochschule noch belächelt wurde, weil er als einziger gerne Operette sang, bekennen heute junge Sänger wie Regina Schörg ohne Scham: "Ich liebe die Operette".
"Die Operette ist ein Brillant!", ruft Harald Serafin aus, der umtriebige Intendant von Mörbisch, in dem das Genre seinen eloquentesten, glühendsten Fürsprecher gefunden hat. "Aber vielleicht muß man ein bisserl primitiv sein, um sie zu lieben", fügt er sogleich schmunzelnd mit opperettenhafter Selbstironie hinzu. Man muß nicht, auch nicht ein bisserl. Volker Klotz ist als Professor für Literaturwissenschaft an der Universität Stuttgart und Autor zahlreicher Fachbücher über Dramatik frei vom Verdacht der Einfältigkeit - und vernarrt in die Operette. "Die Operette ist besser als ihr Ruf: eine eigenwertige, eine fortschrittliche, eine vitale und vitalisierende Kunst."
"Die guten Operetten sind eigenständige, musikdramatisch und szenisch aufsässige Bühnenstücke, die wider erstarrte und verhockte Lebenshaltungen anrennen", formuliert Klotz in seinem Standardwerk "Operette". Bedrückende Machtverhältnisse des Alltagslebens werden in ihr ironisch verkehrt, umgestülpt und damit entkräftet. Das schmerzzerwühlte Innenleben tragisch scheiternder Individuen wird in guten Operetten voller Selbstironie übersungen und übertanzt. "Die schlechten sind solche, die, bei aller handwerklichen Gediegenheit, sich und ihr Publikum abfinden mit einer gemütlichen Befriedigung des immer schon zubemessenen, dankbar hingenommenen Kleinglücks", erläutert Klotz seine Qualitätskriterien.
Gute Operette ist auch politisch: Der heutzutage verkannte österreichische Komponist Oscar Straus zum Beispiel, der in den dreißiger Jahren emigrieren mußte, schrieb für ein intellektuelles, politisch aufgeschlossenes Publikum. Sein Operettenerstling "Die Lustigen Nibelungen" ist ein satirischer Angriff auf die damals grassierende Deutschtümelei, indem sie sich über die in völkischen Kreisen verehrten Nibelungen lustig macht. Bei der Grazer Erstaufführung 1908 randalierten schlagende Burschenschaften, im Opernhaus fielen sogar Schüsse. Den großen Erfolg der "Lustigen Witwe" führt der Grazer Kulturhistoriker Moritz Csaky darauf zurück, daß darin auch Inhalte der Moderne vermittelt würden: so verkörpert das erste Paar Danilo-Hanna moderne Ungebundenheit und Anti-Bürgerlichkeit.
Die Meisterwerke des unterhaltenden stehen den Meisterwerken des ernsten Musiktheaters musikalisch in nichts nach. Allerdings hapert's an der Umsetzung, wie niemand geringerer als Marcel Prawy bestätigt: "Ich genieße Oper heute noch ebenso wie in meiner Jugend - nicht aber die Operette." Der legendäre Musikenthusiast vermißt, was die Musik angeht, Pfiff und Originalität.
Das liegt zum einen daran, daß es heutzutage keine Operettenstars mehr gibt. Auch wenn viele Sänger gerne Operette singen, will aus Imagegründen niemand über das verpönte Genre definiert werden; Hauptbetätigungsfeld bleibt die Oper. Opernsänger jedoch gehen anders an ihre Partien heran, das Verhältnis zwischen geschriebener und gesungener Note ist in Oper und Operette ein anderes: Die Operettensänger von anno dazumal klebten nicht an den Noten, sie nuancierten und phrasierten ganz anders. Und sie improvisierten: eine Kunst die Opernsänger zuletzt zu Zeiten des Belcanto beherrschten - doch das war vor mehr als 150 Jahren.
Zum anderen sind die Dirigenten Schuld an der musikalischen Misere, denn auch im Taktstockschwingermilieu gilt die Operette als minderwertig. Kaum einer hat sich mit dem Genre auseinandergesetzt. Und wird er einmal in die ihm lästige Pflicht genommen, so produziert er einen lieblosen Operetten-Einheitssound, in dem die individuellen Charakteristika eines Werkes niedergebügelt werden. Daß es auch anders geht, bewiesen zuletzt Nikolaus Harnoncourt mit seiner mozartesken "Fledermaus" bei den Wiener Festwochen und John Eliot Gardiner mit seiner tiefgründigen "Lustigen Witwe" an der Staatsoper.
"Die mangelhafte literarische Qualität der Libretti ist schuld an der Geringschätzung der Operette", meint Ernst Märzendorfer, einer der letzten lebenden veritablen Operettendirigenten. Die Dünkel deutschsprachiger Intellektueller gegenüber dem unterhaltenden Musiktheater, ja der Unterhaltung schlechthin, herrschten offenbar schon vor einem Jahrhundert; außer Arthur Schnitzler hat kein namhafter Schriftsteller je ein Operettenlibretto geschrieben ("Der tapfere Kassian", vertont von Oscar Straus). "Eine eins-zu-eins-Übertragung ist nicht möglich", gibt sogar Robert Herzl zu, der als besonders traditionsbewußter Operettenregisseur gilt. Dümmliche Dialoge und Humor, der sein Ablaufdatum um ein vielfaches überschritten hat, müssen überarbeitet und der Gegenwart angepaßt werden, wobei es sich durchaus lohnt, auf das Original zurückzugreifen: "In den Archiven der ehemaligen Zensurbehörden findet man die Libretti, wie sie vor den Strichen ausgesehen haben", weiß Herzl.
Eng damit verbunden ist die szenische Umsetzung - ein besonders heikler Punkt. "Jede Veränderung ruft einen Schock im Publikum hervor", erzählt Dominique Mentha, Direktor der Wiener Volksoper, "einen Schock, wie es ihn im Theater oder in der Oper schon lange nicht mehr erlebt". Gerade in Österreich sind Publikum und die allermeisten Musikkritiker - und deren Wort hat Gewicht - nicht bereit, auch nur einen Millimeter von dem abzuweichen, was sie für die richtige Darstellungsform von Operette halten. Beispiel Volksoper: Ein auf Bill Clinton und sein Balzverhalten gemünztes Couplet ("Der Zigeunerbaron") oder "Die Fledermaus" in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts - und die vermeintlichen Freunde der Operette sind aus dem Häuschen.
"List und Respektlosigkeit sind in das Genre eingeschrieben, doch das Publikum will keine List und keine Respektlosigkeit", analysiert der Kulturwissenschaftler und Journalist Wolfgang Kos. "Zu Jacques Offenbachs Zeiten einen Kaiser zu karikieren war selbstverständlich. Wenn man heute einen Kaiser auf der Bühne karikiert, sind die Leute persönlich beleidigt", wundert sich Kammersänger Kurt Schreibmayer.
Biedere und phantasielose Operetteninszenierungen sind auch Volker Klotz ein Dorn im Auge: "Den ironischen und selbstironischen Spieltrieb, die satirische Angriffslust, die anarchische Ordnungswidrigkeit haben sie zurückgenommen in maßvolle Gefälligkeit", attestiert der Operettenexperte vielen "konventionell-einschläfernden" Inszenierungen. Dabei plädiert Klotz keineswegs für radikale Regie-Kraftakte "Um der Operette gerecht zu werden, ist es unerläßlich, zunächst einmal so vorzugehen wie bei anderen Künsten. Man muß den Originalzustand aufsuchen", sagt Klotz. Ein in bezug auf die Operette riskante Forderung, denn viele scheinen sich nicht bewußt zu sein, wieviel Sozialkritik und welche "rebellischen Schwungkräfte" (Klotz) in so mancher Operette stecken. "Wenn die Leute die Operette verstünden, würden sie sie nicht lieben", merkt Volksoperndirektor Mentha an.
Auf daß die Operette zu neuer Blüte gelange, empfiehlt Volker Klotz auch, das Repertoire zu erweitern. Im Großen und Ganzen wird seit Jahrzehnten nur noch rund ein Dutzend Stücke immer und immer wieder gespielt, während wahre Schätze auf Eis liegen. Dabei handelt es sich nicht nur um Raritäten, die sich nie behaupten konnten, sondern durchaus um Operetten, die vor dem zweiten Weltkrieg wahre Dauerbrenner waren. Doch "Die Dollarprinzessin" von Leo Fall oder "Die blaue Mazur" von Lehar etwa sind aus unerfindlichen Gründen auf der Strecke geblieben.
Auch ein Blick über die Grenzen Österreichs täte gut: Die operettenartigen komischen Opern von Arthur Sullivan (Großbritannien) oder die spanische Form der Operette, die Zarzuela, erfreuen sich in ihren Heimatländern größter Beliebtheit, werden hierzulande aber so gut wie gar nicht gespielt.
Zumindest hier möchte die Wiener Volksoper, deren neuer Direktor Mentha die Pflege der Operette zum obersten Anliegen erklärt hat, Abhilfe schaffen. Im Jahr 2002, dem Jahr der Einführung des Euro, sollen fünf Operetten aus fünf unterschiedlichen europäischen Ländern gespielt werden. In jenem Kalenderjahr, freut sich Mentha, wird an der Volksoper jede Premiere eine Operettenpremiere sein. Das ist mal bei ihm so Sitte.