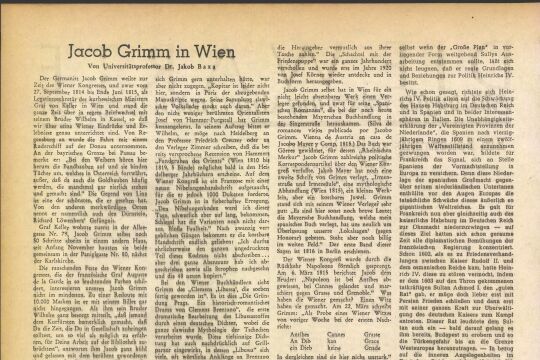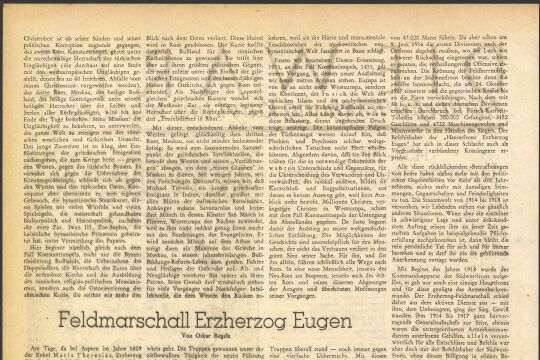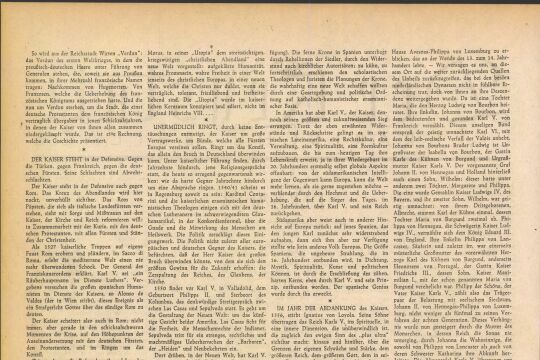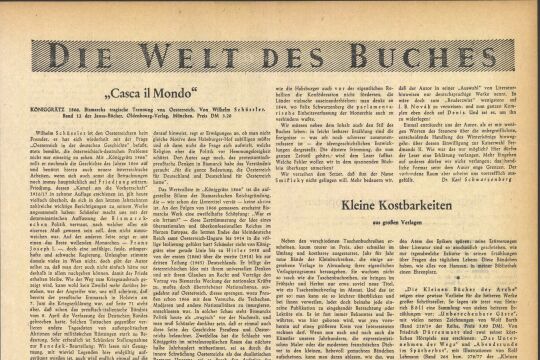"Für den Politologen Herfried Münkler ist der Dreißigjährige Krieg ein Modellfall, aus dessen Studium man Erkenntnisse für die Gegenwart ableiten könne."
Bevor sie sich mit billigen Möbeln und schweren Autos einen Namen machten, standen die Schweden hierzulande in einem schlechten Ruf. Vor allem im niederösterreichischen Wald-und Weinviertel erinnert so manche Burgruine, Dürnstein oder Staatz zum Beispiel, an den Einfall schwedischer Truppen unter General Lennart Torstensson im Jahr 1645. Vielerorts, wie in Zwettl, findet man noch "Schwedenkreuze" mit Inschriften wie dieser aus dem Jahr 1651: "LOB PREIS UND DANCK DEN FRIDENS GOT DER UNS HAD GE-FIRT AUS CRIEGES NOD".
Mit Torstenssons brandschatzender Armee kehrte ein Krieg an seinen Ursprung zurück, der im Frühjahr 1618 mit einem Konflikt zwischen dem Haus Habsburg und den böhmischen Ständen ausgebrochen war. Er verheerte in drei Jahrzehnten weite Teile des Heiligen Römischen Reiches so gründlich, dass "Dreißigjähriger Krieg" noch heute ein Topos für die Schrecken des Krieges schlechthin ist. Ein Gemeinplatz, mit dem sich keine persönlichen Erinnerungen und - unbeschadet aller literarischen Vergegenwärtigungen - kaum mehr konkrete Inhalte verbinden. Der Dreißigjährige Krieg ist in die tieferen Schichten des kollektiven Gedächtnisses abgesunken. Er wird von den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts überlagert, deren Gewaltexzesse alles Vorangegangene relativieren. Und er liegt in einer Zeitschicht, die wir aufgeklärten Europäer für unseren Teil überwunden wähnten: einer Zeit, da sich Menschen um ihrer religiösen Überzeugungen willen totschlugen.
Dass diese Zeiten lange überwunden schienen, war auch eine Folge des Dreißigjährigen Krieges selbst. Nach jahrzehntelangem Morden und Brennen setzte sich unter den europäischen Fürsten die Einsicht durch, dass es sich nicht lohne, um Glaubensartikel Krieg zu führen, sondern nur noch aus Gründen der Staatsräson. Diese Einsicht prägte seit dem Westfälischen Frieden von 1648 das Völkerrecht und führte nach landläufiger Meinung zu einer "Einhegung" des Krieges -bis politische Ersatzreligionen aufkamen, die den Krieg wieder heiligten und seine staatlich-rationale Kontrolle endgültig zur frommen Illusion werden ließen, beginnend mit dem Nationalismus des 19. bis zum Islamismus des 21. Jahrhunderts.
EIN MODELLFALL
Heute wüten in manchen Regionen der Erde Kriege, die dem Dreißigjährigen in vieler Hinsicht vergleichbar sind, etwa was ihre lange Dauer, die Bedeutung religiöser Motive oder das Leid der Zivilbevölkerung angeht. Für den Berliner Politologen Herfried Münkler ist der Dreißigjährige Krieg daher ein Modellfall, aus dessen Studium man Erkenntnisse für die Gegenwart ableiten könne. In seinem neuesten Buch pflegt Münkler einen betont nüchternen Blick auf diesen Fall. Dahinter ist die Hoffnung erkennbar, dass kühle, interessengeleitete Machtpolitik zwar nicht den Krieg aus der Welt schaffen, mit etwas Glück aber dessen Ausartung zum grenzenlosen Gemetzel vermeiden kann. Mit anderen Worten, dass dem Krieg durch zweckrationales Kalkül -unter Hintanstellung von Werten, Moral und Religion -am ehesten beizukommen wäre. Das sei im Dreißigjährigen Krieg nicht gelungen. Und genau das, will uns der Politologe wohl sagen, wäre auch heute dringend nötig.
Man muss den Dreißigjährigen Krieg nicht zum Modell erheben, um ihm auch vierhundert Jahre nach seinem Beginn noch Erkenntnisse abzugewinnen. Wenn Münkler etwa die Rolle der Religion für Ausbruch und Dynamik des Krieges relativiert, sagt er damit nichts Neues. Die historische Wissenschaft ist sich schon lange darin einig, dass nicht allein religiöser Wahn, geboren aus dem Geist der Reformation, den europäischen Flächenbrand des 17. Jahrhunderts ausgelöst hat. Das lässt sich schon an jenem Ereignis zeigen, das bis heute als jener Funken gilt, der das Pulverfass zur Explosion brachte: der Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618. An jenem Tag stürmten böhmische Ständevertreter auf den Hradschin und warfen die königlichen Statthalter Jaroslav z Martinic und Vilem Slavata sowie den Kanzleisekretär Filip Fabricius aus einem Fenster der Burg. Alle drei überlebten -angeblich von der Heiligen Jungfrau auf wundersame Weise gerettet -diesen Akt inszenierter Selbstjustiz, aber das Fanal war gesetzt.
Während die Habsburger ein Heer entsandten, das die Rebellen zur Räson bringen sollte, riefen diese die Union der protestantischen Reichsstände zu Hilfe und wählten deren Wortführer, den Pfalzgrafen Friedrich, zum neuen König. Kaiser Ferdinand II. wiederum versicherte sich der Unterstützung seiner Verwandten in Spanien und des bayerischen Herzogs Maximilian, der die katholische Partei im Reich, die Liga, anführte. Der "böhmisch-pfälzische Krieg" endete 1623 mit einem eindeutigen Sieg des Kaisers und der Liga. Doch mit dem Sieg sollte der Krieg erst richtig in Gang kommen.
Unmittelbarer Anlass für den Unmut der böhmischen Stände war die habsburgische Kirchenpolitik gewesen. Die zielte in jenen Jahren darauf ab, verbriefte Rechte wieder einzukassieren, die Ferdinands Vorgänger Matthias den mehrheitlich protestantischen Ständen in Böhmen und Ungarn zugestanden hatte, als er deren Beistand im Streit mit seinem Bruder Rudolf brauchte. So verzahnten sich konfessionelle Gegensätze mit dynastischen Zwistigkeiten und den politischen Ambitionen der böhmischen Stände. Weil der eine böhmische König zugleich Kaiser des Reiches war, aber auch durch die Bündnisse mit den Protestanten und der Liga, weitete sich der böhmisch-habsburgische Konflikt auf weite Teile des Reiches aus, das damals von einer Verfassungskrise gelähmt war. Wichtige Institutionen der Konfliktbeilegung wie das Reichskammergericht funktionierten nicht mehr. Der Kompromiss, zu dem sich protestantische und altgläubige Reichsstände im Augsburger Religionsfrieden von 1555 durchgerungen hatten, zeigte immer größere Risse.
MACHTPOLITISCHER GEGENSATZ
Auf einer dritten Ebene nutzten mehrere äußere Mächte die Krise des Reiches, um im eigenen Interesse zu intervenieren. Dazu zählten neben Spanien vor allem Schweden und Frankreich, die Generalstaaten der Niederlande und der Fürst von Siebenbürgen. Auch auf dieser Ebene spielten konfessionelle Gegensätze eine Rolle, aber nicht die entscheidende. Verbündete sich doch das katholische Frankreich mit dem lutheranischen Schweden gegen das übermächtig erscheinende Haus Habsburg. In der zweiten Hälfte des Krieges ging es vor allem um diesen machtpolitischen Gegensatz. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr wurde er zum Selbstläufer, der sich aus sich selbst ernährte - und aus dem Land, solange bis er es aufs Mark ausgesaugt hatte.
Am Ende waren geschätzte sechs Millionen Menschen tot, ein Drittel der Reichsbevölkerung, viele durch kriegerische Gewalt oder durch die Hände marodierender Soldaten. Die meisten wurden jedoch von den apokalyptischen Begleitern des Krieges dahingerafft, von Hunger und Seuchen, manche auch von der Kälte, denn im 17. Jahrhundert kühlte sich das Klima ab. Schon 1637 dichtete Andreas Gryphius: "Wir sind doch nunmehr gantz /ja mehr alß gantz vertorben." Da war noch lange kein Frieden in Sicht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!