Ungeachtet des freundlichen Schlussapplauses erwies sich Iain Bells "A Harlot’s Progress“ im Theater an der Wien nur als halbe Sache.
Nicht immer entscheidet die Aufnahme einer Uraufführung über die weitere Resonanz eines Stücks. Bei Iain Bells "A Harlot’s Progress“, das im Theater an der Wien Weltpremiere hatte, will man an einen anhaltenden Erfolg nicht recht glauben. Zu schwach die Dramaturgie, zu langsam erhält die musikalische Realisierung Kontur. Jedenfalls bräuchte es einen ideenreicheren Regisseur als den Theater-an-der-Wien-Debütanten Jens-Daniel Herzog, der schon mit seiner Salzburger "Zauberflöte“ im Vorjahr alles andere als überzeugte.
Wüstling vs. Hure
Schließlich erschöpft sich das Sujet nicht allein in Brutalität. Auch wäre es eine lohnende Aufgabe gewesen, die Regiearbeit im Wesentlichen nicht auf die Protagonistin zu konzentrieren, sondern auch den übrigen Darstellern ein klareres Eigenprofil zu geben. Aber gewiss ist es allemal eine Herausforderung, sich einem Thema zu stellen, das bereits in einer anderen, noch dazu meisterhaften Realisierung vorliegt. Denn auch Igor Strawinsky hat sich bei "The Rake’s Progress“ von den gesellschaftskritischen Stichen William Hogarths inspirieren lassen. Ein Grund, warum diese Produktion jüngst im Theater an der Wien wiederaufgenommen wurde.
Sowohl Bell als auch seinem Librettisten, dem nicht nur wegen seines London-Buchs "Die Biografie“ als Literaten hochgeschätzten Peter Ackroyd, fehlt es offensichtlich an der nötigen Distanz, die man bei der Bearbeitung jedes Stoffs benötigt. So geht das hier dargestellte Schicksal eines Mädchens, das bei seiner Ankunft sogleich in den Sumpf der Londoner Unterwelt gezogen wird, als Hure ihr Leben fristen muss und an den Folgen von Syphilis im Wahnsinn endet, meist begafft von der sie in das Unheil treibenden Umwelt, die sich keiner Schuld, nicht einmal einer Mitschuld bewusst ist, kaum je unter die Haut. Zudem merkt man bei der Wahnsinnsszene, dass es sich nicht um einen originellen Einfall handelt, sondern um die Übernahme anderer, weitaus größerer Beispiele der Operngeschichte, wie man dann auch im Programmheft bestätigt findet.
Schließlich ist Diana Damrau - für sie ist dieses sechsteilige, knapp zweieinhalbstündige Musiktheater maßgeschneidert - zum Zeitpunkt seiner Entstehung als Lucia in Donizettis Oper aufgetreten. Aber Welterfolge lassen sich eben nicht so ohne weiteres fortschreiben. Wobei sich die Frage stellt, wie das Resultat des Premierenabends gewesen wäre, hätte sich hier nicht die Damrau mit ihrer schauspielerischen Kompetenz und Koloraturenvirtuosität, die ihre Partie verlangen, eingebracht. Exzellente Leistungen erbringen auch Marie McLaughlin als Mother Needham und Tara Erraught als deren Dienerin Kitty.
Eindimensional brutale Männer
Wie man überhaupt den Eindruck nicht los wird, dass sich Regisseur Herzog mehr für die weiblichen Darsteller interessiert als für die Männer, die sich bloß in eindimensionaler Brutalität üben dürfen. Auch vokal spielen Nathan Gunn als Molls Zuhälter James Dalton und noch mehr Christopher Gillett, dem man das vom Textbuch gewünschte Greisenhafte nicht abnimmt, nur die zweite Rolle.
Und die Musik? Ein zögerlich eingeblendetes, wenngleich immer wieder präsentes Leitmotiv sowie melodische Floskeln, die den Kontrast von Hell und Dunkel stets vor Augen haben, sind, auch wenn sich das Geschehen nach der Pause verdichtet, die Musik innigere Töne anschlägt, zu wenig für ein sich noch dazu Oper nennendes Opus. Da nützen auch das hochkarätige Engagement der unter der kundigen Leitung des früheren GMD der Finnischen Nationaloper Mikko Franck stehenden Wiener Symphoniker und die gewohnt souveräne Leistung des Arnold-Schoenberg-Chors nur wenig.
A Harlot’s Progress
Theater an der Wien
18., 21., 24., 27. Oktober
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!







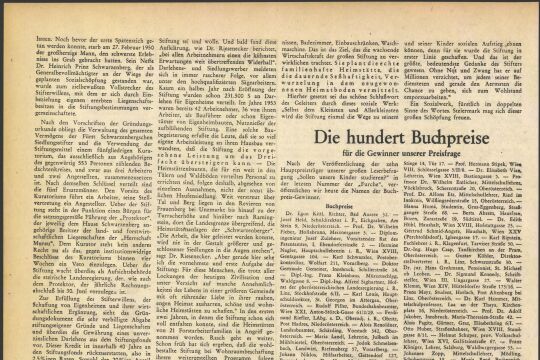











































































%20OFS_Monika%20Rittershaus%20(16).jpg)


_RET.jpg)








_edit.jpg)



