Die NZZ über die trotz aller Mängel positiven Konsequenzen der Wahl in Afghanistan: Ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratisierung.
Dass in Afghanistan Wahlen stattfinden konnten trotz einer von Bombenterror begleiteten Einschüchterungskampagne der Taliban, ist zunächst ein Erfolg. In vielen Teilen des Landes sind die staatlichen Strukturen stark genug, um einen halbwegs gesicherten organisatorischen Ablauf sicherzustellen. Dennoch sollte man nichts beschönigen: Es haben zwar Wahlen stattgefunden, aber Ausdruck von Demokratie im westlichen Sinn sind diese nur eingeschränkt. Wahlmanipulationen, der Bürgerkrieg im Süden und die Traditionen einer Stammesgesellschaft verhinderten, dass sich der Wählerwille frei entfalten konnte.
Der Nutzen und der Sinn dieses Urnengangs liegen daher zunächst nicht darin, den besten Mann für das Präsidentenamt zu küren. Die Wahl ist auf eine andere Art eine Demonstration und eine politische Willensbekundung. Sie soll zeigen, dass das ehrgeizige, 2001 begonnene Experiment nicht fehlgeschlagen ist, einem archaischen, von jahrzehntelangen Kämpfen verwüsteten Land ein Mindestmaß an Stabilität und Sicherheit zu geben.
Wahl gegen die Gewalt
Die Afghanen, die einen Wahlzettel in die Urnen warfen, dürften sich über die Schwächen der Kandidaten und die Mängel des Prozederes keine Illusionen gemacht haben. Doch sie gaben ihre Stimme auch deswegen ab, weil sie offenkundig nicht wollen, dass ihr Land wie in den neunziger Jahren zur Beute eines Haufens mordlustiger Kriegsherren oder einer Bewegung von intoleranten Puritanern wird. Unter den vorherrschenden Bedingungen ist der Gang ins Wahllokal zunächst ein Votum für Normalität und Ausdruck des Wunsches, die Zukunft des eigenen Landes wenigstens ein bisschen mitzubestimmen.
Adressaten des Wahlentscheids sind deshalb nicht nur Hamid Karzai, Abdullah Abdullah und die anderen Kandidaten, sondern die «Petersberg-Gemeinschaft». Respektiert sie das Votum der afghanischen Bevölkerung? Der Einsatz der Nato am Hindukusch ist kein Krieg, bei dem das Überleben der kriegführenden Staaten auf dem Spiel steht. Die USA und ihre Verbündeten hätten sich 2001 entscheiden können, nicht zu intervenieren – aber sie haben es getan, und sie übernahmen damit Verantwortung.
Der Westen kann Zeit kaufen
Natürlich könnten die westlichen Streitkräfte abziehen, die Afghanen ihrem Schicksal überlassen und den Preis der Niederlage zahlen. Der Wahlgang zeigt trotz seinen Unzulänglichkeiten aber auch, dass die Nato für einen Rückzug eine Ausrede nicht hätte: dass die Stabilisierung des Landes endgültig gescheitert und die Präsenz ausländischer Truppen gänzlich unerwünscht ist. Mitte der neunziger Jahre wäre jemand, der für das folgende Jahrzehnt Präsidentenwahlen prophezeit hätte, als Phantast verlacht worden. Nun hat dieses unwahrscheinliche Ereignis dank westlicher Schützenhilfe bereits zwei Mal stattgefunden. Mit dem Blut eigener Soldaten, viel Geld und grossen politischen Anstrengungen hat es die Nato geschafft, die Lage gegenüber früher zu verbessern, als das von Krieg, Flüchtlingselend und Armut gezeichnete Afghanistan ein hoffnungsloser Fall zu sein schien … Sie kann mit ihren Truppen dem Land Zeit kaufen für den Aufbau von Armee, Polizei und einem funktionierenden Schulwesen. Sicherheit und Bildung sind auch zwei Voraussetzungen dafür, dass sich aus den undurchsichtigen Herrschaftsbeziehungen einmal demokratische Strukturen entwickeln. Ob dieses Experiment gelingt, ist weiterhin offen. Aber es war richtig, dass man Sicherheit und Demokratisierung miteinander verknüpfte.
* „Neue Zürcher Zeitung“, 25. August 2009
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!



































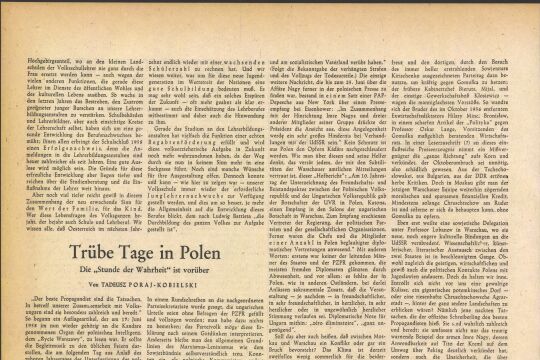












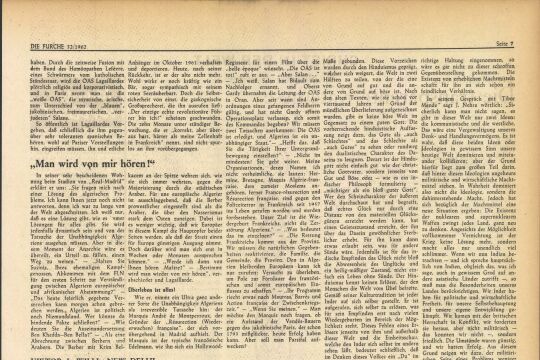












































.png)


