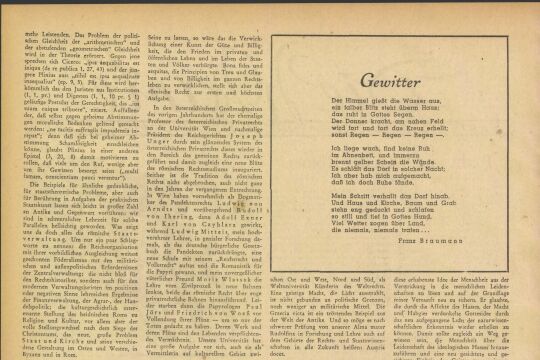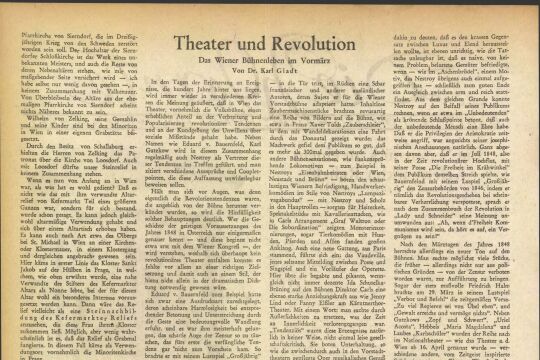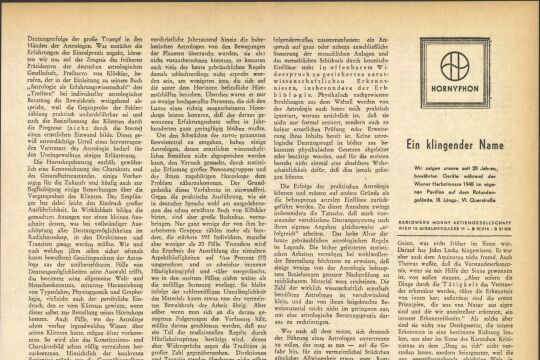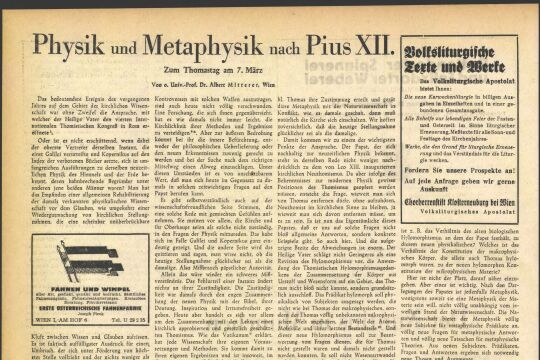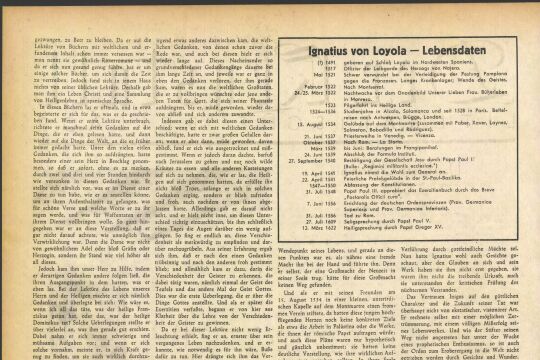Naturwissenschaft hat uns ungeahnte Möglichkeiten der Erkenntnis gegeben. Sie sollte aber nicht missbraucht werden, den Geist aus der Welt zu vertreiben.
Wenn wir heute von Naturwissenschaft sprechen, meinen wir jene Entwicklung, die im 17. Jahrhundert begonnen hat und in den wesentlichen Punkten auf Galileo Galilei zurückgeht. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist nicht der Kampf Galileos mit der Kirche eigentlicher Vater der Naturwissenschaft. Jener unselige Prozess, den Papst Urban VIII. im Jahr 1633 gegen Galilei verlangt hat, wird in seiner Bedeutung überschätzt und hat unser Geschichts-Bild verzerrt. (Vermutlich wird er unbewusst oft mit dem wahrhaft schändlichen Prozess gegen Giordano Bruno verwechselt, der im Jahre 1600 wegen Ketzerei zur Verbrennung Brunos führte, während Galilei lediglich wegen Ungehorsams zu Hausarrest in seiner Villa in Arcetri bei Florenz verurteilt worden war).
Weltbild im Wanken
Schon als Kardinal Maffeo Barberini war Urban VIII. mit Galilei eng befreundet; er schätzte sowohl die Gelehrsamkeit als auch die Sprachgewalt seines Landsmannes aus der Toskana. Als Barberini 1624 zum Papst gewählt wurde, verfasste Galilei sein großes Werk über die beiden Weltsysteme (Kopernikus und Ptolemäus). 1630 reichte er es bei der Inquisition ein und nach zweijähriger Prüfung und einigen kleineren Korrekturen wurde es mit dem Imprimatur der Inquisition veröffentlicht. Warum Urban VIII. im folgenden Jahr den Prozess gegen Galilei verlangte, wissen wir nicht, denn es gibt mehrere konkurrierende Vermutungen. Allerdings wird meist zu wenig berücksichtigt, dass der Prozess mitten im 30-jährigen Krieg stattfand. Er war also sicherlich nicht das zentrale Problem in den Überlegungen des Papstes.
Im 16. Jahrhundert war das von der Kirche gehütete Aristotelische Weltbild erstmals ins Wanken gekommen. Nach Aristoteles sollte die Physik unterhalb der Sphäre des Mondes von den Erscheinungen oberhalb wesentlich verschieden sein. Oben herrschte Vollkommenheit, ewige Kreisbewegung der Gestirne und Unveränderlichkeit. Nun hatte Tycho de Brahe einen "Neuen Stern" (eine Supernova) gesehen und durch seine genauen Beobachtungen zwei Kometen mit großer Wahrscheinlichkeit jenseits der Sphäre des Mondes positioniert.
Erlaubte "Hypothesen"
Das 16. Jahrhundert war die Zeit der Kalender-Reform, die 1582 von Gregor XIII. durchgesetzt wurde. Zu ihrer Vorbereitung waren umfangreiche astronomisch-mathematische Studien erforderlich, die auf Grund des an Aristoteles orientierten ptolemäischen Weltbildes schwierig waren. Daher wurde das neue Weltbild des Domherrn zu Frauenberg, Nikolaus Kopernikus, von der Kirche begrüßt (das Werk des Kopernikus ist Papst Paul III. gewidmet). Allerdings trennte die Kirche streng zwischen Wahrheit und Hypothese! So schrieb etwa Kardinal Bonifacio Caetani, der Zensor des kopernikanischen Werkes: "Wenn es bei Kopernikus Passagen über die Bewegung der Erde gibt, die keinen hypothetischen Charakter haben, so sind diese als Hypothesen zu formulieren. Dann werden sie weder gegen die Wahrheit noch gegen die Heilige Schrift verstoßen."
Galilei hielt sich streng an diese Unterscheidung. Er schrieb: "Ich bin geneigt zu glauben, die Autorität der Heiligen Schrift habe den Zweck, die Menschen von jenen Wahrheiten zu überzeugen, welche für ihr Seelenheil notwendig sind und die, jede menschliche Urteilskraft völlig übersteigend, durch keine Wissenschaft noch irgendein anderes Mittel als eben durch Offenbarung des Heiligen Geistes sich Glaubwürdigkeit verschaffen können." Aber er hatte eine "Neue Wissenschaft" (unsere Naturwissenschaft) gefunden, mittels derer er unter allen möglichen Hypothesen diejenige aussondern konnte, die seinem "Experiment" nicht widersprach. Darum fügte er an: "Dass aber dieser selbe Gott, der uns mit Sinnen, Verstand und Urteilsvermögen ausgestattet hat, uns deren Anwendung nicht erlauben und uns auf einem anderen Weg jene Kenntnisse beibringen will, die wir doch mittels jener Eigenschaft selbst erlangen können, das bin ich, scheint mir, nicht verpflichtet zu glauben."
Zur Geburt der Naturwissenschaft führte also die Unterscheidung von Wahrheit und Hypothese, die bald zur Trennung wurde. Zusammen mit der Descartes'schen Trennung von Geist und Materie und der Galileischen Erfindung des Experimentes zur Stützung von "guten" und Aussonderung von widerlegten Hypothesen führte sie in den heute so oft beklagten Reduktionismus.
Erst nach seiner Verurteilung schrieb Galilei sein zweites Hauptwerk, das mit den Überlegungen und Experimenten zur Fallbewegung die Mechanik begründet. Isaak Newton vollendete das Werk mit seinem Gravitations-Gesetz. Damit war der Anspruch der modernen Naturwissenschaft formuliert, wonach Naturgesetze zu allen Zeiten und an allen Orten des Universums in gleicher Weise gültig sind. Wir können uns heute schwer vorstellen, welcher Machtrausch von dieser Methode auszugehen schien. Johannes Kepler, der Zeitgenosse Galileis, der die Gesetze der Planetenbewegung gefunden hatte, drückte dies aus: "Ich überlasse mich heiliger Raserei. Ich trotze höhnend den Sterblichen mit dem offenen Bekenntnis: Ich habe die goldenen Gefäße der Ägypter geraubt, um meinem Gott daraus eine heilige Hütte einzurichten, weitab von den Grenzen Ägyptens."
Vergöttlichte Naturgesetze
In der Aufklärung wurden die Naturgesetze schließlich selbst vergöttlicht. Voltaire, dem vom Physiker Maupertuis die Newton'schen Erkenntnisse erklärt worden waren, schrieb ihm am 15. November 1732: "Ihr erster Brief hat mich auf die neue Newton'sche Religion getauft. Ihr zweiter hat mir die Firmung gegeben. Ich bleibe voller Dank für Ihre Sakramente. Verbrennen Sie bitte meine lächerlichen Einwürfe, sie stammen von einem Ungläubigen. Ich werde auf ewig Ihre Briefe bewahren, sie kommen von einem großen Apostel Newtons, des Lichts zur Erleuchtung der Heiden."
Papst Benedikt XIV. erkannte die Gefahr einer endgültigen Spaltung von Glaube und Wissen und wollte die Chance ergreifen, mit Voltaire Frieden zu schließen. Meines Erachtens ist es für die Geschichte ein größeres Unglück als der Prozess Galilei, dass ihm dies von seiner Kurie, vor allem vom Großinquisitor vereitelt wurde.
Wissen und Geist getrennt
So leben wir also in einer gespaltenen Welt, in der die Fragen, die die Menschen eigentlich berühren, in die Privatsphäre abgedrängt wurden. Die Öffentlichkeit ist auf naturwissenschaftliches Denken eingeschränkt und kann dies mit den unbezweifelbaren Erfolgen der Methode rechtfertigen. Dabei wird verdrängt, dass diese Erfolge die Abspaltung aller geistigen Elemente und aller Sinnfragen voraussetzte und sie nie mehr einholen kann. Wer Freiheit im Gehirn sucht wird sie dort nicht finden! (Ich verstehe Freiheit als Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen.) Aus den Ergebnissen der Hirnforschung zu schließen, dass es Freiheit nicht geben kann, ist eine unzulässige Grenzüberschreitung der naturwissenschaftlichen Methode.
Immer mehr Menschen fühlen Unbehagen mit dieser Reduktion auf die Materie. Bei der Suche nach Sinn bleiben aber viele in den Grenzen naturwissenschaftlichen Denkens gefangen; die Kirchen bieten leider wenig Hilfe, allzu oft wird Religion mit kirchlichem Ritus oder gar der Kirchengeschichte gleichgesetzt. So sagte etwa der Physik-Nobelpreisträger Stephen Weinberg in einem Vortrag: "Mit oder ohne Religion können gute Menschen Gutes und böse Menschen Böses tun, aber es bedarf der Religion, damit gute Menschen Böses tun ... Eine der größten Errungenschaften der Naturwissenschaft war, intelligenten Menschen zu ermöglichen, wenn nicht antireligiös, zumindest areligiös zu leben. Wir sollten das erreichte Niveau nicht wieder verlassen."
Auf einer falschen Fährte
Ehrlich zugegebener Atheismus ist zu respektieren. Mich stört viel mehr, dass die Suche nach Sinn durch die Erfolge naturwissenschaftlicher Weltbeschreibung auf die falsche Fährte gelenkt wird! Wer heute Gott sucht, meint ihn in der Natur, in den Naturgesetzen oder gar vor dem Urknall finden zu sollen. Dies ist aber sicher nicht der christliche Gott, den wir im Du, in der Liebe hier und jetzt erfahren können. Im 1. Johannesbrief lesen wir: "Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er vor Augen hat, der kann auch den unsichtbaren Gott nicht lieben." Das Konzil von Toledo formulierte schon 675, "dass nie mehr die Gottheit von der Menschheit oder die Menschheit von der Gottheit getrennt werden kann."
Leider ist die Praxis in vielen Kirchen auch nicht hilfreich. Wenn es in der Predigt heißt, dass Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, dann hat das wenig mit christlichem Dreifaltigkeits-Verständnis zu tun. Ich wünschte mir, dass lieber gesagt wird: "Gott selbst ist in der Person des Sohnes zu uns auf die Erde gekommen." Sonst wird in der Kirche eher Islam gepredigt, heißt es doch im Koran in der 5. Sure: "Christus, der Sohn Marias, ist nichts anderes als ein Gesandter."
Der Kampf des Kirchenvolkes für eine Reform seiner Kirche scheint mir notwendig und ehrenwert. Daneben aber wünschte ich mir, dass unabhängig davon für alle Suchenden Gott in der Person des Heiligen Geistes wieder erkennbar würde. Wenn wir Christen nicht mehr spüren, dass das Leben ein Geschenk ist und dass wir hier und jetzt Gott im Nächsten direkt begegnen können, dann bleibt jede noch so progressive Reform der Institution geistlos und irrelevant. Dann können wir auch keine fruchtbare Auseinandersetzung mit anderen Religionen, insbesondere dem Islam, führen, denn Auseinandersetzung setzt das Erkennen des eigenen Ortes voraus.
Naturwissenschaft hat uns ungeahnte Möglichkeiten der Welt-Erkenntnis gegeben. Sie hat unser Leben in nicht vorhersehbarer Weise erleichtert; sie sollte nicht dazu missbraucht werden, die Frage nach dem Sinn des Ganzen zu vernebeln und den Geist aus der Welt zu verdrängen.
Der Autor ist emeritierter Professor für Theoretische Physik in Wien.
Zwei Neuerscheinungen von Herbert Pietschmann zum gleichen Thema:
Der Mensch, die Wissenschaft und die Sehnsucht. Naturwissenschaftliches Denken und spirituelles Erleben.
Von Herbert Pietschmann, Verlag Herder, Freiburg 2005. 159 Seiten,TB, e 9,20
Vom Spass zur Freude. Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts.
Von Herbert Pietschmann, Ibera Verlag, Wien 2005. 208 Seiten, geb., e 20,60