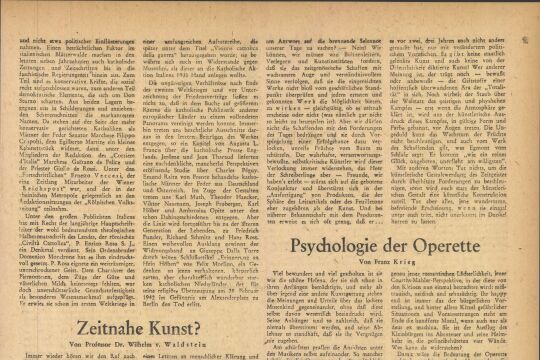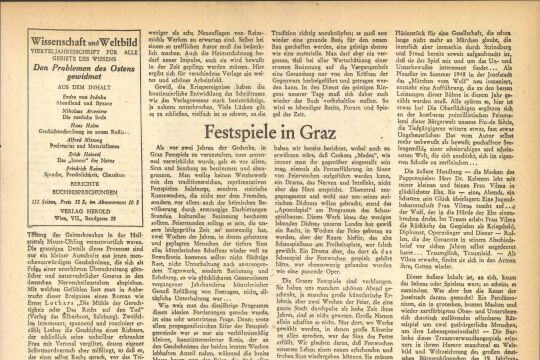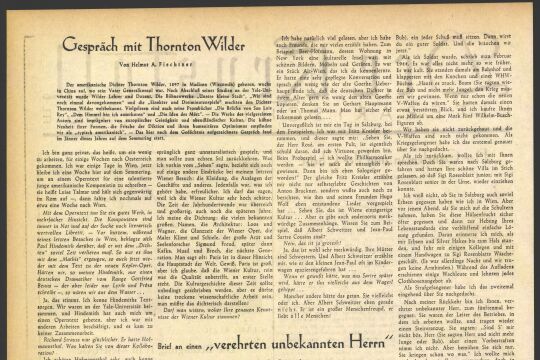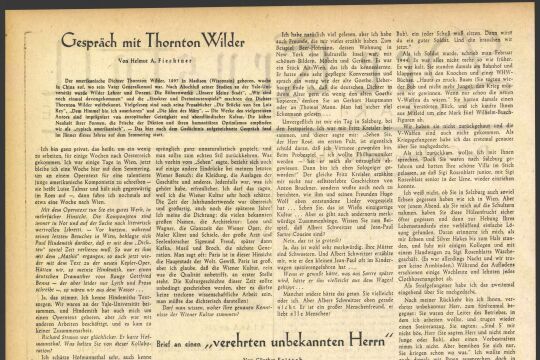"Es gibt keine Tradition ohne die Gegenwart"
Dominique Mentha, Direktor der Volksoper Wien, über den Kampf zwischen Tradition und Moderne, die Pflege der Operette und die Probleme der Musik des 20. Jahrhunderts. Mit "Die Vögel" von Walter Braunfels geht am 8. Oktober die erste große Premiere der ÄraMentha über die Volksopern-Bühne.
Dominique Mentha, Direktor der Volksoper Wien, über den Kampf zwischen Tradition und Moderne, die Pflege der Operette und die Probleme der Musik des 20. Jahrhunderts. Mit "Die Vögel" von Walter Braunfels geht am 8. Oktober die erste große Premiere der ÄraMentha über die Volksopern-Bühne.
dieFurche: "Die Leute, die die Operette lieben, würden sie nicht lieben, wenn sie sie verstünden." Wie genau meinen sie diesen Satz, den sie unlängst geäußert haben?
Dominique Mentha: Die Operette hat die Kraft, die Welt auf den Kopf zu stellen und das steht stark im Gegensatz zu dem zum Teil biederen, bürgerlichen Sehnsuchtstheater, in dem Teile des Publikums die heile Welt suchen. Dabei ist die Operette eine anarchische Kunstform, die vieles verlacht, was zur heilen Welt gehört: Männer, die treu sind und die nicht mindestens zehn Freundinnen haben, sind Idioten. Ein Fischermädchen wird plötzlich Senatorin und flirtet mit dem Herzog. Das ist eine Provokation!
dieFurche: Die Welt auf den Kopf stellen, das Anarchische, Provokation: sind das Dominique Menthas Vorstellungen vom zeitgenössischen Musiktheater?
Mentha: Das hängt immer ganz vom Stück ab; ich habe jetzt gerade über die Operette geredet. Zeitgenössisch heißt, daß uns eine Geschichte, die in alten Zeiten geschrieben, eine Idee, die in alten Zeiten formuliert wurde, in der Gegenwart begegnet. Es gibt kein zeitgenössisches Theater ohne Tradition, aber es gibt auch keine Tradition, die weiterlebt und lebendig ist, ohne Blick auf die Gegenwart. Und ich versuche ja in der Operette die Erneuerung auch aus der Tradition heraus zu machen. Der kleine Operettenabend "Wenn wir morgen noch dran denken..." zum Beispiel war eine Liebeserklärung an das Genre. Der anarchische Teil war an diesem kleinen Abend ausgeschlossen. Leider ist dieser wunderschöne und poetische Abend bei der Kritik nicht angekommen.
dieFurche: Mir hat dieser Abend sehr gut gefallen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum er von den meisten Kollegen so verrissen wurde.
Mentha: Mir ist das auch unerklärlich. Es ist vielleicht typisch für eine Großstadt wie Wien, daß sie das Kleine nicht zuläßt.
dieFurche: In einem "Theaterbrief" an das Volksopernpublikum haben sie geschrieben, die Kunst sei eine Baustelle. Was meinten sie damit?
Mentha: Die Baustelle ist ein Bild dafür, daß man etwas Neues errichtet, das dann auch gelebt werden soll. Wenn wir mit dem traditionellen Kunstwerk nicht mehr lebendig umgehen, das Theater in ein Museum stellen und es genauso spielen würden wie die Alten Griechen ihre Tragödien, dann bestünde die Gefahr, daß daraus eine Ruine wird. Kunst wird immer verändert - manchmal auch zertrümmert, aber dann baut man ein neues Haus auf den Trümmern.
dieFurche: Dem Neuen werden gerade in Wien große Widerstände entgegengebracht. Viele Menschen haben kein Verständnis dafür, daß Stücke durch die Regie stark verändert werden.
Mentha: Was die Menschen Werktreue nennen, hat nichts mit Werktreue zu tun. Sie wollen ein Theater, wie sie es vielleicht in den fünfziger oder in den siebziger Jahren erlebt haben - doch das waren keine historisch genauen Aufführungen, sondern Aufführungen der fünfziger und siebziger Jahre. Die alte griechische Tragödie wird heute sicherlich nirgendwo so gespielt, wie es die alten Griechen damals getan haben. Das ist vollkommen normal. Man kann Emotionen, Texte, Schauspielkunst, Akustik nicht konservieren, das verändert sich. Im Barock zum Beispiel haben sich die Menschen ganz anders bewegt, heute würde man das vollkommen artifiziell empfinden.
Ich bin hundertprozentig sicher, daß ein Mensch von heute ein Bild von Rubens mit anderen Emotionen und anderen Gedanken betrachtet wie ein Zeitgenosse von Rubens. Nur brauchen Bilder zur Interpretation keine Regisseure, keine Schauspieler, sondern sie bleiben einfach hängen. Aber die Kommunikation zwischen dem Betrachter und dem Bild verändert sich vollkommen. Das ist wie bei einem Kind: Irgendwann wird aus jedem Kind eine eigenständige Persönlichkeit, die sich oft von dem unterscheidet, was sich die Eltern vorstellen. Wir wissen, daß das Kind das machen muß.
Natürlich kann es nicht darum gehen, Stücke unbedingt zu zertrümmern, indem man alles gegen den Text oder gegen den Inhalt eines Stückes bürstet. Wenn ein Regisseur zu mir kommt, der sagt, ich mache jetzt dieses Stück und man hat das Gefühl, er hat das Stück gar nicht gelesen, und es interessiert ihn eigentlich überhaupt nicht, sondern er will nur sich und seine Ängste inszenieren, da wird er bei mir aus dem Zimmer geschmissen. Aber wenn sich der Inhalt neu artikuliert, eine neue Bedeutung bekommt, dann ist es gut.
dieFurche: Hängt die Lust, Stücke einschneidend zu verändern nicht auch damit zusammen, daß gerade im Musiktheater immer diesselben 170 "Heiligtümer" - wie Marcel Prawy sagt - gespielt werden?
Mentha: Das Regiehandwerk ist natürlich in einer Zeit, wo man alte Stücke immer wieder spielt, ein immer dominanterer, kreativerer Teil einer Theateraufführung geworden. Daß das Repertoire so rückwärtsgewandt ist, hat aber auch Vorteile: Es gab noch keine Zeit, wo uns so viel zur Verfügung stand.
dieFurche: Ist es nicht auch eine Verarmung, wenn heutzutage fast nur noch mehr oder wenig radikale Inszenierungen in den Opernhäusern zu sehen sind und museale Inszenierungen als Vergleichsmöglichkeit fast völlig wegfallen?
Mentha: Mir haben auch schon andere Leute vorgeschlagen, man müßte gleichzeitig ein ganz konservatives und ein ganz modernes "Wiener Blut" am Spielplan haben. Das halte ich für Spielerei. Ich glaube, zu dem Medium Theater gehört, daß es in dem Augenblick, wo es erzählt wird, entsteht und dann auch wieder entschwindet. Natürlich haben die Menschen Angst davor. Im Zeitalter der Massenmedien und der Globalisierung sehnen sie sich danach, daß es irgendwo auch etwas gibt, das so ist, wie sie glauben, daß es zu sein hat, das sie kennen und wo sie sich wohlfühlen. Ich verstehe das, aber ich glaube nicht, daß die Kunst das ideale Medium ist, um diese Sehnsucht zu erfüllen. Kunst ist immer ein Aufschrei gewesen über etwas, was nicht in Ordnung ist.
Wir nehmen diese alten Stücke, weil die so vielschichtig sind, ihren Wert nie verlieren und uns deswegen auch in der heutigen Zeit helfen - das ist ja eigentlich eine Liebeserklärung an jedes Stück. Ich finde, das Problem liegt nur darin, daß die Menschen das meiner Meinung nach zu moralisch sehen. "Ihr dürft es nicht so machen", "Ihr dürft auf der Bühne nicht so sprechen, wie ihr meint, daß der Faust heute reden würde" - solche Vorwürfe halte ich für absurd. Ist es gut, ist es schlecht, gefällt es mir, gefällt es mir nicht, rufe ich Bravo oder schreie ich Buh - darüber müssen die Leute nachdenken.
dieFurche: Einer ihrer Schwerpunkte im Spielplan der Volksoper wird die Musik des 20. Jahrhunderts. Warum?
Mentha: In diesem Jahrhundert klafft eine große Lücke zwischen dem, was die Menschen akzeptieren, und dem, was an Musik geschrieben wird. Musik von Schönberg oder Strawinsky ist für viele Menschen immer noch schwer zu verkraften, obwohl sie schon fast 100 Jahre alt ist. Eine derartige Schere hat es noch nie gegeben, daher ist es sehr wichtig, daß wir versuchen, die Musik des 20. Jahrhunderts an die Menschen heranzubringen.
Über die Musik des 20. Jahrhunderts herrscht ein falsches Klischee, weil man immer nur von der atonalen Musik spricht. Am 8. Oktober hat an der Volksoper "Die Vögel" von Walter Braunfels Premiere, ein spätromantisches Stück, das die Menschen musikalisch nicht erschrecken wird, wo sie sich vielleicht auch verführen lassen. "Die Vögel" ist ein Beispiel für Musik, die mit der Tradition, auch was Tonalität angeht, verbunden geblieben ist.
dieFurche: Vielleicht akzeptiert das Publikum diese Musik, lieben wird es sie nicht...
Mentha: Da muß ich Ihnen widersprechen. Den Bruch in die abstrakte Malerei haben die Menschen sehr wohl mitgemacht. Ich glaube aber, daß das Konsumieren von Kunst - und ich sage ganz bewußt ,Konsumieren' - immer oberflächlicher wird. Der Konsum eines modernen Stückes Musik ist viel aufwendiger als der eines modernes Bildes. An einem Bild, das einem nicht gefällt, kann man vorbeigehen, ein Musikstück kann man nur erleben, wenn man es sich eine halbe Stunde lang anhört. Meine Erfahrung ist: Wenn man sich mit zeitgenössischer Musik auseinandersetzt, entwickelt man ein Sensorium dafür. Man hört zwar keine Melodie, die man nachpfeifen kann, aber man hört ganz andere Geräusche und Klänge und fängt an, die genauso sinnlich zu finden, wie einen schönen Posaunenakkord von Mozart.
Das Gespräch führte Michael Kraßnitzer Zur Person Dominique Mentha Der frischgebackene Direktor der Wiener Volksoper wurde 1955 in der Schweizer Hauptstadt Bern geboren. In München studierte er Regie (unter anderem bei August Everding), Gesang, und Schauspiel. 1982 gründete er die Berner Opern Truppe, es folgten Anstellungen als Spielleiter in Bremen und Oberspielleiter in Münster. 1992 trat Mentha als Intendant am Tiroler Landestheater in Innsbruck an.
In Innsbruck machte Mentha mit einem engagierten, gegenwartsbezogenen Programm Furore. 2.000 Abonennten wollten den von Mentha eingeschlagenen Weg nicht mitgehen, doch das junge Publikum begeisterte sich plötzlich für Theater und Oper. Auch international sorgten Produktionen des Landestheaters für Aufmerksamkeit.
Eine wohlüberlegte Spielplandramaturgie, Bereitschaft zu Risiko und Innovation sowie die Pflege der Operette gehören zu den Hauptanliegen Menthas für Wiens zweites Opernhaus. Am 8. Oktober findet an der Volksoper die erste große Premiere der Ära Mentha statt: "Die Vögel" von Walter Braunfels. MK
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!