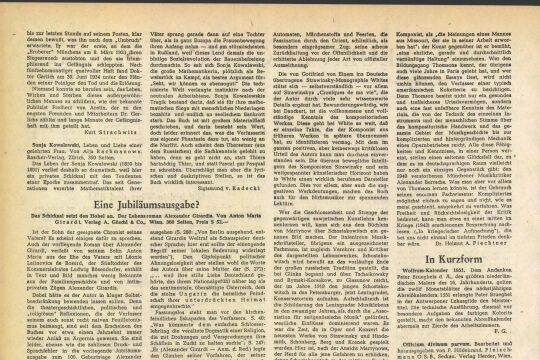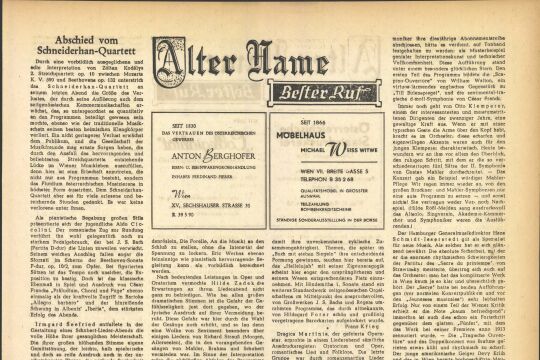Skizzen zum Profil von Robert Schumann, dessen Todestag sich zum 150. Mal jährt.
Im Mozartjahr 2006 ist das Rampenlicht der öffentlichen Aufmerksamkeit nicht ganz gerecht verteilt. Gegen das werbeträchtige Ausnahmegenie haben es alle anderen Jubilare schwer, ob sie der literarischen Gilde oder der Zunft des Musikers angehören. Von Robert Schumann, der am 29. Juli 1856 gestorben ist, war bislang recht wenig die Rede. Da wurde noch öfter an den 1906 geborenen Dimitri Schostakowitsch erinnert. Und der 1806 verewigte Michael Haydn findet zumindest in seinem regionalen Umfeld und in lokalen Veranstaltungskalendern erhöhtes Interesse. Doch wer spricht von 2006 als einem Schumann-Jahr?
Kanten und Brüche
Der Komponist aus Zwickau fasziniert besonders Liedersänger und Pianisten. Auch im Publikum zählen viele Kenner zu Liebhabern seiner Musik. Gleichwohl ist er kaum je ein populäres Idol breiter Hörerschichten geworden. Der sperrige, schon früh zwischen Enthusiasmus und Lethargie pendelnde Künstler eignet sich schlecht zum Helden eines sentimentalen Singspiels vom Schlage Dreimäderlhaus oder eines überdrehten Theaterstücks à la Amadeus. Man stellt es nüchtern und ohne Bedauern fest. Immerhin ist in den achtziger Jahren der subtile Spielfilm Frühlingssymphonie den Sprüngen, Kanten und Bruchlinien im Persönlichkeitsbild des Musikers einfühlsam nachgegangen. Die Ehe mit der Klaviervirtuosin Clara Wieck, dem Brautvater und früheren Lehrer Schumanns mühevoll auf dem Gerichtsweg abgerungen, zählt zu den vielen Paradoxien in der Biographie des Komponisten. Vor Zeiten prangte eines der bekannten Porträts des Ehepaars als Symbol der Seelenharmonie und kongenialen Partnerschaft in jedem gutbürgerlichen Musiksalon.
Wettstreit der Begabungen
Im Lichte neuer Dokumente eines tiefenpsychologischen Röntgenblicks, aber auch von der kritischen Warte des Feminismus haben sich in den vermeintlichen Gleichklang der Gemüter Dissonanzen eingeschlichen. Das vorausgesetzte Ideal zeigt Risse und offenbart Untiefen. Schumann hat sich selbst als einen unausgeglichenen Charakter empfunden. Seine beiden Naturen, den energisch-schwungvollen Florestan und den schwärmerisch-wilden Eusebius, konnte er nie zu einem meisterlichen Ebenmaß fügen und verschmelzen. Ungelöste Konflikte und andauernde Spannungen bestimmen seine Lebensbahn. Da gibt es den Wettstreit von literarischer und musikalischer Begabung. Auch in seinen späteren Jahren hat der Musiker eine gewandte Feder geführt, vorzügliche Essays verfasst und manchen Zeitgenossen gerade als Schriftsteller überzeugt. Als ihn im Vorfeld seines Suizidversuches im Rhein (Februar 1854) die schöpferischen Kräfte verließen, sammelte er noch von der Antike an poetische Zeugnisse zur Musik und ihrer Wirkung auf Mensch und Natur. Dass diese Anthologie, der Schumann den Namen Dichtergarten gab, bis heute keinen Verleger gefunden hat, lässt sich nur als fahrlässiges Desinteresse bedauern.
Auch die Ambitionen als Komponist und Pianist schufen Spannungen und Friktionen, bis die Folgen einer schädlichen Fingerübungsmethode eine Konzertkarriere ausschlossen. Ein weiteres Spannungsfeld bedeutete die Konkurrenz zwischen kammermusikalischem Schaffen und der angestrebten großen symphonischen Form. Besondere Hoffnungen aber hatte der Künstler auf seine Oper Genoveva (nach Hebbels Drama) gesetzt. Als dramaturgisch misslungen wurde sie stigmatisiert und lange von den Bühnen verbannt: Heute entdeckt die Musikwelt zunehmend ihre ureigenen Schönheiten.
Den nervlichen und psychischen Zusammenbruch Schumanns, der zu einem längeren Siechtum und zum Tod des 46-Jährigen in der Nervenheilanstalt Endenich bei Bonn geführt hat, beurteilt die moderne Forschung als eine unselige Allianz von endogener Veranlagung und den Spätfolgen einer Geschlechtskrankheit (vermutlich der Syphilis), verstärkt noch durch Merkmale eines fortschreitenden Alkoholismus. Jüngere Darstellungen von Schumanns Lebensweg lesen sich nachgerade wie Pathographien einer hoffnungslosen Leidensbahn. Aber wie sollte auch das Selbstwertgefühl eines Komponisten intakt bleiben, der beim Empfang nach einem bejubelten Konzert seiner Gattin von einem Prinzen gefragt wurde, ob er auch musikalisch sei?
Schatten eines Zerrissenen
Im Jahr 1996 hat Peter Härtling seinen Künstlerroman Schumanns Schatten veröffentlicht, der dem Charakterbild eines Zerrissenen mit Empathie gerecht wird. Im Titel des Buches wird auf den Krankenpfleger Tobias Klingelfeld angespielt. Der Ausdruck "Schatten" verweist aber zugleich auf die dunkle Seite von Schumanns Biographie und jene Eintrübung, die der Todkranke im letzten Brief an seine Frau benannt hat: "Es wehet ein Schatten darin", schrieb er.
Bis zu seinem Opus 23 hat Schumann ausschließlich für das Klavier geschrieben: für sich selbst, für Clara, aber auch als Niederschlag seiner klangpoetischen Visionen. 1840 endlich war es mit dem jungen Eheglück zu jenem beispiellosen Liederjahr gekommen, in dem der größte und bedeutendste Teil von Schumanns Gesängen entstanden ist: Darunter befinden sich Schöpfungen wie die Liederkränze nach Justinus Kerner und Joseph von Eichendorff, der Zyklus Frauenliebe und-leben (nach Adalbert von Chamisso) und die beiden ,lyrischen Novellen' auf Texte von Heinrich Heine - den Liederkreis op. 24 und Dichterliebe op. 45.
"Ich grolle nicht"
In mehrfacher Hinsicht sind diese Werke bemerkenswert. Auf den Spuren von Franz Schuberts Schöner Müllerin folgen sie einem wohldurchdachten Bauplan. So sind die ersten sechs Gesänge der Dichterliebe von einer Hochstimmung aus Hoffnung, Überschwang und Liebesglück erfüllt, die bis zum Vergleich der Liebsten mit den Zügen der Madonna im Kölner Dom reicht. Im siebenten Lied kommt es zur Peripetie, zu einem jähen Wechsel der Stimmung. "Ich grolle nicht", diese verbale Botschaft wird wie zur Bestätigung mehrmals wiederholt, aber vom alten bösen Lieder" in einem Sarg von phantastischen Dimensionen: denn "ich senkt' auch meine Liebe und meinen Schmerz hinein".
Anders als Schubert, dem die zyklische Abfolge seiner Müller-Lieder vom Dichter vorgegeben waren, hat Schumann den Verlauf und die Stimmungskurve der Dichterliebe (wie auch den Titel) selbst gefunden - durch gezielte Auswahl aus Heines Buch der Lieder. In einigen Gedichten hat er Heines Ambivalenz und schneidende Schärfe erkannt und musikalisch umgesetzt. Nicht selten kommt es aber auch zum produktiven Missverständnis, wenn er unter der glatten Oberfläche den destruktiven Hintersinn nicht merkt - oder nicht wahrhaben will.
Klavier als Partner
Das Klavier, Schumanns vertrautes Instrument, verselbständigt sich in diesem Zyklus bisweilen zu einem Partner des singenden Individuums, dieses bald tröstend, dann wieder mit ihm klagend, nicht selten aber auch im deutlichen Widerspruch zu ihm. So endet das Werk mit einem langen Nachspiel, in dem sich der Musiker gegen die Aussage des Dichters erneut in die Stimmung eines der früheren Lieder versenkt und verliert. Von Schumanns literarisch reflektierten, auf Dichterprofile abgestimmten Vertonungen führt ein gerader Weg zum pointierten Liedschaffen von Hugo Wolf.
In der älteren Literatur wird die künstlerische Laufbahn Schumanns zumeist als ein sukzessiver Abstieg verstanden. Der Komponist habe als ungestümes Genie begonnen, in den Klavierwerken und Liedern sein eigentliches Metier gefunden, sich aber bereits in einem Teil seiner Orchesterwerke verstiegen und auf ein ihm ungemäßes Terrain gewagt. Die Stücke aus dem letzten kreativen Jahr 1853 waren der früheren Forschung häufig fast nur für die Anamnese und Diagnose eines Krankheitsprotokolls aufschlussreich. Als Zeugnisse einer inneren Entwicklung, als Resultate eines folgerichtigen Spätstils und einer eigenwilligen Tonsprache galten sie dagegen wenig.
Dem Schumann'schen Orchesterklang hat man genuine Farben und authentische Klangwirkung abgesprochen. Der Musiker habe im Grund immer für das Klavier erfunden und lineare Strukturen später eher unzulänglich instrumental umgesetzt. Die aktuelle Schumannliteratur sieht hingegen in den teils kargen und fahlen Farben, auch in den gewollt dominanten Blechbläserfanfaren ein unverwechselbares Spezifikum, auch eine Schaltstelle und ein Scharnier zwischen dem Symphoniker Beethoven und der Orchestersprache eines Brahms.
Musikalisches Psychogramm
Die zweite Symphonie (C-Dur, op. 61), die 1845 nach längerer Krankheit entstanden ist, würdigt ein vielgelesener Konzertführer aus den fünfziger Jahren vor allem als Beweisstück des beginnenden Verfalls: "Eine gewisse unruhige Monotonie erzeugt eine verquälte, müde Stimmung. Aber die Gestaltungskraft steht in keinem Verhältnis zum Wollen. Die Rhythmik entbehrt des Schwunges. Leere Wiederholungen ermüden." Der früh verstorbene Dirigent Giuseppe Sinopoli, selbst promovierter Neurologe und Psychiater, hat diesem Werk eine ausführliche Studie gewidmet und es als ästhetisch überzeugendes Psychogramm gelesen. Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt und Christian Thielemann setzen das gleichsam neu entdeckte Stück heute immer wieder auf ihre Konzertprogramme.
Das Violinkonzert, im Herbst 1853 in nur zwei Wochen geschrieben, haben Clara Schumann und Johannes Brahms nach dem Tod des Komponisten quasi geheim gehalten, es also nicht publiziert. Sein Nachruhm sollte nicht durch ein so schwieriges wie unbefriedigendes Werk beschädigt werden. Erst 1937 wurde es veröffentlicht und bald darauf uraufgeführt. Jüngste Analysen sehen in der Reduktion der äußeren Mittel und im mitunter schroffen Gegeneinander von Sologeige und Orchester ein bewusstes Programm. "Äußerste Sparsamkeit mit dem musikalischen Material wird zum Kompositionsprinzip: aus nur drei melodischen Elementen entwickeln sich die Themen aller Sätze": Auch für den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Violine und Tuttiklang bietet sich da ein Deutungsmuster an. "Er bildet eine Isolation des einzelnen in der Gesellschaft ab."
Besonders krass hat sich das Urteil über die Gesänge der Frühe (op. 133) gewandelt. Schumann hat die fünf Klavierstücke zwischen 15. und 18. Oktober 1853 als sein letztes gültiges Werk geschaffen. Otto Schumann bemerkte dazu in seinem Handbuch der Klaviermusik (1963) recht überheblich: "Zur Spreu hätte der Tondichter auch die Gesänge der Frühe rechnen dürfen, bei denen Gehalt und Widmung (,Der hohen Dichterin Bettina' - d.h. Brentano bzw. Arnim) sich geradezu erschütternd widersprechen." In der kleinen Rowohlt-Monographie von Barbara Meier (1995), aus der auch die Zitate zum Violinkonzert stammen, erfährt der späte Zyklus dagegen eine differenzierte Würdigung. Ihr Tenor gilt ebenso dem tonalen Hölderlin-Bezug mit der Chiffrierung der Namen Diotima und Hyperion wie auch dem Doppelsinn der Metapher "Frühe". Diese "bedeutet den Ausblick auf Neue Bahnen", leitet aber auch zurück "in die Frühe der Vergessenheit".
"Frage nicht! Glaube, liebe!"
Im Herbst 1854 bittet Schumann von der Heilanstalt aus seine Frau Clara in mehreren Briefen um eine Abschrift jener "Liebeszeilen, die ich Dir von Wien nach Paris schickte". Schon damals, im Jahre 1838, hatte der Künstler den tiefen Zwiespalt und die dunkle Seite seines Wesens klar erkannt und der Braut in Versen kundgetan:
Doch wenn ich Dir alles enthüllte - / Du sähest auf finstre Gebilde, / Gedanken, schwer und trübe / Frage nicht! Glaube, liebe!
Der Autor ist
Professor für Sprachwissenschaft an der Universität Salzburg.erregten Tonfall der Stimme und der Sprache des Klaviers konterkariert und widerlegt. Von da an dominieren Wehmut, Verzweiflung, Ironie, gar Zynismus, auch Zuflucht im Traum, bis sich am Ende Resignation einstellt. Das lyrische Subjekt begräbt "die