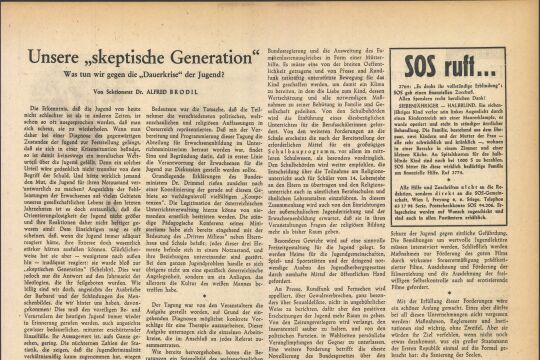Zum Umgang der Kirche mit sexueller Gewalt in den eigenen Reihen: Beherztes Handeln – auch gegen den Willen des Einzelnen – kann nötig sein.
Als die Berliner Rechtsanwältin Ursula Raue am 27. Mai ihren Abschlussbericht zu Fällen sexuellen Missbrauchs bei den Jesuiten vorstellte und das Ausmaß von über 200 Opfern und mindestens 14, vielleicht aber auch 46 Tätern bekannt machte, prangerte sie die jahrzehntelange systematische Vertuschungspraxis des Ordens an. Nie hätten die Verantwortlichen die Opferperspektive eingenommen. Immer sei das primäre Ziel gewesen, keinen Schatten auf die Einrichtungen des Ordens fallen zu lassen und deren Ruf zu schützen. Und der Glaube, alles mit den eigenen Kräften und Methoden lösen zu können, habe eine immer tiefere Verstrickung in das furchtbare Unrecht befördert (Ursula Raue, Bericht über Fälle sexuellen Missbrauchs an Schulen und anderen Einrichtungen des Jesuitenordens vom 27. Mai 2010, Berlin, Seite 21).
Wie konnte es nur so weit kommen? Natürlich, sexuelle wie nichtsexuelle Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen gibt es überall – da steht die Kirche keineswegs allein da – und wird es trotz bester Prävention auch in Zukunft geben, wenn auch hoffentlich in weit geringerem Ausmaß. Aber wie kann es passieren, dass eine Institution, die von ihrer Botschaft her dem Schutz der Kinder und Wehrlosen höchste Priorität beimisst, in diesem Maße wegschaut, den Skandal ignoriert, ja Anklagen von außen zu diskreditieren versucht und zum Verstummen bringen will?
Stark geschützte Räume
Bisher wurden von wissenschaftlicher Seite zahlreiche Reflexionen über die Täter und täterorientierte Präventionsmaßnahmen angestellt. Außerdem wurden die systemischen Faktoren diskutiert, soweit sie die Sexualmoral der katholischen Kirche betreffen. Bis auf eine Einlassung des Soziologen Franz Xaver Kaufmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 26. April 2010 fehlt aber – so weit ich sehe – noch weitgehend die Reflexion der Vertuschungsstrukturen und die Erörterung von Wegen ihrer Beseitigung. Dieser Frage möchte ich daher nachgehen.
Internate haben, systemtheoretisch betrachtet, eine fast identische Grundstruktur wie die Familie: Die Mitglieder pflegen untereinander eine große emotionale, räumliche und ggf. auch körperliche Nähe. Zu diesem Zwecke bieten beide Systeme einen stark geschützten Raum, in den von außen kaum jemand Einblick oder Zugang hat. Und drittens gibt es in beiden erhebliche Abhängigkeitsverhältnisse und ein steiles Machtgefälle von den Eltern bzw. Oberen zu den Kindern, das nicht selten mit Ängsten verbunden ist. In meinen Ausführungen werde ich mich auf den zweiten der drei Aspekte konzentrieren: Ein Großteil der Vertuschung ist einer krassen Fehlinterpretation dieses geschützten Raums zu „verdanken“.
Familie zwischen innen und außen
Schauen wir zunächst auf die Familie: Sie lebt ganz wesentlich davon, dass es eine Unterscheidung zwischen innen und außen gibt. Im Inneren existiert ein Raum, in dem alle Beteiligten viele der Masken fallen lassen können, die sie außerhalb derselben aufsetzen, um sich vor Zugriffen auf ihre Intimsphäre zu schützen. In der Familie haben die Mitglieder im Regelfall weniger Geheimnisse voreinander und zeigen sich weitgehend so, wie sie wirklich sind – mit all ihren Stärken und Schwächen. Außerhalb der Familie nimmt man sich zusammen und versucht, die von der Gesellschaft vorgegebenen Rollen halbwegs ordentlich auszufüllen.
Damit hat die Familie eine eminent wichtige Bedeutung: Sie bietet ihren Mitgliedern einen Raum, ihre Persönlichkeit zu erproben und ihr Innerstes zu zeigen, ohne gleich Sanktionen und Nachteile befürchten zu müssen. Die Liebe und das Wohlwollen einer guten Familie mildern den Wettkampf und den Zwang, ständig den Ansprüchen der anderen zu genügen. Sie bieten eine Freiheit personalen Reifens und Wachsens, die es sonst nur noch in guten Freundschaften gibt.
Um diesen Schutzraum zu sichern, gilt in der Familie das Gebot der Diskretion. Interna werden nicht nach außen getragen, sondern bleiben in der Gruppe. Konflikte löst man untereinander und ruft nicht nach einem Schiedsrichter von außen. Der feste Wille, gut miteinander auszukommen und zueinander zu stehen, ermöglicht den weitestgehenden Verzicht auf externe Hilfe.
Doch was geschieht, wenn eine Familie nicht mehr mit ihren Problemen zurande kommt? Zwei Typen von Situationen können eintreten, in denen die Geheimhaltung familiärer Probleme zur tödlichen Falle wird und selbstzerstörerisch wirkt:
1. Im Falle der Krankheit oder Therapiebedürftigkeit eines Familienmitglieds braucht es den Therapeuten: Man denke an den Fall, dass Vater oder Mutter an Alkoholismus leiden. Dann kommen sie ohne professionelle Hilfe Dritter nicht aus dem Elend heraus. Nicht umsonst ist es das erste Gebot der anonymen Alkoholiker, sich einzugestehen, dass man auf Hilfe angewiesen ist. Ähnliches gilt für eine schwerwiegende Ehekrise. Sie kann so tief sein, dass ohne professionelle Beratung kein Weg in die Zukunft eingeschlagen werden kann. Auch Essstörungen eines Kindes lassen sich ohne Therapie nicht bewältigen.
2. Im Falle einer schweren Schädigung Dritter durch ein Familienmitglied braucht es den Vermittler/ (Schieds-)Richter: Hier ist nicht zuerst an Straftaten im eigentlichen Sinn zu denken. Es genügen schon Schädigungen Dritter, die sich auf zivilrechtlicher Ebene abspielen wie ein Autounfall. Sobald ein gewisses Schadensausmaß überschritten wird, werden die Kontrahenten den Schaden nicht mehr ohne eine unparteiliche Vermittlungsinstanz regulieren können. Und wo das um eines befürchteten Ansehensverlusts willen z. B. in reichen Milieus versucht wird, wandeln die Beteiligten oft auf schmalem Grat.
Umkehrung der Dynamik
Dennoch weigern sich Familien oftmals beharrlich, in solchen Situationen Hilfe von außen zu beanspruchen. Man versucht das Alkoholproblem des Familienmitglieds allein in den Griff zu bekommen. Man verharmlost die Ehekrise oder die Essstörungen des Kindes. Man tut alles, um die Sachbeschädigung oder das Schulversagen des eigenen Kindes geheim zu halten.
Warum reagieren Familien so verschlossen? Was führt sie dazu, interne Probleme nicht für Außenstehende offenzulegen, wenn das doch eindeutig die einzige echte Hilfe bedeuten würde? Zum einen mag hier die Umkehrung der Dynamik eine Schwierigkeit darstellen: Bisher ging es immer darum, alle Probleme diskret und intern zu lösen – man hat nicht gelernt, sich mit solchen Problemen Dritten anzuvertrauen. „Das machen wir unter uns aus“ oder „Das schaffen wir schon allein“ sind vertraute Denkfiguren, die nicht so leicht überwunden werden, so vertraut sind sie über die Jahre geworden. Zum Zweiten herrscht eine enge Verbundenheit mit dem Kranken oder Schuldigen. Es schiene Verrat, sein Problem einem Dritten mitzuteilen. Drittens zerbräche mit dem Aufsuchen professioneller Hilfe das bisherige Familienideal von Harmonie und Frieden. Und schließlich würde man womöglich auch eine (systemische) Mitverantwortung für Krankheit oder Schuld des betreffenden Familienmitglieds einräumen und schämt sich: Essstörungen von Kindern haben oft mit Spannungen zwischen den Eltern zu tun. Fehltritte der Kinder fragen die Erziehung der Eltern an.
Nur vordergründiger Imageverlust
Was ich fürs System Familie geschildert habe, findet sich ganz ähnlich im Umgang von Orden und Diözesen mit sexueller und nicht sexueller Gewalt einzelner Mitglieder. Und zumindest im Falle pädophiler Täter ist nicht nur eine, sondern sind beide Indikationen für eine Öffnung des geschützten Raums für professionelle Hilfe von außen gegeben: Der Pädophile ist krank, und er hat Dritte schwer geschädigt. Im Unterschied zur Familie sollte allerdings die Kirche weit professioneller mit internen Problemen umgehen. Sie müsste ein differenziertes und wirksames Regelsystem entwickeln, wann und wie sie ihren geschützten Raum öffnet und welche professionellen Helferinnen und Helfer sie im konkreten Fall konsultiert. Sie müsste bereits vorab festlegen, welche Informationen und Informationsquellen bzw. -träger dann Auskunft zu geben haben, damit wirksam geholfen werden kann und dennoch der Persönlichkeitsschutz Betroffener gewahrt bleibt. Ein solches Regelsystem sollte im Übrigen weit über den Fall von Gewalt hinausgehen. Viele andere Situationen lassen es im gleichen Maße geraten sein, die Türen des Schutzraums zu öffnen. Die Richtlinien der Bischofskonferenz sind da nur ein erster, zaghafter Schritt.
Letztlich geht es um die Frage, was Loyalität eigentlich bedeutet: Sie ist keine Nibelungentreue und auch keine Freunderlwirtschaft. Loyalität heißt Mitgefühl für und Vertrauen in den Mitmenschen. Sie schließt aber ein offenes Wort und ein beherztes Handeln gegen dessen Willen ein, wo dies unumgänglich und letztlich hilfreich ist – für den Betroffenen, für seine Opfer und auf lange Sicht auch für die Gemeinschaft, die nur vordergründig einen Imageverlust erleidet.
* Der Autor, Moraltheologe, ist Rektor der Kath.-Theol. Privatuni Linz