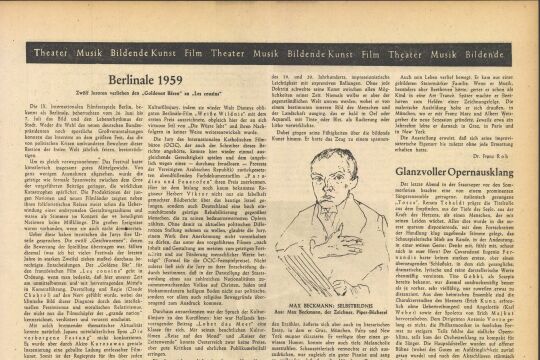Das beängstigend reale Kriegsdrama „Lebanon“ gewinnt den Goldenen Löwen bei den 66. Filmfestspielen am Lido. Österreichs Beitrag „Lourdes“ von Jessica Hausner bleibt – leider – ohne großen Preis.
Samuel Maoz weiß, wovon er erzählt: Der Filmemacher aus Tel Aviv hat im Libanon-Krieg 1982 zum ersten Mal einen Menschen getötet. „Ich handelte nicht auf Befehl, sondern in einem instinktiven Akt von Selbstverteidigung. 25 Jahre später mache ich nun einen Film über diesen Krieg. Beim Schreiben konnte ich plötzlich wieder den Geruch des verbrannten Menschenfleisches riechen“, sagt Maoz. Sein Kriegsdrama „Lebanon“ hat beim Filmfestival in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen. Die von Ang Lee geleitete Jury hat damit ein politisches Statement gesetzt, sich aber auch vor einer formal wie dramaturgisch außergewöhnlichen Arbeit verbeugt. Außergewöhnlich, weil Maoz den Zuschauer in die Enge eines Panzers zwängt, um den Krieg aus der Sicht der Soldaten erlebbar zu machen.
Maoz hebelt mit dieser Festlegung auf nur eine Perspektive aus, woran so viele Kriegsfilme scheitern: Krieg ist kein bombastisches Spektakel mit effektvollen Explosionen und dramatischen Kamerafahrten. Maoz’ Blick bleibt das Zielfernrohr des Panzers, durch das die Soldaten ihre Schlacht führen. Zwischen ohrenbetäubenden Kanonen müssen die Soldaten mit ansehen, wie sie auf Knopfdruck ganze Familien ausbomben. Dazu ein beklemmendes Unsicherheitsgefühl: Durch die eingeschränkte Sicht auf den Schauplatz bleibt auch der Fortgang der Ereignisse unvorhersehbar. Ein Psycho-Druck für die Soldaten, denn keiner von ihnen ist auf das Töten vorbereitet. Doch Soldaten müssen „funktionieren“. Das liegt wohl am Motor jedes Krieges: Angst. Unmittelbarer hat man dieses Gefühl im Kino selten gesehen.
Von Jessica Hausner bis Oliver Stone
Angst ist auch der Antrieb für die Protagonistin in Jessica Hausners österreichischem Beitrag „Lourdes“, der trotz seines überwältigenden Anklangs keine Jury-Berücksichtigung fand, aber immerhin den Preis der internationalen Filmkritik und der ökumenischen Jury erhielt: Eine an multipler Sklerose leidende Frau (Sylvie Testud) setzt sich ihrer lähmenden Angst vor der Ausweglosigkeit entgegen: In Lourdes hofft sie auf eine wundersame Heilung ihres Leides. Tatsächlich kann die bereits völlig gelähmte Frau bald wieder ihre Arme bewegen, schafft es sogar, aus dem Rollstuhl aufzustehen. Was die Ärzte als kurzfristige Besserung dieser schubartig verlaufenden Krankheit werten, ist für sie die ersehnte Wunderheilung.
Einerseits hat der Pilgerbetrieb in Lourdes den Charakter einer touristischen Eventreise, andererseits will Hausner, selbst aus der Kirche ausgetreten, keineswegs von der Unmöglichkeit einer Heilung sprechen. Ihre ambivalente Grundhaltung macht „Lourdes“ zum tiefen Erlebnis: Hinter den Bildern von Massensegnungen und Heilungsritualen stecken all die Grundängste des Menschen, besonnen eingearbeitet, unkitschig und doch voller Sehnsucht inszeniert.
Hausners Produktionsfirma Coop99 hatte neben „Lourdes“ noch eine weitere Koproduktion im Wettbewerb, nämlich „Women Without Men“, für den Shiran Neshat den Regiepreis erhielt. Der Film erzählt von der Demokratie-Bewegung im Iran, die nach dem Putsch von 1953, mit dem der Schah wieder an die Macht kam, abrupt endete. Neshat zeigt in ihrem Erstlingsfilm, wie Perser für die Demokratie auf die Straße gehen – und trifft damit den Nerv der Zeit. Viele politisch motivierte Filme dieses Festivals thematisierten den Demokratie-Begriff.
Oliver Stone tritt in seiner Doku „South of the Border“ den Angstparolen der Bush-Regierung entgegen, indem er an einem fanatischen Porträt des Staatschefs von Venezuela bastelt. Hugo Chavéz gilt in vielen westlichen Staaten als Diktator, doch Stone zeigt den Ex-Soldaten als Mann des Volkes, der Aufschwung in sein Land und nach ganz Südamerika bringt. Der Film verklärt Chavéz zum Volkshelden – und dieser konnte den Ruf festigen: Er kam nach Venedig und ließ sich wie ein Popstar feiern.
Michael Moore wiederum kanalisiert die Wut auf Megakonzerne und Bankengeschäfte in seiner Abrechnung mit dem Kapitalismus: In „Capitalism – A Love Story“ geht es ihm mit seiner zynisch-süffisanten Erzählweise um mehr als bloß das Aufzeigen der unglaublichen Geldvernichtung in der Finanzkrise. Moore geht es um Demokratie: „Es ist sehr schwer, ein Land wie die USA als Demokratie zu bezeichnen, wenn es in Wirklichkeit die Wirtschaft ist, die dieses Land und seine Bürger kontrolliert.“
Abseits des Kunst-Kinos
Dem engagierten Polit- und Kunstkino setzte das Festival dieses Jahr bewusst auch zugänglichere Filme entgegen. Todd Solondz’ „Life During Wartime“ (Drehbuchpreis) ist eine facettenreiche Beziehungsgeschichte mit intelligentem Witz und politischen Seitenhieben auf die Beziehungen zwischen den USA und Israel. In Werner Herzogs Remake „Bad Lieutenant“ brilliert Nicolas Cage als gefallener Cop am Drogentrip. Neue, gefällige Filme mit Matt Damon oder George Clooney fanden sich seltsamerweise nicht im Wettbewerb, dafür aber George A. Romeros sechster Zombie-Aufguss „Survival of the Dead“. Fashion-Designer Tom Ford zeigte mit der Schwulen-Fantasie „A Single Man“ sein Regiedebüt, in dem ein College-Professor (Darstellerpreis: Colin Firth) den Reizen junger Männermodels in rosa Pullovern erliegt.
Der leichte/seichte Programm-Teil als willkommene Abwechslung für die Jury? Anders ist der Große Preis der Jury für Fatih Akins „Soul Kitchen“ nicht zu erklären. Ein Ensemblestück, in dem der deutsch-türkische Regisseur von der Schwere seiner letzten Filme deutlich abrückt. Die turbulente Komödie um ein Hamburger Fritten-Restaurant, das sich in eine Nobel-Küche verwandeln soll, ist eine spaßige Revue voll leichter (und leicht vorhersehbarer) Unterhaltung. Vielleicht soll man sich im Kino aber nicht nur wie in einem engen Panzer fühlen, der nur einen einzigen Ausguck bietet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!